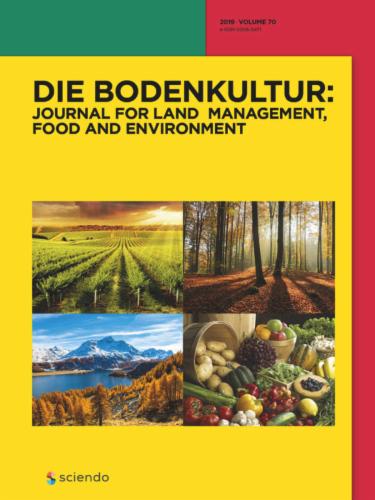Einfluss von Niederschlägen im Vegetationsverlauf und hohen Temperaturen im Frühjahr sowie Pflugeinsatz auf den Kornertrag von Winterweizen in Niederösterreich
Data publikacji: 19 sie 2025
Zakres stron: 1 - 10
Otrzymano: 11 lut 2025
Przyjęty: 17 mar 2025
DOI: https://doi.org/10.2478/boku-2025-0001
Słowa kluczowe
© 2025 Hans-Peter Kaul et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Winterweichweizen (
Das pannonische Klimagebiet, wozu auch das mittlere und östliche Niederösterreich zählen, ist aufgrund seiner klimatischen Gegebenheiten prädestiniert für den Qualitätsweizenanbau. Winterweizen stellt relativ hohe Ansprüche an das Klima, die benötigte Wärmesumme beläuft sich auf 2000–2200 °Cd. Die Photosyntheserate und der Blattflächenindex können durch optimale Versorgung der Weizenpflanzen mit Wasser und Nährstoffen ab drei Wochen vor Blühbeginn (70–90 % des Gesamt-N werden in dieser Zeit aufgenommen) gesteigert werden. Stress hingegen, verursacht durch Hitze, Trockenheit, Insektenfraß oder Krankheitsbefall, senkt den Blattflächenindex und die Photosyntheserate und führt direkt zu einer Ertragsdepression, vor allem über eine Reduktion der Kornzahl pro Ähre (Satorre und Slafer, 1999).
Ciais et al. (2005) schätzten für Europa im Jahr 2003, das von Hitze und Trockenheit gekennzeichnet war, einen Rückgang der Primärproduktion um etwa 30 %. Zurückzuführen sei der Rückgang vor allem auf den Klimawandel, der eine gesteigerte Anzahl an Hitzewellen und eine Senkung der Jahresniederschlagsmenge zur Folge habe. Nach Christen (2009) sind ausreichende Niederschläge und gemäßigte Temperaturen besonders in der Kornfüllungsphase des Winterweizens entscheidend. Auf dem trockenen Standort Rauischholzhausen in Hessen waren in einem 12-jährigen Versuch Temperatur (r = 0,33) und Niederschlag (r = 0,50) positiv mit dem Ertrag korreliert (Wegener, 2000).
Oleksiak et al. (2022) beobachteten in Trockenjahren in Polen einen Rückgang der Winterweizen-Erträge von 1992–2019 um 6,3–8,3 % gegenüber dem langjährigen Trend. Trockenstress ist auch in den großen Getreideanbaugebieten im Osten Österreichs keine Seltenheit mehr, und auch Hitzetage, die in dieser Arbeit als Tage mit über 27 °C Maximaltemperatur angenommen werden, mehren sich. Insbesondere die maximale Lufttemperatur während der generativen Phase, also während der Blüte und der Kornfüllung des Winterweichweizens (BBCH 60–87), beeinflusst den Kornertrag signifikant (Salehnia et al., 2018). Die Erträge von Wintergetreide variieren dadurch stark von Jahr zu Jahr und auch von Region zu Region.
Welchen Einfluss die Niederschläge vor bzw. nach dem Winter haben, ist jedoch wenig untersucht. Während die Niederschläge nach dem Winter unmittelbar das Wachstum fördern, können Niederschläge im Herbst und Winter nach Speicherung im Bodenwasservorrat indirekt helfen, fehlende Frühjahrsniederschläge zu kompensieren. Eine Studie in Tschechien ergab, dass sich das Risiko einer Frühjahrstrockenheit seit dem Jahr 2000 im Vergleich zur Periode 1960–1980 verdoppelt hat (Potopová et al., 2015). Das zunehmende Risiko von Frühjahrstrockenheit macht eine ausreichende Menge an Winterniederschlägen zur Auffüllung des Bodenspeichers umso wichtiger. Grundsätzlich wurde aber für den Versuchsstandort Groß-Enzersdorf der Universität für Bodenkultur ein positiver Einfluss (r = 0,43–0,60) der Jahresniederschläge über 11 Jahre hinweg nachgewiesen (Neugschwandtner et al., 2016). Ein positiver Einfluss der Jahresniederschlagsmenge auf den Winterweizenertrag (r = 0,45–0,52) wurde auch an vier trockenen Standorten im Iran nachgewiesen (Salehnia et al., 2018). In dieser Studie hatte die Höhe der Winterniederschläge allerdings keinen signifikanten Einfluss auf den Kornertrag von Winterweizen und Wintergerste, während Wintergetreide ab der beginnenden generativen Phase sehr empfindlich auf fehlenden Niederschlag und hohe maximale Tagestemperaturen reagierte. In einer tschechischen Studie wurde hervorgehoben, dass Winterweizen an zu hohen Winterniederschlägen auch leiden kann: Eine lange Schneedecke bis in das Frühjahr hatte, kombiniert mit höheren Regenmengen wie in den Jahren 1986 und 2006 in Süd-Mähren, eine erhöhte Auswinterung und so einen Minderertrag zufolge (Kolář et al., 2014). Ribeiro et al. (2019) fanden in Spanien, dass der Ertrag von Wintergetreide besonders stark unter einer Trockenheit zu Vegetationsbeginn und unter zu hohen Temperaturen in der Kornfüllungsphase zur Ernte hin leidet. Für Winterweizen wurden kleinere Einflüsse einer Trockenheits- bzw. Hitzeperiode auf den Ertrag im Herbst und Winter und größere Einflüsse im Frühjahr zur Blüte und Reife des Getreides festgestellt. Pirttioja et al. (2015) kommen zu dem Schluss, dass in Europa mit regionalen Unterschieden eine Steigerung der Durchschnittstemperatur einen höheren bzw. eindeutigeren Ertragsrückgang für Winterweizen bedeutet, als das bei einer sinkenden Jahresniederschlagsmenge der Fall ist. Das streicht den großen Einfluss der Temperatur auf den Weizenertrag heraus. Gefäßversuche in Klimakammern zeigten eine Verkürzung der Kornfüllungsphase um sechs Tage bei einwöchigem Hitzestress (ab 15 bzw. 25 Tage nach der Blüte) und eine Verkürzung um dreizehn Tage bei zweiwöchigem Hitzestress (ab 25 Tage nach der Blüte). In der Folge war das Tausendkorngewicht des Erntegutes signifikant geringer (Buck und Nisi 2007). Auf einem feuchten Standort in Dänemark senkte ein Anstieg der Temperatur in der Kornfüllungsphase um 1 °C den Kornertrag um durchschnittlich 0,25 t ha−1 und verkürzt die Kornfüllungsphase um 5 % in der Dauer. Ein Temperaturanstieg im Winter beeinflusste den Kornertrag ebenfalls negativ aufgrund der zu raschen Entwicklung der Weizenpflanze und dem dadurch unzureichend ausgebildeten Wurzelsystem (Kristensen et al., 2011).
Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt hat auch die Bodenbearbeitung, wobei der intensivste Eingriff durch das Pflügen erfolgt. Der Boden wird dabei in der Regel auf mindestens 20 bis maximal 35 cm Tiefe bearbeitet und gewendet. Dadurch wird der Boden auf dieser Tiefe durchschnitten, was zu einer Unterbrechung des kapillaren Wasseranstieges führen kann. Zugleich wird der Grobporenanteil erhöht und die bearbeitete Bodenschicht trocknet rascher aus. Mehrjähriges Pflügen kann außerdem zu einer Pflugsohlenbildung führen. Eine Pflugsohle ist eine verdichtete Schicht im Boden an der Bearbeitungsgrenze des Pfluges, die von Pflanzenwurzeln und auch von versickerndem oder aufsteigendem Wasser nur schwer durchdrungen werden kann. Insgesamt kann es nach dem Pflügen zu einer Reduktion der Mittelporen und folglich zu einem Defizit an nutzbarer Feldkapazität bzw. pflanzenverfügbarem Bodenwasser kommen (Lima et al., 2021). Natürlich kann der Pflugeinsatz auch gewisse phytosanitäre Vorteile mit sich bringen, z. B. hinsichtlich Getreide-Fußkrankheiten oder Ährenfusariosen.
Vergleicht man verschiedene Bodenbearbeitungsvarianten, so ist nach Pelegrin et al. (1990) die Direktsaat unter trockenen Bedingungen (Klimaräume bzw. Jahre) der Pflugsaat überlegen, was die Evaporation, also die unproduktive Wasserverdunstung betrifft. In eigenen Versuchen war in Jahren mit hohen Niederschlagsmengen während der Vegetation der Ertrag nach Pflugeinsatz oder konservierender Bearbeitung signifikant höher als nach Direktsaat, während in Jahren mit unterdurchschnittlichem Niederschlag die Direktsaat ertraglich überlegen war. In einigen Jahren konnten keine Unterschiede zwischen den Bodenbearbeitungsvarianten festgestellt werden (Neugschwandtner et al., 2016). Die vorliegende Arbeit soll für typische Ackerbaubezirke in Niederösterreich und die Jahre 2006–2019 folgende Fragen beantworten:
Haben die Niederschlagshöhen im Herbst, Winter, Frühjahr bzw. Frühsommer sowie die Summe der Niederschläge während des Weizenwachstums einen positiven Einfluss auf den Kornertrag? Hatdie Zahl der Hitzetage nach dem Winter bzw. die mittlere Tagestemperatur in der generativen Phase des Winterweizens einen negativen Einfluss auf den Kornertrag? Hat ein Pflugeinsatz vor der Saat des Winterweizens, welcher potenziell die Wasserverdunstung erhöht, einen signifikanten Einfluss auf den Kornertrag?
Die Datengrundlage der Arbeit stammt aus landwirtschaftlichen Betrieben in sechs verschiedenen Bezirken Niederösterreichs aus den 14 Erntejahren 2006–2019. Ein erster Datensatz umfasst landwirtschaftliche Arbeitskreisdaten, die von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich bereitgestellt wurden. Diese enthielten ab dem Erntejahr 2010 auch Angaben zu Pflugeinsatz vor dem Weizen (ja/nein). Da für die einzelnen Ertragsdaten keine Zuordnung zu bestimmten Schlägen und damit spezifischen Bodenmerkmalen verfügbar war, wurde stattdessen versucht, die besseren und schlechteren Standorte durch die Aufteilung der Ertragsdaten anhand ihrer Quartile herauszufiltern. Durch die 1. bzw. 4. Quartile wurden die 25 % niedrigsten bzw. 25 % höchsten Erträge herausgefiltert und getrennt analysiert. Einen zweiten Datensatz stellte Statistik Austria zur Verfügung (Mittelwerte je Bezirk 2006–2018). Enthalten sind jeweils sowohl konventionell als auch biologisch wirtschaftende Betriebe. Nähere Angaben zu den Charakteristika der Bezirke hinsichtlich des Bodens und des Klimas sowie die Zahl der jeweils einbezogenen Einzelschläge aus den Arbeitskreisen (in Summe n = 10970) enthält Tabelle 1.
Charakterisierung der Untersuchungsbezirke
Table 1. Characteristics of the study area (districts)
| Vorherrschende Bodenarten und -typen | Lösslehme; Tschernoseme, Parabraunerden, Pseudogleye | Lösslehme; Tschernoseme, Parabraunerden, Pseudogleye, saure Braunerden, Podsole, Gleye | saure Braunerden, Podsole, Gleye | saure Braunerden, Podsole, Gleye | Lösslehme; Tschernoseme, Parabraunerden, Pseudogleye | Lösslehme; Tschernoseme, Parabraunerden, Pseudogleye |
| Klimaraum | Pannonisch / Illyrisch | Pannonisch/Kontinental | Kontinental | Kontinental | Pannonisch | Pannonisch / Illyrisch |
| Verwendete Wetterstationen | Seibersdorf, Gumpoldskirchen, Berndorf, Klausen-Leopoldsdorf | Schöngrabern, Retz | Gars am Kamp, Horn | Krems, Langenlois | Laa a. d. Thaya, Poysdorf, Mistelbach | Wiener Neustadt |
| Mittlere Jahres-Niederschlagssumme 2005–2019 und Spannweite (mm) | 596 (350–756) | 501 (350–656) | 536 (373–733) | 546 (310–746) | 540 (389–725) | 625 (488–806) |
| Mittlere Jahrestemperatur 2005–2019 und Spannweite (°C) | 11,6 (10,2–12,6) | 10,8 (9,2–11,9) | 10,1 (8,6–11,1) | 11,1 (9,6–11,9) | 11,0 (9,5–12,1) | 10,8 (9,4–11,8) |
| Anbaufläche Winterweizen im Bezirk (ca. ha) | 6000 | 19240 | 11300 | 3420 | 26300 | 9800 |
| Anzahl Einzelschläge aus Arbeitskreisen | 1686 | 2781 | 2146 | 1239 | 2026 | 1092 |
Die Wetterdaten wurden von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik über das Institut für Meteorologie und Klimatologie an der BOKU bereitgestellt. Verwendet wurden Daten von 14 Wetterstationen, sodass je Bezirk meist zwei bis drei Stationen für einen Mittelwert herangezogen werden konnten. Die Wetterdaten wurden in jedem Jahr in vier Abschnitte unterteilt: „Herbst“ vom 16.7. bis 15.11., „Winter“ vom 16.11. bis 28. bzw. 29.2. eines Erntejahres, „Frühjahr“ vom 1.3. bis 30.4. und „Frühsommer“ vom 1.5. bis zur Ernte, für die der 15.7. angenommen wurde. Sodann wurde der Niederschlag pro Bezirk und Erntejahr, in den bereits oben erwähnten vier „Wachstumsphasen“ sowie für das gesamte Erntejahr berechnet. Zur Eingrenzung von Hitzestress wurde anhand der Tages-Maximaltemperatur die Anzahl der Tage über 27 °C (= Hitzetage) im Frühjahr und Frühsommer (1.3.–15.7.) eines jeden Erntejahres berechnet. Zusätzlich wurde die Tagesdurchschnittstemperatur in der frühsommerlichen generativen Wachstumsphase (1.5.–15.7.) ermittelt.
Erforderliche Mittelwerte wurden mittels EXCEL berechnet. Die Effekte der Faktoren Standort (Bezirk), Erntejahr und Pflugeinsatz sowie von deren Wechselwirkungen wurden mit der Software SAS, PROC GLM getestet. Die Berechnung von Pearson-Korrelationskoeffizienten mit Signifikanzprüfung erfolgte durch die Software SAS, PROC CORR.
Zwischen den Daten der Arbeitskreise (Abbildung 1) und jenen der Statistik Austria (jeweils jährliche Mittelwerte für alle Bezirke) wurde mit einem Korrelationskoeffizienten von r = 0,89 (p < 0,001, n = 78) ein sehr enger Zusammenhang ermittelt.
Die Ergebnisse der Korrelationsanalysen zwischen den Erträgen und den ausgewählten Witterungsparametern zeigt Tabelle 2. Hinsichtlich der Niederschläge konnten nur wenige Effekte nachgewiesen werden. Dabei zeigten sich auf Ebene der Bezirke bezüglich der Niederschläge in den vier Entwicklungsphasen mit einer Ausnahme gar keine signifikanten r-Werte. Bei gemeinsamer Betrachtung aller Bezirke war der Einfluss der Herbstniederschläge signifikant, allerdings mit Erklärungsbeiträgen (R2) von maximal 10 %. Auf ebenso niedrigem Niveau war auch für alle Bezirke gemeinsam ein positiver Einfluss der Jahresniederschlagssummen nachweisbar. Dieser wird anscheinend bestimmt von deutlich höheren Bestimmtheitsmaßen bis zu 0,42 in den Bezirken Hollabrunn, Krems und Mistelbach, welche die niedrigsten langjährigen Niederschlagshöhen aufweisen. In den feuchteren, im Süden Wiens gelegenen Bezirken Baden und Wiener Neustadt sind die Korrelationen weit von der Signifikanzschwelle entfernt. Das gilt auch für den trockeneren, allerdings besonders kühlen Bezirk Horn.

Kornerträge von Winterweizen (Boxplots aus 14 Jahren) in Abhängigkeit vom Standort (Bezirk). Bezirke mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant (p < 0,05).
Fig. 1: Grain yield of winter wheat (boxplots of 14 years) as affected by location (district). Districts marked with different letters are significantly different (p < 0,05)
Pearson Korrelationskoeffizienten (r) für den Zusammenhang zwischen Winterweizen-Kornertrag und Witterungsparametern in Abhängigkeit vom Standort (Bezirk) und Datenquelle für die Erträge (AK = Arbeitskreise, SA = Statistik Austria). Signifikante r-Werte sind fett hervorgehoben.
Table 2. Pearson coefficients of correlation (r) for the relationships between winter wheat grain yield and weather characteristics as affected by location (district) and yield data source (AK = farmers’ working groups, SA = Statistics Austria). Significant r values are highlighted in bold.
| AK | SA | AK | SA | AK | SA | AK | SA | AK | SA | AK | SA | AK | SA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage > 27°C 1.3.–15.7. | r | −0,520 | −0,418 | −0,503 | −0,538 | ||||||||||
| p < 0,05 | 0,057 | 0,000 | 0,137 | 0,016 | 0,039 | 0,004 | 0,006 | 0,025 | 0,019 | 0,006 | 0,067 | 0,058 | < 0,001 | < 0,001 | |
| Mittlere Temperatur 1.5.–15.7. | r | −0,471 | −0,464 | −0,477 | −0,446 | ||||||||||
| p < 0,05 | 0,089 | 0,001 | 0,095 | 0,019 | 0,084 | 0,039 | 0,005 | 0,040 | 0,040 | 0,017 | 0,110 | 0,055 | < 0,001 | < 0,001 | |
| Niederschlag 16.7.–15.11. | r | 0,273 | 0,143 | 0,518 | 0,498 | 0,164 | 0,388 | 0,467 | 0,515 | 0,436 | 0,386 | 0,237 | 0,142 | ||
| p < 0,05 | 0,346 | 0,641 | 0,058 | 0,083 | 0,574 | 0,190 | 0,092 | 0,072 | 0,119 | 0,192 | 0,416 | 0,642 | 0,003 | 0,012 | |
| Niederschlag 16.11.–28./29.2. | r | −0,191 | 0,047 | 0,462 | 0,285 | 0,301 | 0,237 | 0,144 | 0,200 | 0,233 | 0,274 | 0,266 | 0,137 | 0,136 | |
| p < 0,05 | 0,512 | 0,879 | 0,026 | 0,112 | 0,323 | 0,317 | 0,416 | 0,639 | 0,492 | 0,444 | 0,343 | 0,380 | 0,215 | 0,235 | |
| Niederschlag 1.3.–30.4. | r | −0,195 | 0,013 | −0,026 | 0,116 | −0,076 | −0,050 | 0,052 | −0,221 | 0,088 | 0,200 | −0,343 | −0,223 | −0,065 | −0,027 |
| p < 0,05 | 0,503 | 0,966 | 0,929 | 0,706 | 0,797 | 0,871 | 0,859 | 0,468 | 0,766 | 0,512 | 0,230 | 0,464 | 0,560 | 0,817 | |
| Niederschlag 1.5.–15.7. | r | 0,148 | 0,468 | 0,191 | 0,215 | 0,317 | 0,308 | 0,378 | 0,281 | 0,053 | 0,138 | 0,010 | 0,088 | 0,188 | 0,186 |
| p < 0,05 | 0,613 | 0,106 | 0,514 | 0,481 | 0,270 | 0,306 | 0,182 | 0,352 | 0,856 | 0,654 | 0,973 | 0,774 | 0,087 | 0,103 | |
| Jahres-Niederschlag | r | 0,002 | 0,270 | 0,342 | 0,467 | 0,433 | 0,156 | 0,172 | |||||||
| p < 0,05 | 0,993 | 0,372 | 0,012 | 0,017 | 0,231 | 0,108 | 0,027 | 0,139 | 0,034 | 0,017 | 0,593 | 0,574 | 0,018 | 0,026 | |
| n | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 84 | 78 | |
Hitzetage > 27 °C nach dem Winter (ab 1. März) wie auch höhere mittlere Tagesmitteltemperatur in der generativen Phase (ab 1. Mai) verursachten hingegen mit wenigen Ausnahmen signifikante Ertragseinbußen. Über alle Bezirke hinweg liegt der Erklärungsbeitrag bei 27–42 %. Der Zusammenhang in den einzelnen Bezirken erreicht durchweg höhere r-Werte bis zu r = 0,83 und ist in fast allen Fällen höher bei den Ertragsdaten der Statistik Austria als bei jenen der Arbeitskreise. Im Bezirk Wiener Neustadt sind diese Effekte nur als Tendenz nachweisbar (p > 0,1).
Bezüglich des Pflugeinsatzes vor dem Anbau des Winterweizens zeigten sich, neben der Hauptwirkung Pflug, sowohl zwischen Pflug und Standort als auch zwischen Pflug und Erntejahr hochsignifikante Wechselwirkungen (p < 0,001). Die Abbildungen 2 und 3 verdeutlichen allerdings die Dominanz der Hauptwirkung des Pflügens, da in jedem Jahr und auch auf allen Standorten mit Ausnahme von Mistelbach die Erträge des Winterweizens nach vorhergehendem Pflügen niedriger ausfielen als ohne Pflugeinsatz. Die durchschnittliche Ertragsminderung mit Pflugeinsatz betrug hierbei im Mittel der Bezirke 510 kg ha−1 und im Mittel der Erntejahre 460 kg ha−1.

Kornerträge von Winterweizen in 10 Jahren in Abhängigkeit vom Pflugeinsatz (ja/nein)
Figure 2. Grain yield of winter wheat in 10 years as affected by ploughing (yes/no)

Kornerträge von Winterweizen in Abhängigkeit vom Standort (Bezirk) und Pflugeinsatz (ja/nein)
Figure 3. Grain yield of winter wheat as affected by location (district) and ploughing (yes/no)
Die vorrangige Datenbasis dieser Arbeit sind landwirtschaftliche Arbeitskreisdaten aus den niederösterreichischen Bezirken Baden, Hollabrunn, Horn, Krems, Mistelbach und Wiener Neustadt. Hierbei handelt es sich um Ertragsdaten aus den Jahren 2006−2019, die von den Landwirtinnen und Landwirten selbst aufgezeichnet wurden. Es konnte keine Unterscheidung zwischen biologisch und konventionell wirtschaftenden Betrieben berücksichtigt werden. Pro Bezirk wurden zwischen ca. 1100 und 2800 Datensätze an die Landwirtschaftskammer Niederösterreich übermittelt, in Summe fast 11.000 Datensätze. Bei etwa 8000 dieser Datensätze wurde miterfasst, ob ein Pflugeinsatz vor der Saat erfolgt ist, wobei in ca. 850 von diesen 8000 Datensätzen vor der Saat gepflügt wurde. Der Pflugeinsatz ist also eher die Ausnahme gewesen, was die Daten zum Vergleich der Bodenbearbeitungsvarianten (mit/ohne Pflug) deutlich unbalanciert macht. Zudem konnte nur zwischen zwei Varianten der Bodenbearbeitung unterschieden werden: zum einen mit Einsatz des Pfluges vor der Saat, zum anderen alle pfluglosen Bodenbearbeitungsmethoden inklusive einer etwaigen Direktsaat. Der Pflugverzicht ist deshalb nur relativ unscharf abgegrenzt.
Die Datengrundlage ist insgesamt als umfangreich anzusehen, allerdings auf die untersuchten Bezirke begrenzt; Extrapolationen sind nur mit großer Vorsicht für ähnliche Boden-, Klima- und Produktionsbedingungen möglich. Wenn die Arbeitskreisdaten einzelnen Feldern zuordenbar gewesen wären, wäre es auch möglich gewesen, die verschiedenen Bodentypen und Bodenarten, die nicht unwesentlich zur Erreichung des Weizenertrages beitragen, zu berücksichtigen. Dies war rückwirkend nicht möglich. Es wurde stattdessen versucht, die besseren und schlechteren Standorte durch die Unterteilung der Ertragsdaten anhand ihrer Quartile herauszufiltern. Durch die 1. bzw. 3. Quartile wurden die 25 % niedrigsten bzw. 25 % höchsten Erträge herausgefiltert und getrennt analysiert. Diese Unterteilung ergab aber keine signifikanten Einflüsse der angenommenen Standortgüte auf die Korrelationen der Erträge mit den Wetterdaten (Daten nicht gezeigt).
Als zweiter Datensatz wurden auch Daten der Statistik Austria im Rahmen dieser Arbeit herangezogen. Es wurde für die Erntejahre 2006–2018 pro Jahr jeweils ein Mittelwert pro Bezirk übermittelt. Zum Pflugeinsatz lagen hier keine Angaben vor. Dieser wesentlich kleinere Datensatz kann im Rahmen der Arbeit vor allem als Möglichkeit zur Validierung der Ergebnisse der Arbeitskreisdaten angesehen werden, was angesichts der engen Korrelation beider Datensätze von r = 0,89 aussichtsreich erscheint und hinsichtlich der Korrelationsanalysen mit den Wetterdaten auch erfolgreich war, indem die Ergebnisse der Arbeitskreisdaten in aller Regel bestätigt werden konnten.
Die Unterteilung der Wetterdaten in die vier Abschnitte Herbst, Winter, vegetatives Wachstum und generatives Wachstum sollte zum einen die explizite Prüfung des Einflusses der „Winterniederschläge“ ermöglichen, zum anderen auch die gegenüber Trockenheit und Hitze besonders empfindliche generative Phase entsprechend abgrenzen. Zweifellos wären kleinteiligere Differenzierungen, z. B. Monatswerte, analysierbar gewesen und man hätte abhängig vom Witterungsverlauf für die einzelnen Jahre unterschiedliche kalendarische Abtrennungen insbesondere der generativen Phase vornehmen können. Dennoch ist es gelungen, mit den vorhandenen Daten und der gewählten Vorgehensweise konsistente Ergebnisse zu erzielen.
Grundsätzlich ist ein positiver Zusammenhang zwischen der Niederschlagsmenge und dem Kornertrag, zumindest an ariden und semi-ariden Standorten, zu erwarten. Die vorliegende Arbeit ergab jedoch unerwartet geringe Zusammenhänge zwischen Ertragsdaten und den Niederschlägen in vier Entwicklungsphasen des Winterweizens. Ein schwacher Einfluss konnte immerhin für die Herbstniederschläge über die sechs Bezirke hinweg gefunden werden. Dabei könnte eine Förderung der Keimung bzw. des Feldaufganges eine Rolle spielen. Der Zusammenhang ist allerdings sehr lose. Auch Salehnia et al. (2018) fanden, dass mit dem Trockenheitsindex KBDI, der die Wasserversorgung der oberen Bodenschicht beschreibt, in den Wintermonaten der Ertrag von Wintergetreide nicht vorhergesagt werden konnte. Diese Autoren berichten aber von einem positiven Einfluss der Niederschläge in den Monaten April und Mai auf den Ertrag von Wintergetreide an vier von sechs untersuchten Standorten im Iran. Die Jahresniederschlagsmengen liegen dort allerdings wesentlich niedriger (137–308 mm) als in den hier untersuchten niederösterreichischen Bezirken. Andere Autoren bestätigen den positiven Einfluss des Niederschlags in der Blüte und Kornfüllungsphase im Frühjahr auf den Weizenertrag (Potopová et al., 2015; Jolánkai et al., 2016; Saei et al., 2018; Ribeiro et al., 2019). Im Gegensatz dazu zeigten Kristensen et al. (2011), dass sich ein Niederschlagsanstieg im Frühjahr und Sommer in Dänemark, aufgrund der Erhöhung des Krankheitsdruckes, negativ auf den Kornertrag von Winterweizen auswirkte. Nur wenn man die gesamten Jahresniederschläge in Betracht zieht, ergaben sich bei den vorliegenden Daten deutlich engere positive Beziehungen zum Ertrag, insbesondere in den relativ trockenen Bezirken Hollabrunn, Krems und Mistelbach. In den Bezirken Baden, Horn und Wiener Neustadt waren keine Korrelationen der Ertragsdaten zur Jahresniederschlagsmenge festzustellen. Auch andere Autoren fanden keine Korrelation zwischen dem Ertrag und den Niederschlägen von der Saat bis zum Beginn der Schossphase und weiter zur Blüte (Xue et al., 2019). Bei überregionaler Betrachtung zeigte sich aber, dass eine um 10 % verringerte Jahresniederschlagsmenge in Europa den Ertrag um etwa 1–10 % senken würde (Pirttioja et al., 2015). Es ist denkbar, dass über kürzere Zeitspannen der Bodenwasserspeicher als Puffer dämpfende Wirkung auf die Effekte der kurzfristigen Niederschlagshöhen ausübt, und somit die Niederschläge über kurze Zeiträume ein schwächeres Signal liefern. Eine klimatische Wasserbilanz bzw. ein physikalisches Modell des Bodenwasserhaushaltes könnte hier bessere Informationen liefern.
Anders als geringere Niederschlagshöhen bedingten sowohl Hitzetage > 27 °C nach dem Winter als auch höhere Tagesmitteltemperaturen in der generativen Phase mit wenigen Ausnahmen zum Teil deutlich signifikante Ertragsreduktionen. Dies bestätigt Ergebnisse aus einer Modellstudie, die zeigte, dass Hitzestress mit Maximaltemperaturen von 31 °C vor allem während der Entwicklungsstadien Blüte und Kornfüllung zu signifikanten Ertragsminderungen führte, wobei eine Kumulation von mehreren Hitzetagen in Folge sowie eine Steigerung der Maximaltemperatur auf 32 °C den Effekt noch verstärkte (Schneider, 2024). Auch Ribeiro et al. (2019) berichten einen Ertragsrückgang bei zu hohen Lufttemperaturen während der Kornfüllungsphase von Winterweichweizen. Sie bestätigen geringere Einflüsse einer Dürre- und Hitzeperiode im Herbst und Winter und größere Einflüsse einer solchen im Frühjahr zur Blüte und Reife des Getreides hin. In einem Glashausversuch wurde Winterweizen Hitzestress in Form von Temperaturen von 35 °C für 5 Stunden pro Tag, in unterschiedlich langen Zeitintervallen nach der Weizenblüte, ausgesetzt. Die Behandlung ergab, im Vergleich zur Kontrollgruppe (25 °C konstant), eine Verkürzung der Kornfüllungsphase um nahezu einen Tag für jeden Tag, an dem die Temperatur auf 35 °C angehoben wurde. In der Folge war das Tausendkorngewicht signifikant geringer (Buck und Nisi, 2007). Laut Kristensen et al. (2011) sinkt der Kornertrag von Winterweizen bei einem Temperaturanstieg von durchschnittlich +1 °C während der Kornfüllungsphase um 250 kg/ha, während die Kornfüllungsphase um etwa 5 % in ihrer Dauer verkürzt wird. Auch überregional wird durch Simulationen geschätzt, dass ein Temperaturanstieg von 1 °C in Europa bei gleichbleibenden Niederschlägen die Weizenerträge um durchschnittlich etwa 5–7 % senken würde (Pirttioja et al., 2015).
Wenn auch in den vorliegenden Ertragsdaten die Häufigkeit des Pflugeinsatzes vor der Winterweizensaat mit ca. 10 % relativ gering war, so ergab sich doch in jedem Jahr und in allen Bezirken ein einheitliches Bild mit geringeren Erträgen von ca. −500 kg ha−1 im Vergleich zu den ungepflügten Schlägen. Zwar war der Einfluss des Pflugeinsatzes von den Wechselwirkungen mit Standort und Erntejahr abhängig, aber die Hauptwirkung der Bodenbearbeitung war dominierend (Abbildungen 2 und 3).
Neugschwandtner et al. (2016) bestätigten auf Basis eines Langzeit-Bodenbearbeitungsversuchs in Niederösterreich von 1998–2012 eine signifikante Wechselwirkung zwischen dem Erntejahr und der Bodenbearbeitung. Der Ertrag von Winterweizen nach Pflugeinsatz vor der Saat war in Jahren mit hohen Niederschlagsmengen signifikant höher im Vergleich zur Direktsaat, während bei geringen Niederschlagsmengen die Direktsaat dem Pflugeinsatz überlegen war. In der Konsequenz konnten bei mittleren Niederschlagsmengen häufig keine Ertragsunterschiede zwischen den einzelnen Bodenbearbeitungsvarianten festgestellt werden. Pelegrin et al. (1990) zeigten, dass in Trockenjahren die Direktsaat der Pflugsaat jedenfalls hinsichtlich der unproduktiven Wasserverdunstung (Evaporation) überlegen ist.
Reckleben (2007) berichtet an zwei deutschen Standorten von zumindest gleichwertigen Erträgen bei Anwendung einer konservierenden Bodenbearbeitung mittels Grubber, anstatt einer konventionellen Bodenbearbeitung mittels Pflug vor der Saat. Die Ergebnisse des Bezirkes Mistelbach, wonach mit Pflugsaat geringfügig höhere Erträge möglich sind, werden in der Arbeit von Pringas und Koch (2004) bestätigt. Sie geben aber zu bedenken, dass der Anbau von Winterweizen mit Verfahren der konservierenden Bodenbearbeitung, im Vergleich zum Pflug, als rentabler einzustufen ist. Das zeigen auch langjährige Untersuchungen in Niederösterreich (Rosner, 2021). Xue et al. (2019) fanden sogar einen um 31 % höheren Kornertrag von Winterweizen bei Pflugeinsatz im Vergleich zu no-tillage in einem mehrjährigen Versuch auf einem Löss-Plateau in China. Die Autoren machen die stark zur Verdichtung neigenden Lössböden dafür verantwortlich, dass der Ertrag bei abnehmender Bodenbearbeitungsintensität sank. Dies könnte auch eine Erklärung für die geringfügige Ertragssteigerung beim Pflugeinsatz vor der Saat im Bezirk Mistelbach sein, da Lössböden in diesem Gebiet sehr häufig anzutreffen sind. Allerdings sind Lössböden nicht generell verdichtungsanfällig, sondern vor allem bei hohem Tonanteil.
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass in typischen Ackerbaubezirken Niederösterreichs und den Jahren 2006–2019 die Niederschläge im Herbst einen leicht positiven Einfluss auf die Erträge von Winterweizen hatten, vermutlich auch wegen der Förderung des Feldaufganges. Hingegen zeigten die Niederschläge über Winter keinen Einfluss auf die Ertragsbildung. Auch die Frühjahrs- bzw. Frühsommerniederschläge beeinflussten den Kornertrag von Winterweizen in Niederösterreich nicht. Gründe dafür könntendie ohnehin ausreichenden Niederschläge und das gute Wasserspeicherungsvermögen der Böden in Niederösterreich sein. Die Niederschlagssumme über die gesamte Wachstumsperiode von Winterweizen hinweg hatte allerdings den erwarteten ertragssteigernden Effekt. Dem gegenüber waren hohe Durchschnittstemperaturen bereits ab Vegetationsbeginn im Frühjahr und besonders in der generativen Phase deutlich ertragsmindernd. Offenbar muss angesichts des Klimawandels mit zunehmenden Ertragsminderungen durch hohe Temperaturen gerechnet werden, und Hitzetoleranz sollte als Zuchtziel vermehrt berücksichtigt werden, z. B. indem Sortenkandidaten in südlicheren, heißeren Regionen geprüft werden.
Hinsichtlich des Effekts der Bodenbearbeitung waren die Daten deutlich unbalanciert zugunsten reduzierter Bearbeitungsintensitäten. Offenbar bevorzugen die Landwirte reduzierte Bearbeitungsverfahren. Die relative Vorzüglichkeit eines Verzichts auf den Pflug auf semi-ariden Standorten im Osten Österreichs bzw. unter trockenen Bedingungen werden durch die vorliegenden Ergebnisse bestätigt. Zum Einfluss der Bodenbearbeitung vor der Saat liegen jedoch zahlreiche Arbeiten vor, die teils zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was vermutlich an der großen Zahl von Wechselwirkungen (hier: Standort und Erntejahr) liegt. In zukünftigen Studien zu diesem Thema sollte deshalb versucht werden, mehr Verständnis für die zu Grunde liegenden Prozesse zu erlangen.
In der Praxis sind frühreife Weizensorten vorteilhaft, die die Kornfüllungsphase früher im Erntejahr beginnen und so dem zunehmenden Hitzestress im Frühjahr entgehen könnten. Des Weiteren sollte ein Pflugeinsatz vor der Saat des Winterweizens überdacht werden, da dieser jedenfalls keine ökonomischen Vorteile bringt.