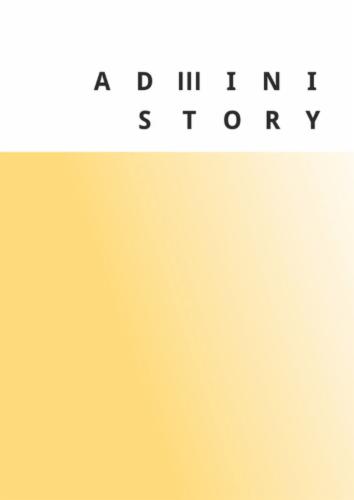Sicher auf Sand. Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren (1969/21975) – Eine Relektüre
Data publikacji: 09 lip 2025
Zakres stron: 272 - 280
DOI: https://doi.org/10.2478/adhi-2023-0018
Słowa kluczowe
© 2024 Maren Lehmann, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Die Sechziger- und Siebzigerjahre der Bundesrepublik sind sehr lange her, so lange, dass der junge, adoleszente Habitus dieser kurzen Zeit im Nebel der sich schon bald selbst als alt bezeichnenden Bundesrepublik verblasst ist. Das Selbstbewusstsein der akademischen Sphäre mit ihrer Feier des, genauer: ihres Diskurses – einem vielleicht intellektuell-avantgardistischen, vielleicht engagiert-aktivistischen, vielleicht auch bloß kumpelhaftresignativen Vertrauen in die Überlegenheit der eigenen Mittel – ist nur noch ein Abglanz seiner selbst. Es ernährt sich aus den Erzählungen, nicht den Erfolgen. Kein unwichtiger Grund für dieses Zurückweichen in die eigene Legende ist die Hingabe eben dieses Diskurses an datengestützt-
Dieser Perspektivwechsel – man könnte auch sagen: der Freiheitsgewinn, der aus dem Sich-Einlassen auf die nichtpräferierte, vielleicht sogar verschmähte, jedenfalls aber noch nicht überdeterminierte Seite einer Unterscheidung entsteht – nimmt im praktischen Vollzug das Argument des Buches vorweg, das uns hier interessiert. In der Problemdiagnose und im Interesse an einer Reformulierung des Politischen unterscheiden sich Habermas und Luhmann kaum, so sehr sie vom akademischen und publizistischen Milieu als Kontrahenten wahrgenommen, inszeniert und schließlich stilisiert worden sind.(4) Zwar dürfte Habermas in das akademische Milieu bei weitem nicht so flüssiggesellig integriert gewesen sein, wie sich vermuten lässt. Er erhebt den Diskurs dieses Milieus zum Modell einer legitimen (nämlich sich nicht nur vor den Blicken, sondern im Medium der intelligiblen Öffentlichkeit rechtfertigenden) Herrschaft, aber er verpflichtet das akademische Milieu auch darauf. Das verschafft Luhmann keinen Vorteil, der dasselbe Unternehmen von der anderen, administrativ-organisationalen Seite aus beginnt; denn auch er bleibt immer Beobachter und hält sich in Erwartung des »Schnitts um 17 Uhr« die Begleitumstände so weit wie möglich vom Hals.(5) Der eine wehrt sich normativ, der andere ironisch; so konnten sie zwar nicht zusammenkommen, aber die Frage nach der Unterscheidung, nach der Differenz, nach Komplexität und Kontingenz von beiden Seiten offenhalten.
Legitimation vollzieht sich, indem Beobachter und Beobachtete bzw. Entscheider und Betroffene die Plätze tauschen, ohne ihre Verbindung aufzugeben. Diskurse wie Verfahren sind Institutionalisierungen (oder vorsichtiger gesagt: sie sind Ermöglichungen, sie sind Provokationen) dieser verbindlichen Seitenwechsel. Hier wie da führt das Vertrauen in die eigenen Mittel in eine Souveränitätsvariante, die Legitimität als etwas aus sich heraus Gegebenes versteht, das unverlierbar, wenn auch nicht unanfechtbar ist und deshalb auf Verbindlichkeit, Akzeptanz und Rechtfertigung angewiesen ist. Hier wie da wird der Begriff der Krise nicht fatalistisch, sondern diagnostisch verstanden und in eine Pragmatik der Kritik überführt, die endlich die Möglichkeit soziologischer Gesellschaftstheorie provoziert. Bei beiden, Habermas wie Luhmann, wird sie als Gesellschaftstheorie der Politik entworfen, bei Luhmann aber auf eine dritte, moderierende, empirische Ebene »faktischen Verhaltens« gezogen: die Organisation.(6) Hier wie da muss daher zwar die Mahnung altväterlich wirken, Legitimationskrisen erst bei massenhafter Emigration eintreten zu sehen, eine Diagnose, die den bundesdeutschen 1960er- und 1970er-Jahren keinesfalls gestellt werden könne. »Da scheint mir viel Wunschdenken mit im Spiel zu sein«, notiert Wilhelm Hennis auf dem der Diskussion von Legitimationsproblemen und -krisen gewidmeten Duisburger Kongress der politikwissenschaftlichen Vereinigung 1975 süffisant,(7) was Habermas(8) gelassen ignoriert (Luhmann ist gar nicht erst angereist(9)). Habermas‘ Diskursideal sei anfällig für den spätestens seit Carl Schmitt bekannten »Sophistentrick des Gegeneinanderausspielens von Materialem und Formalem« (das »sollte schrecken«), behaupte eine Alternative von partizipativen Idealen einerseits und administrativen Techniken andererseits und romantisiere schließlich die eine und denunziere die andere Seite.(10) Es sei unterspült von jenem heimlichen Charisma des Höchstpersönlich-Gemeinschaftlichen, das auch bei Max Weber in einer Drift stehe, die das rational legitimierte bürokratische Herrschen »zweckmäßig, präzis und effizient vor den Karren auch der unsinnigsten politischen Ziele« zu spannen erlaube: »Machtästhetizismus« stünde in einem durchaus intimen Zusammenhang mit Legitimität im Sinne einer »Gehorsams-« bzw. »Fügsamkeitsmotivation«.(11) Nach Autorität (personal zurechenbarer Anerkennung) könne in diesen gleichsam kulturellen Machtsphären so wenig sinnvoll gefragt werden wie nach Finalität (Problemlösung und Aufgabenerfüllung) und nach moderierenden Strukturen und Institutionen.(12) Gerade auf diese laufende Infragestellung der Herrschaft durch sich selbst, in all diesen drei Hinsichten, käme es jedoch an, denn wenn Herrschaft legitimiert ist, ist das ein Vollzug dieser Infragestellungen. Habermas konnte das nicht auf sich sitzen lassen, ging es doch auch ihm gerade um diese diskursive Infragestellung von Herrschaft. Umso triftiger der Einwand, dass der Diskurs selbst, umso mehr dann, wenn er selbst ›herrschaftsfrei‹ zu sein prätendiert, sich dieser Infragestellung entzieht und zu einer protocharismatischen Bindung verführt. Otthein Rammstedt verschärft auf derselben Tagung den Vorwurf. Schon bei Weber(13) bezeichne die behauptete »unzerbrechliche Form der Herrschaftsbeziehungen« eine anachronistische Legitimität ohne weiteren Legitimationsbedarf, so dass Rationalität in eine quasiaristokratische Selbstsicherheit münde: Rationalität bezeichne bei Weber »ein affektiv Anti-Charismatisches«, das »damit charismatisch [bleibt]«, und eben dies verhalte sich bei Habermas ebenso, der Rationalität »einen emphatischen Zug zugesprochen« habe, »so dass man verführt ist, bei ihm von einem charismatisch-rationalen Legitimitätstypus zu sprechen«.(14)
Obwohl – aber das mündet in den folgenden Abschnitt – auch Luhmann auf diese verführerische, persuasive Funktion nun eben nicht des Diskurses, sondern der Verfahren zu sprechen kommt, wird er dessen selbst von keiner Seite verdächtigt. Auch wenn es nichts als das Klischee des administrativen Habitus‘ sein sollte, das ihn vor dem Verdacht verführerischen Redens bewahrt, weil er mit dem Klischee, sonst wäre es keines, identifiziert wird: warum, genauer: wozu sollte er dementieren? Mit welchen Aussichten sollte überhaupt irgendjemand versuchen, polemische Bonmots wie jene zu entkräften, man lege einen ›verkommenen‹ »Imponierjargon« vor: lauter »feed-backs, inputs-outputs«, »Regelkreise und natürlich Systeme noch und noch«, überall »Welterfassungsformeln«, die sich »sehr ›wissenschaftlich‹, sehr ›theoretisch‹ machte[n]«?(15) Wer so auftritt, kann das Buch, um das es hier geht, nicht gelesen haben.
*
Nach einer Reihe verstreuter Aufsätze zum Problem des Zusammenhangs von funktionaler Differenzierung und formaler Organisation sowie zum Problem des Zusammenhangs der Ausdifferenzierung von Politik und Recht, begleitet von einer Reihe von Vorträgen zu (und vor) Verwaltungen (allesamt gekennzeichnet von höflicher Konzilianz und zugleich ironischer Schärfe),(16) legt Luhmann 1969 das Buch vor, das hier neu vorzustellen ist.(17) Neu vorgestellt hat er es auch selbst, als er wenige Jahre später ein ergänzendes Vorwort zur zweiten Auflage verfasst und dem Band ein Register beigefügt hat. Das Buch ist, genau wie dasjenige Habermas‘, vermutlich seines Titels wegen unendlich oft zitiert, aber nur selten rezipiert worden; ein Schicksal beider Autoren. Sehr klar und auf diese Weise sogleich zur Kurzerhandübernahme motivierend hat André Kieserling den Text und über den Text referiert;(18) wir können uns gerade deshalb den skeptischen Umweg über selektive Lektüre leisten und auch einen langen, verzögernden Aufenthalt bei den Anfangsabschnitten rechtfertigen.
Ich greife mit einem Hinweis vor: Nicht die Interaktionsnähe oder jedenfalls die Interaktionsverwiesenheit der Verfahren dürfte die entscheidende Pointe von Luhmanns Argumentation hier sein – also nicht Mündlichkeit als symbiotische Rückbindung, wie sie auch Vismann(19) betont, und keinerlei »people-processing«, wie es Goffman(20) beschreibt. Sondern die Umdisposition der Zeitlichkeit des Legitimationsproblems: Nicht die Schließung ihrer Vergangenheit, sondern die Öffnung ihrer Zukunft legitimiert eine Entscheidung. Hält man sich vor Augen, dass Luhmann (wie noch Parsons und wie bis heute weite Teile der Sozialwissenschaften in der Nachfolge von Comte) Struktur und Prozess
Wie viele der eher vorsichtigen, tastenden, Problematisierungen, Begriffe und Argumentationen eher improvisierenden als vor Augen stellenden frühen Texte Luhmanns ist auch der vorliegende nicht durchchoreografiert. Es handelt sich ersichtlich um keine Qualifikationsarbeit (diese lag mit »Funktionen und Folgen formaler Organisation« vielmehr bereits vor, und sie war bis ins Detail sorgfältig konzipiert) und auch um kein werbendes, irgendwie auf Anerkennung spekulierendes Stück. Auch die Konzilianz der Vorträge geht dem Text ab; kein Wunder also, dass Hennis – wohl auch: weil er es sich leisten kann – brüskiert reagiert. Politische Legitimation müsste traditionellem Verständnis nach um solches Verstehen werben, um Akzeptanz und Anerkennung zu bewirken; Luhmann probiert stattdessen Überlegungen aus und tut das ohne jedes Zögern auf der erforderlichen Abstraktionshöhe. Entsprechend knapp ist das erste Vorwort, das »ein vorläufiges« Ziel benennt.(23) Es gehe darum, »Verfahren … als ein soziales System besonderer Art, also(24) als Sinnverbundenheit faktischen Handelns« zu konzipieren und entsprechend »Legitimation als Übernahme bindender Entscheidungen in die eigene Entscheidungsstruktur« zu begreifen.(25) Mithin soll gezeigt werden, dass Bindung eine Sinnform ist, über die entschieden werden kann – die Sinnform der Freiheit,(26) weil sie »der Gegenwart« ermögliche, sich im Medium dieser Sinnform »selbst aufs Änderbare festzulegen und jede mögliche Zukunft auszuhalten«.(27) Die offene, ungewisse Zukunft wird durch Entscheidung bzw. im Verfahren in die Gegenwart hineingeholt und reichert (»verstrickt«)(28) diese Gegenwart mit möglichen Zukünften im Sinne möglicher anderer Gegenwarten an. Was sich ergibt, ist eine nicht einfach nur vorübergehend kontingente, sondern auf Kontingenz ›festgelegte‹
Das neue Vorwort stellt Missverständnisse fest, die neben »allzu suggestiven Formulierungen«(29) vor allem mit der Abstraktionslage zu tun haben könnten, mit dem spezifisch-selektiven, nichttraditionalen, insofern: respektlosen (unterstellt also: illegitimen) Zugriff und mit dem operationalisierten Entscheidungsverständnis, das den Gegenstand bzw. den ›Inhalt‹ der Entscheidungen unberücksichtigt lässt. »Diesem Einwand kann durch Hinweis auf die Konzentrationslager Nachdruck und Plausibilität verliehen werden«, ergänzt Luhmann,(30) was belegt, dass er Hennis‘ Tagungsbeitrag zur Kenntnis genommen hat. Hennis hatte nicht nur die erwähnte Reserve gegen Schmitt vorgebracht, sondern »nach allem, was geschehen war« – »Max Weber konnte sich nicht vorstellen, was dieses Jahrhundert an Rassen- und Klassenmorden, exekutiert durch rationale Anstalten, bereithielt« – auch Abstandnahme von der Romantisierung und der Selbstnobilisierung des Rationalen gefordert.(31) Aber das war eher gegen Habermas‘ Vernunftdiskurs als gegen Luhmanns Verfahren gerichtet, so dass Luhmann den Vorwurf ernst nimmt, indem er ihn auf sich zieht. Mit einem kurzen Hinweis darauf, dass eine Begriffsarbeit nicht schon dann getan sei, wenn zu einem Begriff eine ausschließende Negation (legitim/illegitim, rational/irrational) gebildet werde,(32) deutet Luhmann zunächst nur an, dass das Illegitime durch Ausschluss vom Begriff der Legitimität genauso wie das Irrationale durch Ausschluss vom Begriff der Rationalität nicht beseitigt, sondern womöglich sogar protegiert werden könnte. Außerdem sei, wenn solche ausschließenden Distinktionen praktischen Sinn ergeben sollen, das Ausgeschlossene generell das Wahrscheinlichere – was ersichtlich Anlass gäbe, es in die Untersuchung einzuschließen, diese Untersuchung bzw. den Begriff aber anders, nämlich als einschließende Unterscheidung anzulegen. Ersichtlich ist theoriebiografisch die Arbeit an der Kommunikationstheorie neben die Arbeit an der Organisations- und Entscheidungstheorie getreten; Luhmann führt nämlich das Konzept der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien ein.
Zunächst weist er nur darauf hin, dass mehr Kommunikation nicht zu einem Mehr an Einverständnis führen kann, sondern Negations-, Ablehnungs- und Konfliktwahrscheinlichkeiten vervielfacht. »Wenn [dies, ML] nicht im Rahmen des konventionellen Legitimitätsverständnisses« bearbeitbar ist (sondern wiederum nur, und sei es polemisch, abgelehnt werden kann), »dann eben mit Hilfe eines anderen«.(33) Der Satz ist die Kurzfassung dessen, was Legitimation durch Verfahren heißt: wenn nicht so, dann anders; wenn nicht in diesem Rahmen, dann in einem anderen, oder elaborierter: »Mein Vorschlag ist: den Begriff der Legitimität […] zu temporalisieren und die damit aufgegebene inhaltsabhängige Sicherheit durch Differenzierung und Wiederverknüpfung einer Mehrheit von Verfahren wiederzugewinnen«.(34) Was zur Annahme selektiver Vorschläge motiviert, ist demnach nicht nur die Temporalität des ›später anders‹, sondern deren Selektivität selbst; Legitimation setzt distinkte Klarheit voraus. Auch wenn das gemünzt ist auf die durch Selektivität getragene und in offener Variabilität realisierbare Vernetzung differenzierter Formen (die jegliche ›Inhaltlichkeit‹ je neu und anders konturieren kann): Luhmann akzeptiert insoweit den Vorwurf der Unverständlichkeit.
Aber er pariert ihn auch (vergeblich, meint allerdings Stefan Machura(35)). Wenn der Eindruck entstanden sei, er wolle mit seinem Buch eine Art rechtliche Prozessoptimierung für strittige Fragen bzw. »bessere Entscheidungen« vorlegen,(36) dann müsse an dieser Stelle klärend nachgearbeitet werden. Denn eben darum wäre es überhaupt nicht zu tun gewesen; was gezeigt werden sollte, sei die Differenz von Sozialsystem und Entscheidungsprozess.(37) Luhmann lehnt ersichtlich die technologische Sicht auf Verfahren ab, und dafür macht er zunächst – vielleicht, um die Verständniswahrscheinlichkeit zu erhöhen für das, was die Konvention für Soziales zu halten bereit ist – den Interaktionsbegriff stark. Er führt die vergleichsweise einfache Ebenenunterscheidung von Interaktion und Organisation, die er sehr viel früher entwickelt hat,(38) wieder in den Verfahrensbegriff ein. Das hat Kosten, weil mit dieser Ebenenunterscheidung eine personalisierende Simplifikation des Problems reanimiert wird, die das Buch gar nicht vorgenommen hatte; aber es hat auch einen Nutzen, weil es sich (Luhmann lässt sogleich die Luft aus den Hoffnungen auf Höchstpersönliches) gut an die Verfahrensfunktion der Konfliktmoderation anknüpfen lässt, »der Konfliktdämpfung, der Schwächung und Zermürbung der Beteiligten, der Umformung und Neutralisierung ihrer Motive im Laufe einer Geschichte« usw. und in der Konsequenz dem Verzicht »auf andere, sehr viel drastischere Mittel der Konfliktrepression«.(39) Und mit diesem andeutenden Hinweis auf Gewalt, die zu vermeiden nicht nur politisch normativ geboten sei, sondern auch praktisch ermöglicht werden müsse, führt Luhmann das erwähnte Konzept symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien ein.(40) Diese Medien motivieren zur Annahme von selektiven Vorschlägen und Zumutungen nicht durch Richtigkeit und Plausibilität, sondern durch Selektivität als solche; sie erlauben höhere Abstraktionslagen und höhere Komplexität, weil Verstehen über symbolische Codes und nicht über misslingens- und dissenswahrscheinliche Erklärungen geführt wird, und sie entlasten von den ›Zermürbungen‹ durch Interaktion. Zu diesen »institutionellen Stützen«, »die Überzeugungsdefizite überbrücken«,(41) gehören neben Macht, Recht, Geld, Wahrheit, Liebe auch: Verfahren.
Aber deckt die Äquivalenz von Verfahren und symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien hinsichtlich der Motivationsfunktion auch das Legitimationsproblem? Anders gefragt: Genügt es, das Legitimationsproblem zwar nicht auf Interaktionsfragen unter Anwesenden herunterzubrechen, es aber dennoch an individuelle Zurechnungsprobleme und Akzeptanzbereitschaften zu knüpfen? An die Moderation womöglich widerstreitender individueller Eigeninteressen und Gefolgschaftsbereitschaften in einem mehr oder minder philiströsen interaktiven
Für die Diskussion des vorliegenden Buches aber dürfen Luhmanns im nachgeschobenen Vorwort vorgeschlagene Interventionen nicht wichtiger genommen werden als das Buch selbst. Sowohl die Ebenendifferenz Interaktion/Organisation als auch die Funktionsäquivalenz symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien/Verfahren geben, wenn sie sich vor das Legitimationsproblem schieben und dieses Problem individualistisch verschatten, das entscheidende Argument auf. Das besteht darin, Legitimation als Funktion selbstreferentieller Entscheidungsstrukturen zu verstehen, die sich selbst durch sich selbst Zukunftsoffenheit ermöglichen und diese Offenheit auch zur Akzeptanzbeschaffung nutzen. Dieses Argument ist so wichtig, weil es sehr klar vor Augen führt, dass Legitimation sich nicht zur Rechtfertigung von Entscheidungsstrukturen eignet, sondern zu deren Verständnis – und damit zu deren (auch: scharfer) Kritik. So konziliant auch immer jedenfalls Luhmann mit dem Zweitvorwort auf seine Rezensenten eingeht: An der Textgestalt ändert er nichts. Dadurch behält der Band seine unerschrocken-kritische Façon, er behält auch seine unbeirrte Pragmatik, und er behält auch seine konzeptionelle theoretische Stringenz. Weder in die ›reine‹ Rechtslehre noch in die forcierte politische Programmatik lässt er sich drängen; und auch wenn er in allen Detailstudien des Textes auf Traditionsbestände zurückgreift, so ist doch die grundlegende Intervention in diese Traditionen immer präzise sichtbar: Je komplexer, differenzierter, polykontexturaler und damit konfliktgeladener eine Gesellschaft ist, desto wichtiger wird es, dass sie sich von einfachen personalisierenden Selbstbeschreibungen und Problematisierungen löst und auf formalisierte, mithin selektive, abstrahierende, generalisierende Entscheidungen umstellt. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dem modernen Ausmaß an Komplexität anders zu begegnen als durch den Einbau von Änderbarkeit in jedes Element. Luhmann dekliniert diese Überlegung dreimal: (1) für Gerichtsverfahren, die noch am deutlichsten auf interaktiv inszenierte Verhaltenserwartungen zielen, Rollendramaturgien entwerfen und öffentliche Darstellungen von formaler Korrektheit, sachlicher Faktizität und moralischer Wahrhaftigkeit zu einem Legitimationssyndrom zusammenzuziehen vermögen, das immerhin noch prätendieren kann, mit personalisierten Rollenzuschreibungen und den entsprechenden Moralisierungen des individuellen Gewissens in irgendeine Deckung gebracht werden zu können – und die doch, je stärker sie dieser Prätention normativ folgen, Moralisierungen an die Stelle von Legitimationen setzen; (2) für Gesetzgebungsverfahren, in denen es unter der Bedingung der Ausdifferenzierung von Rechtssystem und Politiksystem und den entsprechenden Komplexitätsasymmetrien, in denen das eine System sich in der Umwelt des je anderen beobachten muss, auf Akzeptanzbereitschaften für Eigenrationalitäten ankommt, die sich für das Politiksystem als Legitimation auszahlen, aber dies auch nur dann, wenn als Nebenfolge von Unsicherheitsabsorption auch Verlässlichkeitsdiffusion toleriert, keine ins Kleinste und Letzte gehende Rechtfertigung gefordert und aus der Unmöglichkeit der Erfüllung dieser Forderung nicht sogleich auf Korrumpierung geschlossen wird; und schließlich (3) für politische Wahlen, deren programmatisch orientierte Konkurrenz durch Regierungsbildung und Parlamentsarbeit unterbrochen und befriedet werden muss, sodass keine gesetzgeberischen Imperative aus den Wahlprogrammen abgeleitet werden oder Legitimation von dergleichen abhängig gemacht werden kann, was nicht zuletzt heißt, die den Regierungen zugeordneten Verwaltungen nicht indifferent freizustellen, sie aber doch allenfalls lose an die Wahlergebnisse zu binden und im besten Falle dadurch zu erreichen, mit Wahlen die gesuchten Änderbarkeitsimpulse zu setzen und ihnen Realisierungschancen einzuräumen. In allen diesen Hinsichten zeigt sich, dass Luhmann unter dem Problemtitel des Verfahrens an einer politischen Soziologie der Demokratie arbeitet,(44) die eine scharfe Präzision des Begriffs formalisierter Entscheidungsnetzwerke (das heißt: Organisation) an die Stelle des klassischen soziologischen Misstrauens gegen Verwaltung, Bürokratie und eben auch Recht setzt. Denn dieses Misstrauen macht sich – naiv, wie man annehmen, und geschichtsblind, wie man befürchten muss – mit demokratiezerstörenden Postulaten einer Unmittelbarkeit von Menschen und Mächten gemein, die noch jede ideologische Absurdität als grundvernünftigen Diskurs auszugeben willens sind.
*
Luhmann fasst die Abhandlungen des Buches schließlich zusammen mit dem Hinweis, dass die Transformation der traditionalen stabilen Gesellschaft zu einer komplexen Gesellschaft, die ihre »Bestandsfestigkeit […] der Heterogenität und dem Fluktuieren individueller Meinungen verdankt«, darauf angewiesen ist, »diejenigen Strukturen und Prozesse zu erkennen, die Variabilität in Stabilität transformieren« können und die Konvention aufzugeben, dass »auf Flugsand nicht sicher gebaut werden könne«.(45) Die Literatur, die die dann möglichen Architekturen diskutiert, ist weitgehend abseits der Soziologie entstanden. Luhmanns hier vorgestellter Entwurf ist ein »Nicht-Klassiker« geblieben,(46) und dies nicht deshalb, weil seine Problemstellung überholt wäre – das Gegenteil ist richtig, wie jeder Blick in die verzweifelte Lage der gegenwärtigen Demokratien zeigt –, sondern weil seine Konzeptualisierung nicht annehmbar zu sein scheint. Aversionen, um das Freundlichste zu sagen, gegen Formalisierungen, Verrechtlichungen, Regulierungen und (aber der Ausdruck ist so generell populistisch verschliffen, dass er gar nichts mehr besagt) Bürokratien einen die politischen Lager aller Couleur; ›Verwaltung‹ ist ein Pejorativ, das in seiner lächerlichen Frontstellung gegen ›Gestaltung‹ nicht einmal mehr begründet werden muss (übrigens zeigt das auch, wie vergessen Luhmanns Hinweis ist, an die Stelle der Alternativfiktion von Verwalten und Gestalten das tatsächliche Verhalten zu setzen); und ›Netzwerke‹ werden als anarchische Spektakel realisiert, die die Schriftsätze und Contenanceerwartungen formaler Organisationen als bornierte Spätgeborene protestantischer Leistungszwänge erscheinen lassen. Aber Demokratie und Organisation sind Komplementärformen, die einander nicht nur ergänzen, sondern ermöglichen. Das ist die These, ja: die Mahnung dieses so dramatisch aktuellen wie leider völlig vergessenen Buches.
Jürgen Habermas: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt am Main 1973.
Mit einem viel später (vgl. nur Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1997, passim) üblich werdenden Ausdruck: er
Ich spiele selbstverständlich an auf die »über den Wolken«-Bemerkung aus Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 41993 [1984], S. 13, und auf Jean Paul.
Zur Nähe der Problematisierung, wenn auch nicht der Argumentation vgl. nur Niklas Luhmann: Die Politik der Gesellschaft, hg. von André Kieserling, Frankfurt am Main 2000, Kap. 3, hier insbes. S. 121ff. zur Sinnverschiebung der politischen »Kontingenzformel« von Gemeinwohl zu Legitimität und zu deren politischer – nicht: rechtlicher! – Bestimmung durch Werte.
Niklas Luhmann: Es gibt keine Biografie. Radiogespräch mit Wolfgang Hagen [1997], in: Wolfgang Hagen (Hg.): Warum haben Sie keinen Fernseher, Herr Luhmann? Letzte Gespräche mit Niklas Luhmann, Berlin: 2004, S. 13–47, hier S. 31; dazu Maren Lehmann: Philiströse Differenz: Die Form des Individuums, in: Remigius Bunia/Till Dembeck/Georg Stanitzek (Hg.): Philister. Problemgeschichte einer Sozialfigur der neueren deutschen Literatur, Berlin 2011, S. 101–120.
Niklas Luhmann: Funktionen und Folgen formaler Organisation. Mit einem Epilog 1994. Berlin 1995 [1964], S. 18.
Wilhelm Hennis: Legitimität – Zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, in: Peter Graf Kielmansegg (Hg.): Legitimationsprobleme politischer Systeme. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 7, Opladen 1976, S. 9–38, hier S. 9.
Jürgen Habermas: Legitimationsprobleme im modernen Staat, in: Peter Graf Kielmansegg (Hg.): Legitimationsprobleme politischer Systeme. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 7, Opladen 1976, S. 39–61. hier S. 39.
Ich danke Johannes F. K. Schmidt für eine Auskunft in dieser Frage. Als Referenzen der ganzen Tagung nennt Hennis, Legitimität, S. 29, Anm. 1 neben Habermas und Offe jedenfalls auch Luhmann. Den Referenten muss die 1969er Erstausgabe von
Hennis: Legitimität, S. 18.
Hennis: Legitimität, S. 15f.
Hennis: Legitimität, S. 24.
Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, hg. von Johannes Winckelmann, Studienausgabe, Tübingen 51980 [1921], S. 727.
Otthein Rammstedt: Zum Legitimitätsverlust von Legitimität, in: Peter Graf Kielmansegg (Hg.): Legitimationsprobleme politischer Systeme. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 7, Opladen 1976, S. 108–122. hier S. 114 und 116.
Hennis: Legitimität, S. 10. Unübersehbar entgeht Hennis in seinem Schwung, dass solche Polemik eine Zustimmung heischt, die ihrerseits weder von Denunziationen des Außenstehenden noch von – überdies keineswegs zwanglosen – Gemeinschaftsromantisierungen der Insider Abstand zu halten vermag und deshalb unterstellt, jener Außenstehende sei es, der sich zu legitimieren habe.
Veronika Tacke und Ernst Lukas haben diese »Schriften zur Organisation« in mittlerweile 5 Bänden versammelt und endlich gut auffindbar zugänglich gemacht. Ich führe sie im Folgenden nicht eigens auf.
Niklas Luhmann: Legitimation durch Verfahren, Frankfurt am Main 31993 [1969]. Die 2., um ein Vorwort erweiterte Auflage erschien 1975. Zitiert wird im Folgenden nach der Suhrkamp-Ausgabe, die zuerst 1983 und in 3. Auflage 1993 erschienen ist.
André Kieserling: Legitimation durch Verfahren (1969), in: Oliver Jahraus/Armin Nassehi (Hg.): Luhmann-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart/Weimar 2012, S. 145–150, vgl. André Kieserling: Simmels Formen in Luhmanns Verfahren, in: Barbara Stollberg-Rilinger/André Krischer (Hg.): Herstellung und Darstellung von Entscheidungen. Verfahren, Verwalten und Verhandeln in der Vormoderne. Berlin 2010, S. 109–125.,
Cornelia Vismann: Akten: Medientechnik und Recht, Frankfurt am Main 22001 [2000].
Erving Goffman: The Interaction Order: American Sociological Association, 1982 Presidential Address, in: American Sociological Review 48/1 (1983), S. 1–17.
Vgl. Niklas Luhmann: Partizipation und Legitimation: Die Ideen und die Erfahrungen [1985], in: Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, Opladen 21994 [1984], S. 152–160.
Vgl. Erving Goffman: On Cooling the Mark Out: Some Aspects of Adaptation to Failure, in: Psychiatry 15/4 (1952), S. 451–463.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. viii.
Allein an dieses ›also› müssten ausführliche Erörterungen anschließen, was hier unterbleiben kann, weil an seiner Statt auch ein schlichtes »und zwar« stehen könnte.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. viif.
So auch Kieserling: Legitimation durch Verfahren (1969), S. 146.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. vii.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. viii.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 6.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 1.
Hennis: Legitimität, S. 10 und 17.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 2.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 2.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 2.
Stefan Machura: Niklas Luhmanns »Legitimation durch Verfahren« im Spiegel der Kritik, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie 14/1 (1993), S. 97–114.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 3., vgl. 6f.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 3.
Niklas Luhmann: Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen, in: Jakobus Wössner (Hg.): Religion im Umbruch, Stuttgart 1972, S. 245–285.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 4.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 4f., vgl. Niklas Luhmann: Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien [1974], in: Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung 2: Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, Opladen 41991, S. 170–192.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 5.
Niklas Luhmann: Die Politik der Gesellschaft, hg. von André Kieserling, Frankfurt am Main 2000, S. 124.
Vgl. Luhmann: Politik der Gesellschaft, S. 121ff., expl. 85.
Vgl. Niklas Luhmann: Komplexität und Demokratie, in: Niklas Luhmann: Politische Planung. Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung, Opladen 1971, S. 35–45 und zuletzt sehr klar in Luhmann: Politik der Gesellschaft, S. 357ff.
Luhmann: Legitimation durch Verfahren, S. 252.
Justus Heck/Adrian Itschert/Luca Tratschin: Legitimation durch Verfahren. Zum Entstehungskontext und zur Aktualität eines Nicht-Klassikers, in: Soziale Systeme 22/1-2 (2017), S. 1–20.