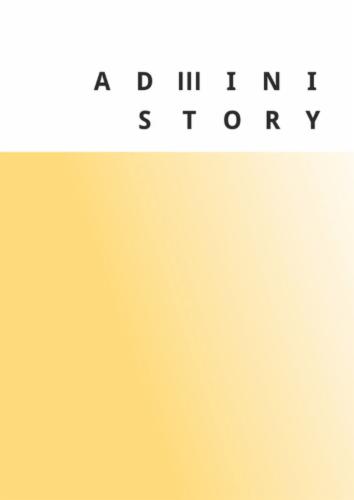Das Büro und seine Kreativabteilung Eine Führung durch die Räume der Fernsehserie »Mad Men«
Data publikacji: 09 lip 2025
Zakres stron: 256 - 271
DOI: https://doi.org/10.2478/adhi-2023-0016
Słowa kluczowe
© 2022 Kira Kaufmann, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Der Fernsehserie »Mad Men« (2007–2015)(1) ist es gelungen, das Büro als Schauplatz und Handlungsort auf ganz andere Weise greifbar zu machen als bisherige, ebenso erfolgreiche Serien wie »The Office« (2005–2013) oder »Ally McBeal« (1997–2002). Neu ist vor allem die Genauigkeit, mit welcher vonseiten des Produktionsteams um den Erfinder der Serie, Matthew Weiner, recherchiert wurde, wodurch die Darstellung des Büroalltags der 1960er Jahre ebenso plastisch wie mediengeschichtlich akkurat zur Geltung kommt.(2) Zudem wird das Büro in »Mad Men« überzeugend als spannungsreiche Schnittstelle zwischen Innen- und Außenräumen der Handlung und ihrer Protagonist*innen inszeniert. Die daraus hervorgehende, diskursive Schnittmenge an zeitgeschichtlichen Themen wird narrativ elegant und unterhaltsam aufbereitet. Die Serie erzählt vom ebenso genialen wie mysteriösen Protagonisten Don Draper (gespielt von Jon Hamm), der in der Werbeagentur »Sterling Cooper« als Chef der Kreativabteilung auftritt und von seinem Büro das Panorama der Stadt New York überblickt. Es ist Glas, das ihn hält und vor dem Fall bewahren soll, welcher allerdings im animierten Vorspann der Serie permanent vorab vorgeführt wird.
Das New Yorker »Lever House« bildete das reale Vorbild für das Bürohochhaus in »Mad Men«.(3) Open Space und Glaswände spiegeln dementsprechend auch in der zunächst fiktiven Werbeagentur der Serie den Zeitgeist und die Aufbruchstimmung der 60er-Jahre. Bei aller Durchlässigkeit treten dabei allerdings die räumlichen Insignien der wechselnden Machtkonstellationen deutlich hervor. Im Lauf der Serienhandlung wechselt das Werbeunternehmen mehrmals seine personelle Zusammensetzung und mit der veränderten Corporate Identity auch seinen Namen: angefangen bei »Sterling Cooper«, über »Sterling Cooper Draper Price«, zu »Sterling Cooper and Partners« bis hin zur Auflösung der Firmenstruktur und der Inkorporation ihrer führenden Köpfe unter »McCann’s«. Der Name an der Tür oder im Foyer ist ein raumgreifendes Zeichen der Macht – wie auch das ›eigene‹ Büro für Mitarbeiter*innen einen Aufstieg bedeutet. Die firmenpolitischen Veränderungen, die sowohl von vollzogenen als auch verhinderten Eskalationen in den Biografien der Protagonist*innen hervorgerufen werden und damit handlungsbestimmend sind, gehen ebenso mit räumlichen Veränderungen einher. So erleben die Zuseher*innen durch die insgesamt sieben Staffeln, deren Handlung durch eine Dekade amerikanischer Zeit- und Kulturgeschichte führt, unterschiedliche Büroräumlichkeiten – und damit verbunden unterschiedliche Formen von Büroalltag, Kleidung, Interieur, Organisation und Praktiken. Genau strukturiert und hierarchisch gegliedert, bildet das Büro den eigentlichen Ort der Serienhandlung, dessen Abläufe die einzelnen Figuren je nach ihren Voraussetzungen bestehen wollen oder durchbrechen müssen, um ihr individuelles Potenzial zu verwirklichen.
In »Mad Men« fungiert das Büro als Schauplatz und Bühne; es ist weder Hintergrund noch Vordergrund, sondern die unabdingbare Basis für die narrative Verhandlung der inszenierten Konflikte an der Grenze persönlicher Innenräume und beruflich-professioneller Außenräume. Die besondere Komplexität des Büros als Ort liegt im Zusammenwirken unterschiedlicher Parameter, die von einer »architektonischen Hülle«, über Fragen des Interieurs und der Möblierung bis hin zu koordinierten Handlungsabläufen reichen, wodurch wiederum Denkweisen geprägt und vor allem Vorgänge rationalisiert werden sollen.(4) Als Ort vorrangig administrativer Arbeit unter der Prämisse des »Scientific Management« zeichnet sich das Büro der Werbeagentur aber insbesondere durch die Kreativabteilung aus. Dieses »Creative Departement« steht für das kalkuliert Irrationale im durchrationalisieren Arbeitsalltag, was sich wiederum auch im Titel der Serie ablesen lässt. Der Titel ruft gleich mehrere Wortspiele auf: Die ›Mad Men‹ der Madison Avenue, für die sie abbreviiert und metonymisch einstehen, produzieren Ideen für Werbeslogans – das ist ihr Job. Ideen lassen sich allerdings nicht ohne weiteres produzieren. Ideen
Das Büro, seine räumliche Strukturierung und Einrichtung, lädt uns ein, auf das Beziehungsgefüge der erzählten Geschichten zu blicken, in das die zahlreichen Figuren der Serie eingebunden sind, aus dem sie sich herauslösen, zu dem sie sich aber auch immer wieder aufs Neue in Position bringen müssen. Gerade dort, wo persönliche Freiheit, Selbstverwirklichung und Emanzipation für das Büro als Raum strukturell bedeutsam und für uns Zuseher*innen ablesbar werden, zeigen sich etwa für die weiblichen Figuren andere Grenzen als für die männlichen. Nicht nur muss sich die erste weibliche Werbetexterin der Agentur, Peggy Olson (gespielt von Elisabeth Moss), ihr eigenes Büro
Der wichtigste Raum allerdings, in dem sich die ›Mad Men‹ bewegen, ist jener der Ware und ihrer Versprechungen. Dieser bildet den Umschlagplatz der Ideen auf der Suche nach dem »Image«. Der imaginäre Raum der Warenwelt, der durch die Werbung »Slogan« – also raumgreifender Text – werden soll, ist wiederum durchdrungen von den Träumen, Krisen und Hoffnungen der »Creative Executives«, der Werbetexter*innen. Büroräumlichkeiten und die Erlebnisse der Büroangestellten sind im kreativen Schaffensprozess unabdingbar aufeinander verwiesen. Waren sind nach Karl Marx Dinge, die menschliche Bedürfnisse befriedigen, ob diese nun »dem Magen oder der Phantasie entspringen«.(5) Die ›Mad Men‹ der Werbebranche operieren an den gefährlichen Schnittstellen von Waren, Bildern und Begehren: Nicht die Ware, sondern ihr besonderes Image, also nicht das Ding, sondern die Wünsche, Sehnsüchte und Vorstellungen,
Der abgebildete Grundriss (Abb. 1) verzeichnet die Räume des Büros und benennt einzelne Einrichtungsgegenstände.Die Kennzeichnung der jeweiligen Nutzung eines Raumes erfolgt im Grundriss mittels Beschriftung. Der Plan zeigt die Struktur der Räume und grenzt Nutzungsbereiche gegeneinander ab, wodurch einzelnen Personen eigene Wirkungsräume zugeordnet werden. Insofern hat in einem Büro alles seinen Platz, seinen fixen Ort. Es ist ein Raum mit Räumen, wobei die Distinktionsmerkmale des einzelnen Raumes eine spezifische soziale Dynamik hervorbringen, sei das die jeweilige Ausstattung (das Sofa oder die Hausbar, die zur Zerstreuung einladen) oder die Maschine, die zum Einsatz kommt (der Typewriter; der Kopierer, der so groß ist, dass er einen ›eigenen‹ Raum braucht). Der Plan zeigt zudem überdeutlich, welche hierarchischen Verhältnisse mit der durch Richard Couvé entwickelten Unterscheidung zwischen »Arbeitsplatz« und »Arbeitsraum« einhergehen.(7) Eine Schlüsselrolle spielt hierbei der Name an der Tür. Dieser markiert das eigene Büro als Arbeitsplatz und Arbeitsraum gleichermaßen. Faktoren wie Durchlüftung, Beleuchtung und Design gehen mit Strukturierung der unmittelbaren Utensilien einher und sind vom jeweiligen Büroinhaber individuell zu gestalten. Das Bürozimmer wird zum individuellen Spiegelbild seines Besitzers. Dieses eigene Büro ist für Don Draper als Chef der Kreativen zu Beginn gegeben (1.1). Bereits der Verlauf der ersten Episode zeigt aber, dass auch seine Position nicht endgültig gesichert ist, denn das Büro ist als Agentur zugleich ein hochgradig kompetitiver Raum. Vom übergeordneten Gesetz des freien Wettbewerbs ist auch Don Drapers Status nicht ausgenommen, im Gegenteil, er muss seine Position im Betrieb immer wieder aufs Neue behaupten. Aufstieg ist möglich, Abstieg aber ebenso. Draper kann diese Spannung in der ersten Episode durch seinen genialen wie spontanen Lucky Strike-Pitch (1.1, Min. 27:00–32:21) positiv für sich entscheiden, die Gefahr des Abstiegs bleibt aber präsent und gewinnt durch jeden Schritt, der in der Firmenhierarchie aufwärtsführt, an Bedrohung. Im Vergleich zu Draper ist der Name an der Tür für Peggy Olson etwas, das sie aktiv einfordern muss. Die Beschriftung im Grundriss – »Peggy’s Desk« und »Don’s Office« – zeigt über die Differenz von »Arbeitsplatz« (eigener Tisch) und »Arbeitsraum« (eigener Raum) die ungleiche Ausgangslage, woraus sich einer der emanzipatorisch-feministischen Erzählstränge der Serienhandlung ableitet. Don muss seinen Raum behaupten und verteidigen, Peggy allerdings muss vom Tisch aus erst zu Raum gelangen.

Grundriss des »Creative Department« der Werbeagentur »Sterling Cooper«. Ramson Center, University of Texas, HRC, container osb 2. (7.12.2022)
Als Zuseher*in wird man mit dem Grundriss des Büros schrittweise vertraut gemacht. Im Rahmen einer Führung (mit durchaus romantischen Ambitionen) erklärt Werbetexter Paul Kinsey der neuen Sekretärin Peggy Olson bereits in der zweiten Folge der ersten Staffel (1.2) die verschiedenen Abteilungen, Abläufe und Aufgaben (Min. 25:26–28:00). Ebenso wie das »Art Department« einen Stock tiefer, sei auch das »Creative Department« deutlich vom Lift entfernt, »so we can’t sneek out« (Min. 27:16). Es sei dies der Raum, wo die kontrollierten Abläufe das Unkontrollierte erlauben und auch erwarten, denn hier sollen die Ideen
Im Wechselspiel von Interieur und Identität soll nun anhand einzelner Räume in die grundlegenden Konflikte der Serie »Mad Men« vorgedrungen werden. Im Vordergrund stehen die Werbetexter – die »Copywriter« –, die am Image der Ware arbeiten, um sie in den Kreislauf von Angebot und Nachfrage zu bringen. Der gelungene Slogan animiert zum Kauf, und damit wissen die Copywriter um die Macht der Träume, Wünsche und Sehnsüchte, die durch die Werbung angesprochen und aktiviert werden. Somit sollen die entfalteten Konflikte um die beiden Schlagworte
Don Drapers Büro ist ein spezieller Ort, versehen mit bestimmten Privilegien. Seine gelegentliche Abwesenheit wird als Unabhängigkeit in Kauf genommen, denn er ist angestellt (zeitweise ohne Vertrag), um Ideen zu produzieren. Dons besonderes Kapital ist seine Kreativität. Diese ist nun allerdings nicht orts-, sondern radikal personengebunden. Um Draper zu halten, gibt man ihm Raum. Das Büro schafft also besondere Verhältnisse, die an der Schnittstelle zwischen dem Innen- und Außenraum der klassischen Büroarbeit angelegt sind: Eben das sind die besonderen (Frei-)Räume der Kreativabteilung. Die Grenzen dieser besonderen Freiräume sind jedoch selbst für Don Draper nicht bedingungslos gegeben, sondern stehen auch für ihn zunehmend zur Verhandlung. Ein besonderer erzähltechnischer Kunstgriff der Serie besteht nun darin, dass diese außerordentliche kreative Potenzialität als ein beruflich labiles Gefüge in Erscheinung tritt, welches wiederum an ein persönliches, in der Vergangenheit liegendes Problem des Protagonisten gebunden wird. Die Frage, ob Drapers Unabhängigkeit und sein Freiraum legitim sind, wobei beide Faktoren seine herausragende Kreativität bedingen, entzündet sich am Problem seiner doppelten Identität, konzentriert sich in der Schlüsselhandlung der gesamten Serie und lässt sich zugleich anhand seiner räumlichen Situierung im Büro des Werbeunternehmens nachvollziehen.
Don Drapers Kreativität geht einher mit dem Bild eines ebenso anziehenden wie ambivalenten Antihelden, dessen Überlegenheit und Macht an die Vorstellungen des genialen Self-Made-Man geknüpft sind. Sein besonderes Talent und seine sexuelle Anziehungskraft verleihen ihm eine enigmatische Aura. Nicht zu wissen, woher diese kommt, ist Teil dieser rätselhaften Anziehungskraft. Wie er zu seinen Ideen kommt, ist Teil seines Geheimnisses, wie zugleich das Geheimnis inhärenter Bestandteil seines Charismas – und seines Charakters – ist. So handelt im Grunde die gesamte erste Staffel von der Frage, wer Don Draper eigentlich ist. Im Kontext aller sieben Staffeln betrachtet, ist die erste Staffel gleichsam die Exposition dieser fundamentalen Ausgangsfrage, die sich durch die gesamte Erzählung zieht und den permanenten Antrieb des kreativen Schöpfungsprozesses bedeutet. Wer Don Draper ist, weiß niemand so genau, auch dessen Ehefrau Betty Draper (gespielt von January Jones) nicht. Die erste Folge der ersten Staffel (1.1) reicht uns Drapers Rolle des verheirateten Familienvaters zweier Kinder als Pointe: Zunächst sieht man einen sehr erfolgreichen Werbe-Mann, der eine emanzipierte Künstlerin im Village zur Geliebten hat, der im gelungenen, »pulled out oft thin air« Lucky Strike-Pitch (1.1, Min. 27:00–32:21) seine Vorrangstellung in der Firma gegenüber dem jüngeren, ebenso ehrgeizigen wie charakterschwachen Pete Campbell (gespielt von Vincent Kartheiser) stärken kann. Abends fährt er mit der Bahn aus der Stadt in den Vorort und man sieht: Der unkonventionelle Mann hat eine konventionelle Familie.
Wenn Don Draper in seiner Königsdisziplin, dem Pitch, einem Produkt Gesicht und Geschichte verleiht, scheint er allen anderen etwas voraus zu haben. Doch was
Das Geheimnis des genialen Werbetexters Don Drapers ist eben das: das Geheimnis. Das Geheimnis, das Don mit sich trägt, betrifft ihn ganz grundlegend in seiner Identität, denn er heißt in Wahrheit Dick Whitman. Der Schlüssel seiner doppelten Identität liegt in der Vergangenheit, genauer im Koreakrieg der Jahre 1952–54.(8) Don Drapers Status ist illegitim, er ist eigentlich ein Deserteur. Im Schützengraben übernahm er die Identität seines Leutnants, als dieser von einer Explosion getötet und zur Unkenntlichkeit entstellt worden war (er wechselt die Planchetten aus, die namentliche Identifizierung gewährleisten). Dick Whitman verschweigt als Don Draper seine wahre Herkunft und Vergangenheit. So kommt es zu einem fundamentalen Geheimnis. Aber nicht nur das: Fortan trägt er seinen eigenen Tod immer mit sich.(9) Das macht ihn zu einem lebenden Toten, der um die verschwiegene Konstruiertheit dieser Welt besser weiß als alle anderen. Die Scheinwelt der Werbung wird sein Metier, denn Don ist ein Agent jener Dinge, die hinter dem Schein, der aufrechterhalten werden muss, um überhaupt zu existieren, wirken und walten. Er kann Geheimnisse – auch anderer – bewahren und er hat erkannt, dass sein eigenes Geheimnis nur ein Symptom jener Ereignisse ist, die durch den Krieg in allen Menschen eine Rolle spielen. Von dieser Position schließt er auf das Vorhandensein unausgesprochener Sehnsüchte und das insgeheime Begehren der Kunden. Er weiß um das Geheimnis des Geheimnisses, das alle in sich tragen. Dieses Wissen verleiht ihm die Aura eines rätselhaften Genies, als das er uns an der Bar »Old Fashioned« trinkend oder im »Conference Room« begegnet.
In dieser wissenden Verschwiegenheit liegt das eigentliche Kapital der Warenwelt: Es sind unsere geheimen Wünsche. Somit werden in der Fernsehserie »Mad Men« Warenwelt und narrativer Spannungsbogen im Wissen um das Geheimnis miteinander verknüpft und auf eine bisher ungekannte Weise produktiv gemacht. Als undurchschaubares Rätsel beherrscht Don Draper den Auftritt, den Moment – den Raum, in dem er sich bewegt. Von der einnehmenden Person im Raum ist es zu ihrem Körper nur noch eine Nuance, eine spannungsreiche Distanz, die Draper ebenso einzusetzen weiß. Sexualität bedeutet in dieser für Don existenziellen Verwiesenheit von Geheimnis und Begehren absolute Gegenwärtigkeit (Don zu Rachel, von der er sich zugleich erkannt, aber auch durchschaut fühlt: »this is it, it is all there is« [1.10, Min. 41:55]). Durch das Geheimnis, das es in jedem Moment aufrecht zu erhalten gilt, ergibt sich für Don eine radikale Gegenwärtigkeit. Sie ist für ihn tatsächlich »all there is«, denn das in der eigenen Vergangenheit liegende Geheimnis bedroht die Zukunft. In der Klammer zwischen Vergangenheit und Zukunft leuchtet aber auch der Pitch für den Moment. Auch dieser ist pure Gegenwart. Das Wort »Pitch« bedeutet »Ansatzpunkt«, »to pitch«, »werfen« und »schleudern«. Durch den Pitch soll eine Idee vorgestellt, ein Plan skizzieren werden. Er ist überzeugend und suggestiv, knapp und kurz, und er findet im Hier und Jetzt statt. Don Draper ist der unbestrittene Meister dieser Disziplin. Im Pitch mobilisiert Don sein Wissen um die Geheimnisse und Wünsche, er weiß sie zu kanalisieren und gibt ihnen für die Zukunft eine besondere Optik, ein Bild, mit dem man sich insofern identifizieren kann, als man darin für sich sehen kann, wer man sein
Bereits in der ersten Folge der ersten Staffel überrascht Don mit einem solchen Pitch. Es gilt, eine neue Kampagne für den langjährigen und wichtigen Kunden »Lucky Strike« zu entwickeln. Die Zigarettenbranche steckt seit der Veröffentlichung von Studien über Gesundheitsschäden in einer massiven Krise. Man darf es in der Werbung nicht mehr leugnen: Rauchen macht krank. In allerletzter Minute erkennt Don, dass »Reader’s Digest« mit der medizinischen Warnung die Werbung allerdings revolutioniert habe, da nun alle Tabakmarken vor demselben Problem stünden. Nicht mit einer Krise, sondern mit der größten Chance seit Erfindung der Frühstücksflocken sei man konfrontiert. Die Todesgefahr ist nicht mehr zu leugnen oder in Abrede zu stellen. Ganz nach dem Motto »If you don’t like what they are talking, change the conversation«,(10) richtet Don darum den Fokus auf Geschmack und damit auf Genuss, auf »taste«. Der Slogan: »Lucky Strike. It’s toasted« ist geboren (1.1, Min. 27:00–31:21). Mit diesem genialen Einfall im letzten Moment sichert sich Don seine Vorrangstellung in der Agentur. Der Episodentitel »Smoke gets in your Eyes« zitiert zudem einen berühmten zeitgenössischen Hit von »The Platters« aus dem Jahr 1959. Somit setzt die Serie bereits von der ersten Folge an ein dichtes Netz an Verweisen und Bezügen, die die verhandelten Konflikte auf unterschiedlichen Bedeutungsebenen aufgreifen und fortschreiben. Durch den Lucky-Strike-Pitch wird Thanatos (und mit ihm die Psychoanalyse(11)) als Werbestrategie zugunsten eines genussorientierten »pursuit of happiness« verworfen. Dennoch heißt es im Song von »The Platters«: »Something here inside cannot be denied.«(12) Das Rauchen bleibt eine ambivalente Angelegenheit und ein Agent des Geheimnisses. Mit dem Rauchen, das ab der ersten Folge als Leitmotiv gesetzt wird, werden Geheimnis und Begehren produktiv verschränkt. Im Rauchen liegt der Funke der Kreativität, es bedeutet das domestizierte Feuer des individualistischen Self-Made-Man. In Ayn Rands Roman »Atlas Shrugged« werden Rauchen und Denken synthetisiert. Ein Tabakverkäufer preist in einem Gespräch mit Dagny, der Hauptfigur des Romans, die kreative Kraft des Rauchens:
Auch Frauen partizipieren in »Mad Men« am freien Wettbewerb, doch gelten für sie gänzlich andere Spielregeln als für ihre männlichen Mitstreiter. Als Sekretärin erwartet man von ihnen »something between a mother and a waitress«, verbunden mit einem attraktiven Äußeren und der (unausgesprochenen) Option auf eine Affäre (so die Chefsekretärin Joan zu Peggy an ihrem ersten Arbeitstag 1.1, Min. 8:50–8:52). Slavoj Žižek entwickelt in einem Beitrag über Ayn Rands Aktualität eine von Lacan inspirierte Theorie über die Transformation von »desire« zu »drive«, die Rands Romanfiguren vollziehen müssen, um am freien Wettbewerb als selbstbewusste Akteur*innen partizipieren zu können.(15) Die Voraussetzungen für die Verwirklichung einer unhintergehbaren Meisterlichkeit, die bei Rand sowohl von Männern als auch Frauen angestrebt wird, sind allerdings unterschiedliche. Žižek beschreibt vor dem Hintergrund der Rand’schen Texte (»ideological and literary trash«(16)) ein Konzept, dass eine Art von Subjektwerdung
Don Draper bildet für Peggy Olson eine ambivalente Vater-Figur, die zunächst als ihr Mentor auftritt. Er bietet ihr Einblick in das Produzieren von Ideen. Bei einem ihrer ersten Aufträge rät er: »Peggy, just think about it deeply. Then forget it. An idea will jump right up in your face.« (1.11, Min. 10:53) Doch verbindet die beiden eine stärkere Bande als eine bloß familiäre oder freundschaftliche: Peggy und Don teilen ein Geheimnis, denn er weiß von ihrem unehelichen Kind. Der junge Kollege Pete Campbell ist der Vater des Kindes. Kurz vor Peggys Karrieredurchbruch, der sie von der Sekretärin zum ersten weiblichen »Copywriter« bei »Sterling Cooper« befördert, bringt sie heimlich ein Kind zur Welt. Durch dieses Kind, das sie einer Pflegefamilie übergeben wird, teilt sie mit Don ein Geheimnis, das für ihren künftigen Weg entscheidend, geradezu identitätsstiftend wird. Peggy weiß, dass sie als Mutter ihren Traum, Werbetexterin zu werden, aufgeben müsste. So wird die Ablehnung des Kindes zur Bedingung ihres beruflichen Erfolgs. Don hilft ihr, dieses Vorgehen geheim zu halten. Das geteilte Geheimnis bedeutet einerseits eine Paraallele zu Dons Figur, stiftet aber zugleich auch eine Nähe, die beide Figuren aneinander bindet. Diese besondere Nähe, die auf verschwiegener Mitwisserschaft, nicht auf sexueller Anziehungskraft oder väterlicher Fürsorge beruht, bildet den Grund ihres sehr spezifischen Vertrauensverhältnisses. Don ist zwar nicht der Vater des Kindes, aber als Mitwisser wird er zum Schöpfer von Peggys neuer Identität als Werbetexterin. Don wird somit dennoch zum Vater, nämlich zum ambivalenten Vater ihres beruflichen Erfolges, während ihrer Karriere immer das Geheimnis der verhinderten Mutterschaft eingeschrieben bleiben wird. Diese Verflechtung wird im Lauf der Handlung zunehmend zum Problem. Nicht so sehr, weil sich durch das Geheimnis ein Abhängigkeitsverhältnis ergibt, sondern weil sich Peggy aus Dons Übermacht befreien muss, um ihr eigenes kreatives Potenzial zu entfalten. Der Rand’sche Selbstverwirklichungsgedanke, der über die Fantasie von »desire« zu »drive« und damit zur Subjektwerdung führt, macht sich aber auch hier bemerkbar: Wer man sein möchte, folgt den Gesetzen einer Geschichte, die man sich immer wieder selbst und anderen erzählt. Don rät ihr im Krankenhaus, kurz nach der Entbindung, zu tun, was sie tun muss: »Get out of here an move forward. This never happened. It will shock you how much it never happened.« (2.5, Min. 40:40–41:22)
Peggy Olson ist die einzige Figur, die an Dons hohe Kunst des Pitches herzureichen vermag. Sie übertrumpft ihn schließlich in seiner eigenen Disziplin als sie mit ihrem Slogan für Ketchup: »Heinz. The only Ketchup« den Kunden überzeugt (6.4). Aus dem Nahverhältnis wird ein Konkurrenzverhältnis, dass darin kulminiert, dass in der siebenten und letzten Staffel – als der erste Computer, der IBM360, installiert wird – Don die »Copies« für Peggy schreiben soll. Sie ist ihm nun aufgrund der Firmenstruktur hierarchisch übergeordnet, er will sich dieser neuen Ordnung allerdings nicht fügen. Überhaupt haben sich die Verhältnisse an diesem Punkt der Geschichte sehr verändert: Die frühere Chefsekretärin Joan Holloway ist nun Juniorpartnerin. Im Gegensatz zu Peggy wird sie ihr uneheliches Kind behalten. Den beruflichen Aufstieg, der mit Anteilen an der Firma einhergeht, erkauft aber auch sie sich durch Einsatz ihres Körpers, als nämlich der Chef der Autofirma Jaguar eine Nacht mit ihr zur Bedingung macht, um als Kunde gewonnen zu werden (5.11). Als sozialer Raum bedeutet das Büro für beide Frauen, dass ihr Körper eine Art von Kapital ist, das bereits zur Verhandlung steht, noch bevor sie ihn selbst zum Einsatz bringen, um bestehende Grenzen zu verschieben und mitzubestimmen. »Peggys Desk« ist im Vergleich zu »Don’s Office« symptomatisch bezeichnend: Nicht nur beschreibt es den beschränkten Wirkungsbereich, der ihre Ausgangssituation markiert, sondern der Tisch ist auch die Tafel, auf der die Ware zum Angebot gelangt. Ein eigenes Zimmer mit Fenstern und Ausblick (vgl. »Don’s Office«) steht einem Möbel (vgl. »Peggy’s Desk«), umgeben von ebensolchen Möbeln im »Secretarial Pool«, gegenüber.
Das »Secretarial Pool« bezeichnet die vielen Tische der Sekretärinnen, die für die weitere Verarbeitung der produzierten Ideen und Abläufe verantwortlich sind. Sie bilden räumlich das dominierende Element im Strukturplan des Büros. Auch die Geräuschkulisse ist vom Tippen der Sekretärinnen durchdrungen. Das Büro prägt als Dispositiv Vorgänge und Rollen: »Schreibtische mit Aufbau und kleinen Fächern heißen wie ihre Benutzer: Sekretäre. Dagegen tragen schreibende Angestellte im tayloristischen Amerika nicht den Namen ihres Arbeitsplatzes, sondern ihres Schreibgeräts: Typewriter.«(19) Diese bilden das Herz des Großraumbüros, umrahmt von den Büros Einzelner, denen hinter verschlossenen Türen ein Rückzugsort mit Möglichkeiten zur Zerstreuung zugestanden wird. Zwar sind im Grundriss des Werbebüros »Sterling Cooper« einzelne Tische dezidiert einzelnen Büros zugeordnet, die große Zahl der zum Eingangsbereich frontal ausgerichteten Tische ist allerdings namenlos und prägt das Bild des Büros. Man sieht, wenn man »Entrance Hall« und »Reception« durschritten hat: Hier wird gearbeitet. Im Sinn des »Scientific Management« sind die Abläufe hier streng koordiniert und durchrationalisiert.(20) Es soll nicht zu Unterbrechungen – wie etwa kreativen Pausen – kommen, im Gegenteil ist die Aufbereitung des konkreten Arbeitsplatzes, also Tisches, auf Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs hin angelegt. Hier, im »Secretarial Pool« nimmt die Kommunikation ihren geordneten Lauf, hier werden die Abschriften erstellt, Briefe frankiert, Rechnungen gestellt und beglichen. Im »Secretarial Pool« bündelt sich der Schrift- und Telekommunikationsverkehr. Unter den Sekretärinnen gibt es eine hohe Frequenz an Neueinstellungen, sie sind austauschbar, wie die Möbel und Maschinen, die sie bedienen. Diese, auch personelle, Fluktuation im Prozess der Informationsverarbeitung und -vermittlung wird in der Fernsehserie »Mad Men« insbesondere über die Vorgänge im »Secretarial Pool«, konkreter über medientechnische Umbrüche, deutlich gemacht. So werden im Lauf der zehn Jahre, über die sich die Handlung erstreckt, unterschiedliche Modelle von Schreibmaschinen gezeigt, das erste Kopiergerät führt zu Verwirrung, aber auch Aufregung, und markiert den Übergang zur zweiten Staffel (2.01). Von Anfang an stellt das Fernsehen als sich etablierendes Leitmedium die Werbeagentur vor neue Herausforderungen. Fernsehen ist zudem politisch hoch relevant. Marshall McLuhan zufolge war das Fernsehen, als im Jahr 1960 Kennedy gegen Nixon gewinnt, wahlentscheidend: »Kennedy war der erste Fernseh-Präsident, weil er der erste prominente amerikanische Politiker war, der die Möglichkeiten und Wirkungsweisen des Ikonoskops begriffen hatte.«(21) In »Mad Men« beobachtet man aus der Perspektive der verlierenden Partei den Siegeszug des fernsehtechnisch versierten und charismatischen Gegenkandidaten Kennedy (1.13). Es zeigt sich: Auch der Präsident ist letztlich ein Produkt (vgl. 1.10, Min. 4:36).
Die bedeutendste medientechnische Zäsur, auf die es näher einzugehen lohnt, bildet die Installation des Rechners IBM System/360 in der siebenten und letzten Staffel (7.4 unter dem Titel »The Monolith«). Dieser wird nicht im »Secretarial Pool«, sondern in der »Creative Launch«, dem Arbeitsraum Creative Executives, installiert. Die Kreativen müssen der monolithischen Maschine weichen. Datenverarbeitung konkurriert nunmehr nicht nur räumlich mit Kreativarbeit, die Bedeutung und Verteilung menschlicher Ressourcen in Anbetracht der neuen Rechenmaschine stellt die Mitarbeiter*innen vor Herausforderungen, denen nicht alle gewachsen sind – eine Rationalisierung, die sich bis heute in der Digitalisierung fortsetzt. Die Angst des Ersetzt-Werdens wird in der Serie durch den Werbetexter Michael Ginsberg (gespielt von Ben Feldman) thematisiert, der auf die Bedrohung durch die Maschine mit einer Paranoia reagiert und sich eine Brustwarze abschneidet (7.5). Don Draper ist zu jenem Zeitpunkt, als die Anschaffung des Computers unter den Anteilseignern diskutiert wird, gerade von der Arbeit freigestellt. Die fehlgeschlagene Vergangenheitsbewältigung und der damit einhergehende Alkoholismus lassen ihn bei seiner unangefochtenen Königsdisziplin, dem Pitch, versagen (6.13, Min. 32:44). Bei der Präsentation der »Hershey’s« Schokoriegel erliegt er den Erinnerungen an seine eigene, unglückliche Kindheit (die Schokoriegel bedeuteten eine Suspension des Unglücks), er bricht in Tränen aus. Man könnte auch sagen, seine Vergangenheit holt ihn gerade im Pitch, in jenem besonderen Moment, den er bisher immer beherrschen konnte, ein. Dieser Kontrollverlust droht Dons beruflichen und persönlichen Fall einzuleiten. Die übrigen Anteilseigner stellen Don daraufhin von der Arbeit frei, um ihn so zur Kündigung zu bewegen. Insgesamt kann diese Phase in der Erzählung als retardierendes Moment gelesen werden: Kurz vor Ende der letzten Staffel wird der Held vor Hindernisse gestellt, die er überwinden muss. Für Don bedeutet diese Finalisierung nicht nur die Gefahr eines Abstiegs, sondern eines totalen Absturzes. Gerade an diesem besonderen Punkt dramaturgischer Zuspitzung kommt der Computer, der IBM360, ins Spiel. In Folge 7.3 wird die Anschaffung des Rechners – eine Investition in die Technologie der Zukunft – gegen die Kündigung von Don Draper – der für geniale Ideen und das kreative Potenzial steht – unter den Anteilseignern abgewogen und hitzig diskutiert (7.3., Min. 37:12–39:35). Eine Entlassung ist letztlich nicht möglich: Man müsste Don auszahlen (Holloway: »that’s a big hit«); entlässt man ihn, entfällt die Sperrklausel und Don würde fortan für konkurrierende Werbefirmen arbeiten. Don Draper wird unter Auflagen erlaubt zu bleiben. Vorerst bleibt der Mensch, doch es kommt die Maschine. Dons geschwächte Position unter stark eingeschränkten Kompetenzen vereitelt allerdings eine sich abzeichnende Kooperation mit dem jungen Techniker, der die Installation des IBM 360 observiert. In einem aufschlussreichen Dialog (7.4, Min. 11:55–13:58) verweist der Techniker auf die Vorstellungen, die in den Menschen durch die Maschine ausgelöst werden (»This machines can be a metaphor whatever is on people’s minds«). Letztlich bedeute die Rechenmaschine, die unendlich Rechenleistungen hervorbringen könnte, einen Affront gegen die eigene Endlichkeit des Menschen. Die Angst der Menschen vor dem Gerät sei darum eine Art »cosmic disturbance«. Die Maschine könne mehr Sterne zählen als ein Mensch während seines gesamten Lebens. Doch wer, hält Draper entgegen, würde, am Rücken liegend und Sterne betrachtend, an eine Zahl denken? – Der Einwand, der an die poetische Qualität kosmischer Konstellationen appelliert, wird im Dialog abgefangen und gleichsam abgelöst durch den fantastisch anmutenden Gedanken, auf den Mond fliegen zu können. Der Mondflug wiederum ist nun zu diesem Zeitpunkt, 1969, kein bloßer Gedanke mehr, sondern ein Ereignis, das drei Folgen später (7.7) Realität werden wird. In der Mondlandung finden technische Höchstleistung und Utopie, Rechenleistung (wie sie der Techniker hervorhebt) und die poetische Vision (wie sie Don Draper ins Spiel bringt) zueinander: Fantasie wird Realität, die Erde ist via TV-Übertragung zum ersten Mal vom Weltall aus zu sehen. Von der Perspektive des Alls betrachtet, die wiederum über den Fernsehbildschirm direkt ins Wohnzimmer vermittelt wird, erscheint die Lebenswelt Erde wieder als Punkt. Aus dem virtuellen Raum gesehen, der durch die Rechenmaschine aufgerufen wird, ist die Erde, auf der man liegen kann, die man spüren und von welcher aus man die Sterne im Himmel beobachten kann, ein analoger Sehnsuchtsort. Als Don sich am Ende der Episode mit dem IBM360 (7.4) nach einigen inneren Widerständen, und wieder nüchtern, schließlich ausgerechnet an den Typewriter setzte, um die georderten Copies zu schreiben, wird eben diese Sehnsucht nach Rückkehr medial ein weiteres Mal akzentuiert.
Auf die besondere Sensibilität der Serie für die Bedeutung medientechnologischer Bedingungen und Dispositive wurde bereits vielfach hingewiesen.(22) Eine besondere Facette bildet in diesem Zusammenhang die Mediennostalgie.(23) Diese wird als »Sonderform medialer Selbstreferenz« begriffen, die durch mediale Umbruchsphasen begleitet und mitunter auch Übergänge erleichtert bzw. »abmildert«.(24) Das Phänomen umfasst materielle und erkenntnistheoretische Widerständigkeit im Kontext zukunftsweisender Technologie, berücksichtigt aber auch Comebacks und Simulationen vermeintlich überholter Medien.(25) So sind in »Mad Men« neben den ausgestellten Apparaturen (Typewriter, Kopierer, Computer etc.) vor allem die medialen Spuren und die Art, wie diese zitierbar werden, für die Thematisierung medientechnologischer Umbrüche von Bedeutung. Insbesondere drei Folgen der ersten Staffel werden im Kontext der Mediennostalgie betrachtet:(26) 1) Der Kindergeburtstag von Dons Tochter Sally (1.3), wo es zum Einsatz der 8-mm-Handkamera kommt.(27) 2) Das Gelage bei der Künstlerin Midge (1.8), wo Don eine Polaroid-Kamera zur Hand nimmt, ein Bild schießt und erkennt, dass sie in einen anderen Mann verliebt ist. (Der Werbe-Mann Don Draper erkennt in der Fotografie, dem Abbild der Wirklichkeit, die Wirklichkeit.) Und 3) der Karussell-Pitch zum Kodak-Diaprojektor (1.13), der das Staffelfinale markiert und zugleich einen Bogen zurück, zur Familie, aber auch zur Ausgangsfrage spannt: Wer ist Don Draper?
In Dons berühmtesten Pitch zum Kodak Diaprojektor des Modells »Carousel« (1.13, Min. 33:00-36.30) kommt die inszenierte Mediennostalgie insofern zu sich, als dass Nostalgie als Verkaufsstrategie bewusst in Don Drapers Präsentation integriert wird.(28) Um das Gerät in Szene zu setzen, das sich dadurch auszeichnet, die eingelegten Dias nicht linear, sondern im Kreis anzuordnen, verwendet Don Bilder seiner eigenen Familie: seiner Ehefrau Betty und der beiden Kinder. Somit wird an dieser Stelle im »Conference Room« der Firma »Sterling Cooper« eine strukturelle Parallelität, die durch alle bisherigen Folgen präsent war, aktiv verschnitten, geradezu montiert: Beruf und Familie, das Büro und das zu Hause, aber auch das Image der Ware und ihr Referent treffen aufeinander. Aus dem Zwischenraum dieser getrennten, nunmehr verschränkten, Sphären spricht Don und lässt uns und seine Kunden ein Stück weit an seinem Geheimnis teilhaben. Natürlich bleibt das eigentliche Geheimnis – das seiner Identität – unberührt. Dennoch stellt sich die Frage, wer denn der rätselhafte Don Draper eigentlich sei, in Anbetracht der vorgeführten Familienbilder anders. Das eigene Bild gelangt in eben dieser Fraglichkeit zur Präsentation durch ihn selbst.
Alex Bevan, der dem Kodak-Pitch besondere Bedeutung beimisst, liest »Mad Men« als Auseinandersetzung mit dem Ende bzw. dem Niedergang der Boomer-Generation und deren Träume.(29) So benutze die Serie »old media in order to self-reflexively question contemporary popular constructions of boomer nostalgia.«(30) Hierdurch werde vor allem auf die Konstruiertheit des überholten Familien-Bildes verwiesen.(31) Bevan begreift die außerehelichen Affären Don Drapers als »ugly shadow«, der die »picture-perfect« Familie in der Vorstadt überlagere.(32) Diese Interpretation übersieht allerdings, dass dieses Doppelleben, das zwischen Rausch und Ernüchterung das kreative Potenzial des gelungenen Slogans freizusetzen vermag, bereits die Konsequenz einer Konstruktion ist, die an der Wurzel von Dons Identität wirkt. Nicht seine Familie, sondern sein Leben – er selbst – ist ein Konstrukt. Dick lebt als Don sein eigenes Leben als das Leben eines anderen. Diese Konstruktion muss Geheimnis sein. Ohne Berücksichtigung des Geheimnisses, der damit einhergehenden Begehrens-Struktur und der Gegenwärtigkeit, die sich wiederum aus verheimlichter Vergangenheit und ungewisser Zukunft zwangsläufig ergibt, ist die Komplexität der Familienstruktur, in welche die Ehe als Konstellation eingeflochten ist, nicht zu erfassen. Oder anders gesagt: Don ist immer schon doppelt, egal ob er Familienvater im Vorort, Creative Director im Büro oder Liebhaber im Village ist. Er trägt den Schatten seiner Identität immerzu mit sich. Somit sollte die von Bevan konstatierte Konstruiertheit, die durch die »intermedialen Formzitate«(33) im Kodak-Pitch hervorgehoben wird, nicht ausschließlich als Dekonstruktion des Familienbildes, sondern vielmehr im weiteren Kontext der Dekonstruktion der Erzählung über das eigene Selbst gesehen werden.
Bevan resümiert: »Don’s pitch is a moving monologue about nostalgia to slides of his personal family photos of Betty and the kids«,(34) und tatsächlich berührt uns Dons nostalgische Hinwendung an eine in Bilder gefasste Zeit, die in diesem Moment für den untreuen Ehemann und Familienvater an der Kippe steht. In dieser besonderen Szene geschieht aber noch etwas anderes: In jenem Moment, in welchem ihm alles zu entgleiten scheint, erhält er im Pitch für kurze Zeit die Kontrolle über die Bilder zurück. Don bekam ein paar Folgen zuvor von seinem Halbbruder Adam eine Schachtel mit Fotos und Erinnerungen ins Büro geschickt, die Don als Dick Whitman identifizieren. Don wird durch die Zusendung seines Halbbruders mit ungewollten Bildern aus der Vergangenheit konfrontiert. Sein gut gehütetes Geheimnis kann durch diese Fotos aufgedeckt werden, die Identität, die er sich zu Hause und in der Werbeagentur aufgebaut hat, steht auf dem Spiel. Nach Dons Zurückweisung nimmt sich Halbbruder Adam das Leben. Dick Whitman hat nun keine Familie mehr. Die Dynamik der Bilder kann aber auch Dons Leben zerstören, im Pitch zum Kodak-Diaprojektor bringt er sie allerdings in einen Kreislauf, den er nicht nur per Knopfdruck kontrolliert, sondern zugleich ästhetisiert: Mit Dons Präsentation wird das einfache »Wheel«, wie der Produktname zunächst lautet, zum schillernden »Karussell« erhoben. Er domestiziert die Gefahr und das Unkontrollierbare der Bilder, indem er sie – anhand der Apparatur, die es zu bewerben gilt – selbst in einen Kreislauf setzt und damit wieder zum Vorführer, zum Dompteur, der ›eigenen‹ Bilder wird. Don berührt im Verkaufsgespräch durch die Preisgabe, durch den Einblick, den er – wohlkalkuliert – gewährt. Don Draper bei der Präsentation:
Die Kreativabteilung und mit ihr Don Draper erweisen sich als die Membran des Unternehmens zur Innenwelt der Außenwelt. Sie absorbiert die Wünsche einer Gesellschaft und verarbeitet sie – im Büro – zu Wert. Die Arbeit der Kreativen reicht von der Oberfläche der bunten Produktwelt in die Tiefe des Begehrens und bringt beides in eine legitime Fassung. »Mad Men« lässt über die Warenwelt und die Werbung, die wiederum von Wunschträumen und verborgenen Geheimnissen erzählt, Gesellschaft in der Zeit begreifbar werden. Als »period drama« angelegt, gelingt über das ›Geheimnis‹ die Verbindung zu den zeitlosen Wünschen und Sehnsüchten der heutigen Zuseher*innen. Historische Ereignisse und die individuellen Geschichten der Protagonist*innen werden in der Differenz von Wirklichkeit und Möglichkeit, wie sie die Werbung hervorbringt, nacherzählt. Diffuser Zeitgeist, unterschiedliche Generationenbilder und konkrete Individuen amalgamieren im Slogan, der als prägnanter Text auf diese Gemengelage antwortet, der zu adressieren weiß, und durch das Produkt, das mit dem Slogan zum Verkauf gelangt, selbst am Kreislauf der Bild- und Wunschproduktion partizipiert.
Hinter dem Slogan steht eine Idee. Nicht allein die geniale Idee, sondern der Weg, der zu ihr führt, erzeugt in der Serie die spannungsvollen Momente. Um eine Idee zu haben, gilt es, die Disponibilität, wie sie der Raum mit sich bringt, zu stärken. Dazu muss man den Raum auch manchmal wechseln. In der Regel ist Don Draper zwar erreichbar, aber nicht greifbar. Er verschwindet immer wieder auf Tage, doch weil er so gut ist, in dem, was er tut – und weil er lange Zeit vertraglich nicht gebunden ist – werden ihm diese Freiräume von Seiten des Büros zugestanden. Seine besondere Kreativität erlaubt ihm eine besondere Mobilität. Ungebundenheit und Beweglichkeit liegen aber ursächlich in seinem Geheimnis begründet, das ihn immer wieder dazu drängt, aufzubrechen, durchzubrennen, abzuhauen. Don weiß um das Geheimnis, und wir, die Zuseher*innen, wissen um das Begehren, dieses Geheimnis zu beobachten, es zu lesen. Somit ist Don als Subjekt ein Zeichen im Lacan’schen Sinn.(37) Aufgrund seiner doppelten Identität zwischen Sein und Schein, die ihn in der Welt der Werbung reüssieren lässt, wird er für uns zu einem gleitenden Signifikanten jener Bilder, die er produziert. Begreifen wir die Erzählung, die durch die gesamte Serie entfaltet wird, als ein mediales Artefakt, worin sich reale, imaginäre und symbolische Perspektiven räumlich bündeln,(38) so wird deutlich, dass die Koordinaten dieser artifiziellen Räumlichkeit den virtuellen Raum als Erzählraum vorwegnehmen, denn der Raum ist immerzu dort, wo das Signifikat Don Draper sich hinbewegt, um sich als Signifikant zu zeigen. Um ihn herum konstituiert sich der Raum der Geschichte, in dessen Zentrum für die Zuseher*innen ein offenes Geheimnis wirkt. Dick und Don sind in ihrer doppelt aufeinander verwiesenen Identität die Variable, die uns durch das geteilte Geheimnis an sich bindet und die erzählte Welt in dreifacher Hinsicht konstituiert: real als Dick, imaginär als Don, symbolisch als einer, der ein anderer ist. Das Identifikationspotenzial liegt für die Zuseher*innen somit in diesem symbolischen Raum eines anderen; denn wir kommen nicht umhin, uns mit dem, der eigentlich ein anderer ist, zu identifizieren. So ist Dons Geheimnis zugleich auch unser eigenes. Eben diese Anagnorisis wird im Finale der Serie aufgegriffen und als Selbsterkenntnis auf ebenso berührende wie bitter-ironische Weise auf den Protagonisten Don Draper zurückgespiegelt.
Die Suche nach der Idee ist zugleich eine nach Inspiration und Kreativität, die bei »Mad Men« allerdings fortwährend mit den Ansprüchen andauernden Wachstums kollidiert. Das Büro wird in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung der Nachkriegszeit zum Lebensraum, die Suche nach der besten Idee, die ihrem Schöpfer Erfolg, Profit und Ruhm verspricht, führt aber immer wieder zur Frage nach dem letzten Sinn. Diese Spannung zwischen Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis bzw. einem erfüllten Leben bleibt bis zum Finale der Serie erhalten (7.14): Als Draper inmitten der Meditationsgruppe die Idee zum »Coca-Cola« Spot hat (»I’d like to buy the world a Coke and keep it company«), der dann abschließend auch eingespielt wird und die Serie endgültig beendet, greifen Fiktion und Realität ein letztes Mal ineinander. Die letzte Einstellung – eine Nahaufnahme von Dons Gesicht mit geschlossenen Augen, auf dem sich ein Lächeln abzuzeichnen beginnt (Min. 52:37–52:51) – gibt uns schließlich genau jenen Moment: den Moment der Idee. Der Weg zu dieser Idee führt allerdings über eine finale Krise im Leben des Protagonisten, die – wie alle bisherigen Krisen ebenso – in der angenommenen Identität des Anderen wurzelt. Aufgehoben im Sesselkreis des Selbstfindungsseminar ermöglicht Dons Krisenerfahrung allerdings eine Anagnorisis zwischen ihm, dem außerordentlichen Genie, und Lennard, einem einfachen Büromitarbeiter (Min. 47:00–50:18). So wird der Raum des Büros selbst noch im Rückzug von der Zivilisation, im Ressort der »Counter-Culture«, präsent und wirksam gehalten; und führt in seiner abwesenden Anwesenheit letztlich zur Allusion des perfekten Spots – für »Coca Cola«.
Mad Men. Matthew Weiner, AMC, Lionsgate Television. 92 Episoden in 7 Staffeln, 19.07.2007–17.05.2015. In Folge zitiert in Klammer: (Staffel.Episode, Minute).
Archivmaterial im Harry Ransom Center, University of Texas at Austin. Für diesen Hinweis danke ich Sophie Liepold.
Nikil Saval: Cubed. A Secret History of the Workplace, New York 2014, p. 135.
Gianenrico Bernasconi/Stefan Nellen (eds.): Das Büro. Zur Rationalisierung des Interieurs, 1880–1960, Bielefeld 2019, p. 22.
Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Köln 2009 (Nachdruck Berlin: Kiepenheuer 1932) [1867], at p. 49.
Marx: Kapital, p. 83 l–95 (Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis).
Bernasconi/Nellen: Das Büro, p. 15.
In »Mad Men« hat jede Generation ›ihren‹ Krieg: Don Draper ist ein Produkt des Koreakriegs, sein Chef Roger Sterling erzählt vom Zweiten Weltkrieg, Bettys Vater zeigt den Enkelkindern Devotionalien aus dem Ersten Weltkrieg. Der Vietnamkrieg wird mit der »Counter-Culture« der Hippie-Bewegung eine eigene Protestbewegung hervorbringen. Die gemeinsame Kriegserfahrung prägt auch das Kaufverhalten bzw. was man über ein Produkt zu hören wünscht. Vgl. Kate Edenborg: Going Groovy or Nostalgic: Mad Men and Advertising, Business, and Social Movements, pp. 147–171.
Bei der Ersetzung eines Toten durch einen Lebenden kommt es im Grunde zu einer Doppelung, denn auch der Lebende muss seine frühere Identität sterben lassen. Überaus interessant ist jene Szene (1.12, Min. 43:16), in welcher Don (eigentlich Dick) aus dem Zugfenster die Übergabe ›seiner‹ sterblichen Überreste an seine Familie beobachtet. Diese Szene verleiht Dick, nunmehr Don, ein neues Leben. Die Berührung einer unbekannten Frau, die damit einhergeht, erhebt den Abschied zum Initial und markiert den Beginn einer radikalen, körperlichen Gegenwärtigkeit – eben eines zweiten Lebens. Die Unbekannte spricht zu ihm die entscheidenden Worte: »You’ve got your whole life ahead of you. Forget that boy in the box«.
Lilly J. Goren: If You Don’t Like What They Are Saying, Change the Conversation: The Grifter, Don Draper, and the Iconic American Hero, pp. 35–61.
Die Psychoanalyse wird in der ersten Episode dezidiert angesprochen, von Don Draper allerdings sogleich als »pervers« (1.1, Min. 14:45) verabschiedet. Eine psychoanalytische Konnotation bleibt aber über die Wünsche und Sehnsüchte, die dem Begehren der Figuren eingeschrieben sind, unterschwellig vorhanden.
The Platters: Smoke gets in your eyes, 1959.
Ayn Rand: Atlas Shrugged, London 1999 [1956], p. 61.
Hervorheb. von mir, KK.
Slavoj Žižek: The Actuality of Ayn Rand, in: The Journal of Ayn Rand Studies Vol. 3/No. 2 (2002), pp. 215–227.
Žižek: The Actuality of Ayn Rand, p. 225.
Žižek: The Actuality of Ayn Rand, p. 225. Hervorheb. i Orig.
Žižek: The Actuality of Ayn Rand, p. 225.
Bernasconi/Stefan Nellen: Das Büro, p. 16f.
Bernasconi/Stefan Nellen: Das Büro, p. 13–16.
Marshall McLuhan/Eric Norton: Geschlechtsorgan der Maschinen. Playboy-Interview, in: Martin Baltes/Rainer Höltschl (eds.): Absolute Marshall McLuhan. Freiburg 2011, pp. 7–57, at pp. 24f.
Dominik Schrey: Analoge Nostalgie in der digitalen Medienkultur, Berlin 2017, p. 18; vgl. David Pierson: AMC’s Mad Men and the Politics of Nostalgia, in: Katharina Niemeyer (ed.): Media and Nostalgia. Yearning for the Past, Present and Future. Basingstoke 2014. S. 139−151; vgl. Alex Bevan: Nostalgia for Pre-Digital Media in Mad Men, in: Television & New Media 14/6 (2013), pp. 546−559.
Andreas Böhn: Mediennostalgie als Techniknostalgie, in: Andreas Böhn/Kurt Möser (eds.) Techniknostalgie und Retrotechnologie, Karlsruhe 2010, pp. 149–165.
Schrey: Analoge Nostalgie, p. 12.
Schrey: Analoge Nostalgie, p. 12.
Vgl. Bevan: Nostalgia, pp. 546−559.
Die Bilder der Videokamera werden in die Erzählung integriert: Wir sehen die zukünftig erhaltene Erinnerungsspur und hören den rahmenden Dialog, der die Bilder hervorbringt und das idyllische Potenzial konterkariert. Anders, nämlich nicht gegenläufig, sondern harmonisch-akkordierend und dynamisch-affirmierend fixieren die Bilder der von Elizabeth geführten Handkamera in »The Crown« (Netflix, 2016–2023; 1.1) die sportliche Ertüchtigung ihres Ehemanns. In der Serie »Succession« (HBO, 2018–2023) wandert der Familienfilm per Handkamera in den Vorspann. Die Erinnerung wird zum immer wieder eingespielten Auftakt des andauernden familiären Kampfes um Anerkennung, Rangfolge und Macht.
Zu Nostalgie und »Period Drama« vgl. Linda Beail/Lilly J. Goren: »Mad Men« and politics. Nostalgia and the remaking of modern America, in: Linda Beail/Lilly J. Goren (eds.): »Mad Men« and politics. Nostalgia and the remaking of modern America, New York 2015, pp. 3–34, at p. 4.
Vgl. Bevan: Nostalgia, pp. 551−555.
Bevan: Nostalgia, p. 546.
Vgl. Bevan: Nostalgia, p. 548.
Bevan: Nostalgia, p. 547.
Schrey: Analoge Nostalgie, p. 127.
Bevan: Nostalgia, p. 551.
Slavoj Žižek: Der Hitchcocksche Schnitt: Pornographie, Nostalgie, Montage, in: Slavoj Žižek et al.: Was Sie immer schon über Lacan wissen wollten und Hitchcock nie zu fragen wagten, Frankfurt/Main 42018 [2002], pp. 45–69, at p. 57. Man könnte diesen Ansatz noch weiterdenken und Don eine grundlegende Nostalgie attestierten, da er aufgrund seiner doppelten Identität immer schon den Blick des Anderen auf sich selbst durch sich selbst gerichtet hat. Es ist auch dieser Schmerz, der ihn antreibt und das Begehren – also das, was die Leute wollen und wünschen – erkennen lässt.
Zum Motiv der Heimkehr vgl. Schrey: Analoge Nostalgie, p. 278.
Jacques Lacan: Schriften 1. Freiburg 1973 [1966], pp. 108, 210–239.
Hermann Doetsch: Einleitung. Körperliche, technische und mediale Räume, in: Jörg Dünne/Stephan Günzel (eds.): Raumtheorie, Berlin 2006, pp. 195–209, at p. 202.