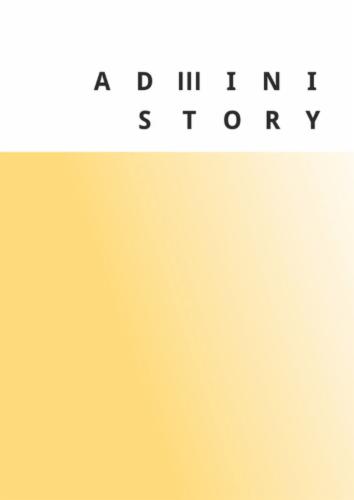Dokumentarische Literatur und polizeiliche Dokumentation: Joseph Roths »Die Flucht ohne Ende« und »Der stumme Prophet«
Data publikacji: 09 lip 2025
Zakres stron: 105 - 116
DOI: https://doi.org/10.2478/adhi-2023-0007
Słowa kluczowe
© 2022 Stephanie Marx, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
»Nicht oft im Lauf der Jahrhunderte war in Deutschland die Verwirrung so groß wie jetzt«, setzt Joseph Roth in »Schluss mit der ›Neuen Sachlichkeit!‹« (1930) zu seinem Rundumschlag gegen den literarischen ›Dokumentarismus‹ an.(1)
Roths Einwände gegen den literarischen Dokumentarismus lassen sich mühelos mit seinen Kritiken an einer ganz anderen Art von Dokument engführen, das ihn im Verlauf der 1920er-Jahre wiederholt beschäftigt hat: das »Personaldokument«, das »erst die Berechtigung ver[leiht], eine Person zu sein« (III, 134–135). Staatliche Dokumente wie Pässe und Visa sind Roth einerseits als potenzielle Verkehrsbehinderung beim grenzüberschreitenden Reisen ein Dorn im Auge. Andererseits beschäftigen sie ihn als Personendokumente, die ihre Träger*innen auf eine bestimmte Art des In-Erscheinung-Tretens verpflichten und dabei die ganze Identität garantieren sollen. Doch »[d]er Paß beweist nicht, daß ich – ich bin. Er beweist, daß […] ich Staatsbürger bin« (I, 147), protestiert Roth in »Die Kugel am Bein« (1919) gegen dieses polizeiliche Phantasma. Ebenso wie auf den Abstand zwischen literarischem Dokument und Ereignis, beharrt er auch auf der »seit dem Beginn des Passwesens unüberwindbare[n]« Differenz zwischen dem Individuum und seinem »papierene[n] Doppel«.(2)
Die verschiedenen Verfahren der Dokumentation, denen sich Roth in seinen Reportagen und Feuilletons der 1920er-Jahre widmet, sind auch zentraler Reflexionsgegenstand in »Die Flucht ohne Ende« (1927) und »Der stumme Prophet«.(3) Beide Texte fallen in die Phase von Roths Schaffen, in der er sich am intensivsten mit dem dokumentarischen Schreiben auseinandergesetzt hat,(4) in ihnen sind staatliche Dokumente und bürokratische Institutionen zugleich irreduzibler Bestandteil der Narration. Ihre Literarisierung führt indes zu markanten Verschiebungen: Erstens geht der Bezug auf staatliche Praktiken der Dokumentation in »Die Flucht ohne Ende« und »Der stumme Prophet« mit deren Reflexion als sprachlichen Praktiken einher; ihre Einbindung hat denn auch unmittelbare Auswirkungen auf die Erzählordnung und die Figurengestaltung. Die Romane bestätigen dabei Kerstin Stüssels Befund, dass »immer dann, wenn literarische Texte die Bürokratie zu ihrem Thema machen«, auch eine »komplexe Reflexion auf die gesellschaftlich-kulturelle Situation der Literatur selbst vollzogen wird«.(5) Dafür werden, zweitens, polizeiliches und literarisches Dokument miteinander verzahnt – was allerdings nicht allein dem Zweck der Kritik dient. Denn bei allen Einwänden gegen dokumentarische Authentizitätsbehauptungen zeugen »Die Flucht ohne Ende« und »Der stumme Prophet« doch von einer gewissen Faszination angesichts der Behauptungskraft des Dokuments. Ob bzw. unter welchen Bedingungen diese für das literarische Schreiben angeeignet werden kann, wird folgend nachgezeichnet und im Zuge dessen eine neue Perspektive auf Roths Schreibpraxis als dokumentarische eröffnet.
In seinen journalistischen Texten hat Roth das veränderte Grenz- und Passregime im Europa der Nachkriegszeit(6) wiederholt und vehement kritisiert. In Feuilletons wie »Für die Staatenlosen« (1929) oder in der Serie »Juden auf Wanderschaft« (1927) klagt er unmissverständlich die Einschränkungen der Freizügigkeit und die Zunahme sogenannter Staatenloser durch die Neugründung von Nationalstaaten an. In der Literaturwissenschaft sind die sprachlichen Besonderheiten dieser Texte immer wieder beachtet worden. So macht beispielsweise Ute Gerhard plausibel, dass Roth hierin gängige Symbole aus dem Diskurs um Flucht und Migration aufgreift, um »die diskursiven Techniken und Ordnungen der Ausgrenzung und Verwerfung«(7) zu diskreditieren. Mona Körte hat herausgearbeitet, wie er dabei all jenen
In »Die Flucht ohne Ende« setzt Roth ein regelrechtes Verwirrspiel im Spannungsfeld von Figurenidentität und polizeilicher Identifizierung in Gang. Gleichzeitig schreibt sich der Text, der von der Odyssee des österreichischen Oberleutnants Franz Tunda erzählt, bereits auf dem Buchdeckel in die zeitgenössischen Debatten um dokumentarische Literatur ein. Im Untertitel ist »Die Flucht ohne Ende« als »Ein Bericht« ausgewiesen, dieser Gattungsbezeichnung entspricht auch das vielzitierte Vorwort, in dem ein gewisser JOSEPH ROTH (in Kapitälchen) proklamiert, dass an seiner Erzählung »nichts erfunden, nichts komponiert« (IV, 391) ist. Aufgrund dieser ostentativen Abkehr vom ›Dichten‹ ist der dokumentarische Charakter von »Die Flucht ohne Ende« denn auch wiederholt diskutiert worden, wobei (mittlerweile) unbestritten ist, dass weder der Gattungsbezeichnung noch dem Erzähler vorbehaltlos Glauben geschenkt werden kann.(12) Wie der Text selbst nahelegt, lässt sich das Vorwort stattdessen als ironischer Kommentar auf den zeitgenössischen Hunger nach »ungeformte[r] dokumentarische[r] Mitteilung« (III, 158) lesen. Im zweiten Drittel von »Flucht ohne Ende« berichtet ROTH nämlich, dass er ein weiteres Buch ›authentifiziert‹ hat, das allerdings Tundas »sibirische
Welche Folgen der naive Glaube an die Authentizität des Dokumentarischen hat, zeigt Roth in »Die Flucht ohne Ende« anhand von Franz Tunda. Dessen Gestaltung ist von Beginn an über seine staatlichen Dokumente vermittelt. Die Vorstellung der Figur orientiert sich an der formelhaften Kennzeichnung des Passes, in kurzen, parataktischen Sätzen werden sein Name (Franz Tunda) und Beruf (Oberleutnant der österreichischen Armee) genannt sowie Angaben zu den Eltern (der Vater war österreichischer Major, die Mutter eine polnische Jüdin) und zum Geburtsort (eine kleine Stadt in Galizien) gemacht.(13) Mag die Nennung von derlei
Spätestens ab dieser Passage lässt sich keine verlässliche Auskunft mehr darüber geben, welches die ›echte‹ und welches die ›falsche‹ Identität der Figur ist. Einige Tage nach seiner Gefangennahme durch die Weißen Truppen wird Tunda/Baranowicz von einer Gruppe Rotgardist*innen befreit. Auf die Frage von deren Anführerin – »Wer sind Sie?« (IV, 398) – gibt der Text jedoch keine Antwort und fährt stattdessen fort: »Sie schrieb alles auf, was Tunda sagte.« (IV, 398) Kurz darauf wird sich zeigen, dass selbst die Identifizierung des Erzählers, der hier am Name Tunda festhält, ohne Gewähr ist. Noch bevor die Figur den Weißen Truppen begegnet war, berichtete dieser: »Er war ein Österreicher. Er marschierte nach Wien.« (IV, 397) Nachdem sich Tunda/Baranowicz den Bolschewist*innen angeschlossen und begonnen hat, für die Russische Revolution zu kämpfen, heißt es: »[E]r hieß Baranowicz, er war ein Revolutionär.« (IV, 406) Wiederum später und nachdem Tunda/Baranowicz ein paar weitere Etappen seiner Reise durch Russland zurückgelegt hat, wird die Verunklarung auf die Spitze getrieben und die Identität von Nicht-Identischem behauptet: »Der Name Tundas war nicht falsch, Tunda war wirklich Franz Baranowicz« (IV, 416).
Bestand die Figurenbeschreibung zu Beginn des Romans in der Aufzählung polizeilicher Kennzeichen, ist sie in den genannten Passagen in die Syntax logischer Formeln überführt, die ihrerseits die Sprache des Passes antizipieren. Der Geltungsanspruch der verschiedenen Charakterisierungen wird durch die Klarheit ihrer Form gestützt, ihre Bedingung ist die Suspendierung von Zeitlichkeit: Die verschiedenen Attribuierungen werden nicht temporal miteinander in Bezug gesetzt, jeglicher Marker für ein Davor oder Danach fehlt; es wird aber auch von keiner Entwicklung erzählt, etwa in der Form ›Tunda wurde zu Baranowicz‹. Einerseits könnte das staatliche Dokument bzw. seine Wirkmacht in »Flucht ohne Ende« also gar nicht ernster genommen werden, denn in dem Moment, in dem die Figur über verschiedene Pässe verfügt,
In Kontakt mit staatlichen Behörden gerät Tunda/Baranowicz erst wieder, als er beschließt, Russland (nun wirklich) zu verlassen. Erzählerisch eingeleitet wird die Reise durch den Blick auf ein weiteres Dokument. Kurz bevor er in der österreichischen Botschaft in Moskau vorständig wird, besieht Tunda/Baranowicz einen alten Militärbefehl der k. u. k. Armee, den er noch bei sich hat: »Es war ein offener Befehl, Nummer 253, mit rundem Stempel unterschrieben von Kreidl, Oberst, ausgestellt vom Feldwebel Palpiter« (IV, 425). Bis ins kleinste Detail – weit detaillierter als die Figur selbst – wird das Schriftstück beschrieben: »Das gelbe, in seinen Falten porös gewordene Papier hatte eine gewisse Weihe bekommen, es war glatt, es fühlte sich an wie Talg und erinnerte an die Glätte der Kerzen.« (IV, 425) Dergestalt ausgestattet mit der Autorität des Sakralen entfaltet es sodann eine eigentümliche Wirksamkeit:
Der vom Erzähler forcierte Zweifel an der Validität des Dokuments schlägt sich auch gegenüber dem österreichischen Botschafter nieder, dem Tunda seinen Befehl vorlegt. Als Relikt aus einem Krieg, der beendet ist, und legitimiert von einem Staat, der nicht mehr existiert, ist ihm das Vergehen von Zeit von vornherein eingeschrieben – es gibt schlicht keine polizeiliche Instanz mehr, die für die Kontrolle und Beurteilung dieses Dokuments zuständig sein könnte. Tatsächlich findet der Konsul Tundas Schriftstück so wenig glaubwürdig, dass er Auskünfte in Wien und Linz einholen lässt, um dessen Identität und Nationalität bestätigen zu lassen. Roth nimmt damit ein wiederkehrendes Motiv seiner Feuilletons auf, den Gedanken nämlich, dass »Papiere nur durch Papiere zu generieren sind«.(17) Darüber hinaus zeichnet sich hier aber auch der Typ des ›maßvollen‹ Beamten ab, den Roth in seinen späteren Romanen portraitiert. Denn auch wenn der Konsul Tundas Befehl keinen Glauben schenkt, so doch seinem »einwandfreien ärarischen Dialekt […]. Dieser Dialekt bekräftigte und erhärtete die Erzählungen des Fremden besser, als es jedes Dokument vermocht hätte.« (IV, 426)(18)
Schlussendlich bekommt Tunda »einen österreichischen Paß« (IV, 426) und nachdem die bürokratische Ordnung auf diese Weise wiederhergestellt ist, spielen staatliche Dokumente in »Flucht ohne Ende« keine Rolle mehr. Während der Zeit in Russland fungieren Pass und Militärbefehl jedoch als Identitäts-Dokumente im existenziellsten Sinn. Einerseits erfüllen sie das polizeiliche Identifikations-Phantasma, indem sie die unterschiedlichen (Selbst-)Entwürfe der Figur vorgeben; dadurch motivieren sie zugleich den Fortgang der Handlung. Die Bedingung für diese Indienstnahme der Dokumente für das Erzählen ist andererseits die faktische Abwesenheit der Polizei. Dass sie dergestalt aus dem Netz kontrollierender Verfahren und Instanzen gelöst werden, lässt ihre Wirkmacht indes unbeschadet. Mit Cornelius Castoriadis gesprochen, macht sich »Die Flucht ohne Ende« somit den Abstand zwischen der Institution und dem Instituierenden zunutze: In »Gesellschaft als imaginäre Institution«(19) (1975) unterscheidet Castoriadis mit den Begriffen zwischen der gegebenen Form gesellschaftlicher Organisationen (Institution) und dem beständigen Werden eben dieser (instituierend). Beide Dimensionen sind weder deckungsgleich noch in eine erschöpfende kausale oder teleologische Verbindung zu bringen, was Castoriadis mit dem Imaginären begründet. Als schöpferisches und kreatives Moment gesellschaftlicher Prozesse fungiert das Imaginäre als Garant für Veränderlichkeit. Diese Form der Kontingenz setzt »Flucht ohne Ende« in Szene: Im Zuge der Verhandlung des Verhältnisses von Figur und Dokument wird weder völlige Autonomie noch völlige Determiniertheit behauptet. Stattdessen setzt der Text das Imaginäre in sein Recht.
Dieses produktive Moment mag auch der Grund dafür sein, dass das Dokument nicht verschwindet, nachdem Tunda nach Westeuropa zurückgekehrt ist. Nur werden die staatlichen Dokumente nun durch Ego-Dokumente – Briefe und Tagebucheinträge – abgelöst.(20) Deren Vermögen zur Authentifizierung ist jedoch in dergleichen Weise restringiert wie bei ihren staatlichen Pendants. Denn Tundas Schilderungen weichen immer wieder vom »Bericht« des Erzählers ROTH ab und fügen sich so mitnichten in ein bruchfreies Erzählganzes.(21) So erläutert beispielsweise ROTH, dass Tunda »in Baku nichts mehr zu tun« (IV, 424) hatte, nachdem seine Geliebte Frau G. von dort abgereist ist. Tunda selbst wiederum schreibt an ROTH: »Du fragst natürlich, warum ich Rußland verlassen habe. Ich weiß keine Antwort.« (IV, 428) Wie nicht zuletzt das Buch mit Tundas ›sibirischen Erfindungen‹ zeigt, bedeuten diese Diskrepanzen jedoch nicht unbedingt einen Mangel. Stattdessen tritt Tunda als genau die Art von Berichterstatter auf, für den sich Roth auch in »Schluss mit der Neuen Sachlichkeit!« stark macht, als einer nämlich, der über eine »genaue Kenntnis der Realität« verfügt, die er allerdings »beliebig und schöpferisch veränder[t]« (III, 157). Die Wahrhaftigkeit von Tundas Text verdankt sich also seiner Wahrscheinlichkeit, nicht Authentizität. Anlass und Ausgangspunkt des Erzählens ist und bleibt dabei das Dokument, dessen eigensinnige Aneignung bis zur Autorschaft zurückwirkt: Das Buch »erschien unter dem Namen Baranowicz, in der Übersetzung von Tunda« (IV, 464).
Während in »Die Flucht ohne Ende« die Wirkmacht des Dokuments poetisch (aus)genutzt werden kann, um erst den Abstand zwischen Individuum und Staat zu vermessen und ihn alsdann erzählerisch zu füllen, schlägt »Der stumme Prophet« eine andere Perspektive vor. Im Romanfragment werden die Gegensätze, mit denen auch »Die Flucht ohne Ende« spielt, so stark radikalisiert, dass sie aporetische Gestalt annehmen. Während der Text selbst auf dieser Grundlage mit dem Abbruch des Erzählens droht, erlaubt die Verschärfung zugleich eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Bedingungen und Grenzen literarisch/polizeilicher Dokumentation.
Friedrich Kargan, der titelgebende stumme Prophet, ist ebenso wie Tunda eine Figur der Grenzüberschreitung. Von Odessa nach Galizien, von Wien nach Sibirien, von Mitteldeutschland über Zürich nach Moskau und Paris wird die Figur begleitet. Seit seiner Jugend bewegt sich Kargan am Rand der Legalität und lernt früh, »wie man log, Papiere fälschte, die Ohnmacht, die Dummheit und selbst noch die Brutalität der Beamten benützte« (IV, 786). Berufsbedingt verfügt der Revolutionär denn auch über eine gewisse Routine im Umgang mit gefälschten Dokumenten. »Er versorgte sich also mit Geld und – zum wievieltenmal schon in seinem Leben? – mit einem Paß auf einen falschen Namen« (IV, 915), heißt es gegen Ende des Romans. Auf die erzählerische Darstellung Kargans haben die notorisch falschen Papiere jedoch keine so nachhaltige Wirkung wie auf Tunda/Baranowicz: die Angaben auf den (falschen) Pässen werden nicht einmal genannt. Während die Figur in »Die Flucht ohne Ende« irreduzibel auf ihre Dokumente verwiesen bleibt, ist es genau diese Eingebundenheit in staatliche Strukturen, die Kargan flieht. Und das nicht ohne Grund, denn er sieht sich leibhaftig bedroht von den unterschiedlichsten Verwaltungsinstanzen: Von Registern, »die blank und weiß auf seinen Namen und seine Daten gewartet hatten«, und von »spitzen, von grüner Tinte giftig gefärbten Federn […], mit denen hunderttausend Schreiber wie mit Lanzen nach ihm gezielt hatten« (IV, 912).
»Der stumme Prophet« wird zumeist als Roths Abrechnung mit den Entwicklungen im postrevolutionären Russland gelesen, in der der ehemals »Rote Joseph«(22) unmissverständlich die Verbürgerlichung und Bürokratisierung der Russischen Revolution anklagt.(23) Von der »kleinen Schreibtischbürgerlichkeit« und vom »Tintenterror der Bürokratie« (II, 689) spricht er an anderer Stelle auch.(24) So sehr dem Roman diese Kritik abzulesen ist – nicht zuletzt, weil auch Kargan schlussendlich, von allen revolutionären Geistern und Unterstützern verlassen, von der politischen Bühne abtritt –, sind die bürokratischen Bedrohungsszenarien doch keineswegs auf die Sowjetunion begrenzt. Ganz im Gegenteil lassen sich weder nationale noch politisch-ideologische oder lebensweltliche Eigenheiten erkennen, denn die Institutionen rationaler Herrschaft begegnen Kargan überall und jederzeit: während seines Aufenthalts in der Schweiz, wo ein deutscher und ein französischer Spion ihre Berichte tippen (vgl. IV, 871); in Wien, wo während des Ersten Weltkrieges alle Menschen zu »Schatten ihrer Dokumente« (IV, 843) werden; in Nachkriegs-Deutschland, wo sich Herr von Derschatta, der Bevollmächtigte einer Fluggesellschaft, in erster Linie durch die Einrichtung seines Büros, nicht aber menschliche Eigenschaften auszeichnet (vgl. IV, 909–911).
Selbst Fichte kannte und verteidigte »das unschuldige Vergnügen, das aus der Unbekanntheit entstehen kann«,(25) weshalb der Einflussbereich der Polizei ihm zufolge auch in Grenzen gehalten werden muss. Kargan dagegen erscheint die Einflusssphäre staatlicher, ökonomischer und politischer Institutionen nachgerade grenzenlos. Bürokratie und Verwaltung werden so zu Statthaltern einer Polizei ganz anderer Natur: statt einer Kontrollinstanz mit klar umrissenen Befugnissen, tritt sie als allumfassende Struktur auf. Im »Stummen Propheten« nimmt sie damit die Gestalt an, die Jacques Rancière der Polizei in »Das Unvernehmen«(26) zuerkennt.
Mit dem Begriff Polizei fasst Rancière die allgemeine Ordnung einer Gemeinschaft, die »[d]ie Verteilung der Plätze und der Funktionen«(27) aller ihrer Mitglieder definiert. Als solche zeichnet sie sich durch ihre Stabilität aus, provoziert werden kann sie nur durch die Politik: Während nämlich die polizeiliche Ordnung eine Bestimmung derer voraussetzt, die einer Gemeinschaft zugehörig sind, besteht die politische Praxis darin, einen »Anteil der Anteillosen« zu reklamieren und so die »Aufteilung des Sinnlichen polizeilicher Ordnung durch die Inszenierung einer Voraussetzung«(28) infrage zu stellen. Politik bedarf nach Rancière ganz eigener Subjektivierungsweisen, denn die Polizei reguliert auch das In-Erscheinung-Treten einer Person. Sie identifiziert »Bürgerschaftlichkeit als Eigenschaft der Individuen«,(29) die dann wiederum Voraussetzung dafür ist, innerhalb der Ordnung zu zählen, zählbar zu sein.
Über Zählbarkeit, die an eine bestimmte Form des Person-Seins gebunden ist, denkt auch Kargan während eines nächtlichen Spaziergangs in der mitteldeutschen Kleinstadt M. nach:
Anders als bei Rancière erscheint die polizeiliche Ordnung in »Der stumme Prophet« nicht als exklusiver Raum, in dem die Anteillosen in einem Akt des Politischen um Anteil kämpfen. Da ihm der Preis für Zahlbarkeit zu hoch ist, ist Kargan viel eher auf der Hut, um nicht von ihr vereinnahmt zu werden. Diese Haltung hat jedoch seine Tücken, denn im Roman impliziert sie nicht nur eine gesellschaftlich-strukturelle, sondern auch eine mediale Verweigerung. Ganz im Sinne Max Webers, der die Aktenmäßigkeit der Verwaltung zu den Grundprinzipien rationaler Herrschaft zählt,(30) identifiziert der Text Schriftlichkeit als kleinsten gemeinsamen Nenner der bürokratischen Szenerien. Die Schrift fungiert als paradigmatisches Medium der polizeilichen Ordnung und ist untrennbar mit den ihr eigenen Praktiken verbunden.
Die eindrucksvollsten Requisiten der Verwaltung sind im »Stummen Propheten« die Schreibtische, von deren sowjetischer Variante Kargan auch als »Möbelstücke[n] des Regierens […] in Vertretung der Throne« (IV, 896) spricht. Im Verlauf des Romans erhalten Leser*innen einen Eindruck von den Schreibtischen fast aller polizeilichen Agenten: dem des Herrn von Derschatta, der »nach den letzten Fortschritten der Technik eingerichtet [war] und […] Pedale [hatte] wie ein Klavier« (IV, 909), oder dem des namenlosen Parteiführers in M., den ein »enormes Tintenfaß« (IV, 864) und ein bronzenes Papiermesser »mit der Form eines Säbels« (IV, 864) zieren. Untrennbar begleiten auch die Schreibutensilien alle bürokratischen Tätigkeiten: von der klappernden Schreibmaschine des deutschen Spions in Zürich (vgl. IV, 871) bis zum Koh-i-Noor-Bleistift von Kargans Sekretärin – »leuchtendes Gelb und eine lange, schwarze Spitze« (IV, 913) – zu den nicht enden wollenden Papierbergen, die »in hunderttausend Kanzleien« (IV, 913) beschrieben werden.
Schreibtische, Papiere, Bleistifte – im Roman werden sie alle zu Instrumenten des Tintenterrors, da ihnen »ein Gesetz […] die Macht über Blut und Eisen, Gehirne und Muskeln, Feuer und Wasser und Hunger und Epidemien« (IV, 912) verliehen hat. Ihre Gefährlichkeit verdankt sich dabei zum einen den Produkten ihres Einsatzes, zum anderen ist der Schrift in »Der stumme Prophet« eine spezifische Form der Gewaltsamkeit eigen. Was Kargan droht, wenn er die »von grüner Tinte giftig gefärbten Federn« (IV, 912) flieht, »mit denen hunderttausend Schreiber wie mit Lanzen nach ihm gezielt hatten« (IV, 912), ist, aufgespießt zu werden. ›Schriftlich festgehalten‹ werden demnach nicht nur Befehle und Anordnungen, die über Leben und Tod entscheiden, sondern die Figur selbst, deren Festschreibung hier eine gewaltsame Tötung impliziert. Angesichts dessen verwundert es nicht, dass Kargan gegen Ende des Romans und in der Hoffnung auf »ungekannte,
Die im »Stummen Propheten« vernehmbaren Skrupel sind häufig als Indiz einer Sprachkrise gedeutet worden,(31) die in Anschluss an das hier Dargelegte als Krise einer polizeilich kontaminierten Schrift apostrophiert werden müsste. Der bloße Umstand, dass sie selbst in schriftlicher (Roman-)Form vorgebracht werden, gemahnt jedoch zur Vorsicht. Tatsächlich wird das Verhältnis von Schrift und Polizei im Vorwort des »Stummen Propheten« denn auch in anderer Weise gefasst, als Kargan selbst es tut. Ein prominent ausgestellter Erzähler erläutert hier die Umstände der Textentstehung: In einem Moskauer Hotelzimmer habe er vor einer Gruppe von Menschen und über mehrere Nächte hinweg Kargans Lebensgeschichte ausgebreitet; erst im Anschluss empfand er es als Notwendigkeit, »meiner Erzählung ein weiteres Echo zu geben […]. Ich entschloß mich aufzuschreiben, was ich erzählt hatte« (IV, 776). Das Zustandekommen des Romans wird hier als Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit beschrieben, aber auch als Ineinander von literarischer und polizeilicher Rede. Neben dem Erzähler gibt es in diesen Nächten um Silvester 1927 nämlich noch eine weitere Figur, die von Kargan zu berichten weiß: den Geheimdienstler Grodzki, »den der Beruf verpflichtete, alle zu kennen« (IV, 776).
Bereits im Vorwort wird durch die Verdoppelung der Erzählinstanzen der zentrale Konflikt des Romans entwickelt. Der Erzähler gibt sich mittels der Beschreibung seines Hotelzimmers, in dem »der bekannte Zigarettendunst [schwebte], den man aus den Romanen der russischen Literatur kennen dürfte« (IV, 775), zumindest latent als Dichter zu erkennen; weniger implizit personifiziert Grodzki die Polizei. Anders als im Roman werden Schrift und Polizei im Paratext jedoch nicht zur Deckung gebracht. Einerseits scheint der Erzähler ohne Grodzki nicht auszukommen, er »begann zu erzählen, von Grodzki unterstützt« (IV, 776). Auf die Korrumpierung der mündlichen Rede durch die Polizei reagiert er andererseits mit deren Literarisierung. Erklärtermaßen entfernt er in der schriftlichen Fassung nicht nur alles Dialogische, die »Zwischenrufe der Zuhörer, ihre Bewegungen, ihre Scherze, ihre Fragen«, sondern auch »jene Ereignisse« und »Merkmale, die zu einer Identifizierung Kargans führen könnten« (IV, 776). Der Name ›Friedrich Kargan‹ ist somit von Beginn an zweifelhaft, jedenfalls entspricht er nicht dem – im Text nicht genannten – »Pseudonym« (IV, 882), unter dem der Protagonist als Revolutionär Karriere gemacht hat.
Es ist bisweilen vermutet worden, »Der stumme Prophet« sei Fragment geblieben, weil Roth von der Realität überholt wurde. Gescheitert sei der lange Zeit als Krypto-Biografie Leo Trotzkis gelesene Roman demzufolge, weil Trotzki ihm 1929 mit der Veröffentlichung seiner Autobiografie »Mein Leben« zuvorgekommen sei.(32) In Anschluss an das Gezeigte scheint es im Gegensatz dazu plausibler, dass dem Text ein irreduzibler Zweifel an der Gattung Biografie eingeschrieben ist – zumindest sofern sie am Paradigma eindeutiger Identifizierung festhält. Folgerichtig beschreibt der Erzähler den Modus seines Sprechens auch als »Versuch einer Biographie« (IV, 776); ebenso konsequent subvertiert er auch das Verhältnis von Eigenname und Pseudonym und verunmöglicht so jeden Versuch einer Referenzialisierung. Doch ist dieser Akt der Anonymisierung folgenreich. Denn was dadurch auf dem Spiel steht, ist die Erinnerbarkeit der Figur.
Obwohl »Der stumme Prophet« einzig und allein Kargan ins Zentrum stellt, fragt der Erzähler im Vorwort doch, ob dieser »endgültig der Vergessenheit anheimzufallen bestimmt ist« (IV, 776). Weniger ein Bangen um die Reichweite des Romans, zeigt sich hier der prekäre Status einer Figur, der, sofern sie sich gegen die polizeiliche Ordnung sperrt, nur bleibt, »den zivilisierten Teil der Welt nicht mehr freiwillig aufzusuchen« (IV, 776) – und damit auch der Ausschluss aus dem Sozialen. Dieser Gedanke findet sich auch bei Rancière, dessen Überlegungen zum Verhältnis von Politik und Polizei bei Aristoteles’ Bestimmung des Menschen als
In »Der stumme Prophet« werden mit dem Erzähler einerseits und Friedrich Kargan andererseits zwei unterschiedliche Umgangsweisen mit der Polizei, aber auch zwei verschiedene Vorstellungen von Polizei gegenübergestellt. Der Erzähler kann dieselbe in der Person Grodzki konkret lokalisieren und davon ausgehend dessen Rede durch Verfahren der Literarisierung für seine Zwecke nutzen. Hierin ähnelt er Tunda und ROTH aus »Die Flucht ohne Ende«, die die polizeilichen Sprechakte ebenfalls in den Dienst der Erzählung stellen können. Ausgangspunkt und Bedingung dafür ist die Materialisierung polizeilicher Ordnung im staatlichen Dokument. Im Unterschied dazu erscheint die Polizei für Kargan als unpersönliche und abstrakte Struktur, die sich der Konkretisierung entzieht. Entsprechend flieht er auch nicht vor spezifischen Institutionen oder Personen, sondern vor einer umfassenden Autorität, die sich in einer gewaltsam festschreibenden Schrift ausdrückt. Paradoxerweise bestätigt er damit gerade das polizeiliche Phantasma einer unumstößlichen »Ordnung der Wörter und […] Ordnung der Körper«, in der der »Platz eines jeden«(35) immer schon bestimmt ist. Unmöglich ist in einem derart stabilen Repräsentationsregime allerdings auch eine Wortergreifung im Sinne Rancières. Eine solche bedeutete die »Besetzung eines Ortes« außerhalb der Eigentlichkeit, »wo der
Das Auseinanderfallen von sprachlich-polizeilicher Struktur und konkretem polizeilichem Sprechakt, das in der vergleichenden Lektüre zutage getreten ist, erfordert auch eine Neuperspektivierung der dokumentarischen Literatur Roth’scher Prägung. Pässe, Befehle und polizeiliche Akte stellen in »Die Flucht ohne Ende« und »Der stumme Prophet« Extremfälle des Dokumentarischen dar. Ihre Behauptung von Authentizität wird einerseits als herrschaftssichernde Praxis kritisiert, andererseits nimmt Roth die Durchsetzungskraft eben dieser
Insgesamt zeigt sich so, dass die polizeiliche Dokumentation mitsamt ihren Verfahren und (Sprech-) Akten in Roths literarischen Texten der späten 1920er-Jahre nicht ein Thema unter vielen ist. Bei aller Kritik an staatlichen und literarischen Dokumenten bleiben diese doch irreduzible Bezugspunkte der Romane. Aufgrund ihrer Setzungskraft eröffnen sie den reflexiven Rahmen, um die Möglichkeiten und Begrenzungen sprachlicher Intervention auszuloten. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich sodann eine dokumentarische Literatur ab, die nicht notwendig sibirische Weiten sucht, sondern in der Auseinandersetzung mit der polizeilichen Ordnung deren Brüchigkeit ausstellt. In ihren stärksten Momenten gelingt es in »Flucht ohne Ende« und im »Stummen Propheten« dann auch, über die Tristesse des Gegebenen hinauszuschreiben und den Blick auf mögliche Handlungsräume zu richten.(38)
Joseph Roth: Schluss mit der ›Neuen Sachlichkeit!‹, in: Joseph Roth Werke 3. Das journalistische Werk 1929–1939, hrsg. von Klaus Westermann, Frankfurt a.M. 1989, S. 153–163, hier S. 153. Zitatnachweise aus den Texten Roths werden im Folgenden aus der Werkausgabe unter Angabe der Bandnummer und Seitenzahl direkt im Text angegeben. Vgl. Joseph Roth: Werke in sechs Bänden, hg. von Fritz Hackert/Klaus Westermann, Frankfurt/Main 1989–1991.
Mona Körte: Das gerichtete Gesicht: Pass- und Phantombilder [Kapitel V.], in: dies./Judith Elisabeth Weiss: Randgänge des Gesichts. Kritische Perspektiven auf Sichtbarkeit und Entzug, Paderborn 2017, S. 189–240, hier S. 217.
»Der stumme Prophet« wurde 1965 posthum veröffentlicht. Grundlage für die Buchfassung sind zwei Manuskripte und ein Typoskript aus Roths Nachlass. Roth arbeitete wahrscheinlich zwischen 1927 und 1929 am Roman, zwei Auszüge daraus veröffentlichte er 1929. Vgl. dazu auch die editorischen Angaben in der Werkausgabe (IV, 1070).
Roths Auseinandersetzung mit realistischem bzw. wirklichkeitsbezogenem Schreiben ist in der Forschung in erster Linie als Frage nach der (Nicht-)Zugehörigkeit des Autors zur Neuen Sachlichkeit diskutiert worden. Die längste Zeit wurde »Schluss mit der ›Neuen Sachlichkeit!‹« dabei als entscheidende Zäsur positioniert, über die Roths wirklichkeitsbezogene Texte der 1920er-Jahre gegen die legendenhaft(er)en der 1930er abgegrenzt werden können. Dass der Aufsatz stattdessen eine konzise Zusammenfassung von Roths Poetik bis 1930 präsentiert, haben Jürgen Heizmann, Reiner Wild, Andreas Wirthensohn oder auch Florian Gelzer in detaillierten Lektüren nachgewiesen; ihre Texte umfassen zudem eine Zusammenstellung von Roths (wenigen) poetologischen Äußerungen sowie der zeitgenössischen und späteren Rezeption. Vgl. Jürgen Heizmann, Joseph Roth und die Ästhetik der Neuen Sachlichkeit, Heidelberg 1990; Reiner Wild: Beobachtet oder gedichtet? Joseph Roths Roman ›Flucht ohne Ende‹, in: Sabina Becker/Christoph Weiss (Hg.): Neue Sachlichkeit im Roman. Neue Interpretationen zum Roman der Weimarer Republik, Stuttgart 1995, S. 27–48; Andreas Wirthensohn: Die »Skepsis der metaphysischen Weisheit« als Programm. Das Fragment »Der stumme Prophet« im Lichte von Joseph Roths Romanpoetik, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 72 (1998), S. 268–315; Florian Gelzer, Unzuverlässiges Erzählen als Provokation des Lesers in Joseph Roths »Die Flucht ohne Ende. Ein Bericht«, in: Modern Austrian Literature 43/4 (2010), S. 23–40.
Kerstin Stüssel: In Vertretung. Literarische Mitschriften von Bürokratie zwischen früher Neuzeit und Gegenwart, Tübingen 2004, S. 10. Mit der Darstellung bürokratischer Prozeduren bei Roth, insbesondere den habsburgischen Beamten haben sich beispielsweise Burkhardt Wolf und Sabine Zelger mit Blick auf »Das falsche Gewicht« (1937) beschäftigt. Während Zelger den Roman als kritische Auseinandersetzung mit dem habsburgischen Kolonialismus im Osten des Reiches liest, hebt Wolf hervor, dass die bürokratischen Praxen und mithin die Beamten weniger autoritär-kolonialisierend wirken, als dass sie aufgrund ihrer »Kunst unentwegten Ermessens und Abwägens« Statthalter eines Roth-spezifischen Habsburg-Mythos’ abgeben. Vgl. dazu Burkhardt Wolf: Maßverhältnisse des habsburgischen Mythos, in: Desiree Hebenstreit et al. (Hg.): Austrian Studies: Literaturen und Kulturen. Eine Einführung, Wien 2020, S. 211–221, hier S. 219; Sabine Zelger: Der tödliche Fortschritt des imperialistischen Systems. Joseph Roth: Das falsche Gewicht, in: dies.: Das ist alles viel komplizierter, Herr Sektionschef! Bürokratie – literarische Reflexionen aus Österreich, Wien 2009, S. 125–150.
Einen detaillierten Überblick über die nationalstaatliche Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg sowie über sich verändernde Konzepte von Nationalstaatlichkeit gibt beispielsweise Telse Hartmann. Vgl. Telse Hartmann: Kultur und Identität. Szenarien der Deplatzierung im Werk Joseph Roths. Tübingen 2006, S. 33–43. Thomas Rahn weist darüber hinaus darauf hin, dass die vormals »liberale Praxis der europäischen Staaten […] mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs [endete]« und »nach dem Krieg nicht wieder aufgenommen [wurde]; der strenge Passzwang war wieder obligatorisch«. Thomas Rahn: Aufhalter des Vagabunden: Der Verkehr und die Papiere bei Joseph Roth, in: Hans Richard Brittnacher/Magnus Klaue: Unterwegs. Zur Poetik des Vagabundentums im 20. Jahrhundert, Köln 2008, S. 109–125, hier S. 116.
Ute Gerhard: Von Paßfälschern und Illegalen – Literarische Grenzüberschreitungen bei Joseph Roth, in: Thomas Eicher/Peter Sowa (Hg.): Joseph Roth: Grenzüberschreitungen, Oberhausen 1999, S. 65–87, hier S. 80.
Körte: Das gerichtete Gesicht, S. 211.
Rahn bezieht sich hier auf Schlegels Ausführungen in der 1812 gehaltenen Vorlesungen zur »Geschichte der alten und neuen Literatur«. Vgl. dazu Rahn: Aufhalter des Vagabunden, S. 114–115.
Rahn: Aufhalter des Vagabunden, S. 121.
Körte: Das gerichtete Gesicht, S. 212.
»Die Flucht ohne Ende« galt die längste Zeit als paradigmatisches Beispiel dokumentarischen bzw. neusachlichen Schreibens, wenngleich Roth selbst dieser Zuordnung bereits in »Es lebe der Dichter!« (1929) widersprochen hat. Der Erfolg des Vorworts, so führt er hier aus, verdanke sich »einem absoluten Mißverständnis«, denn »bei dem Ruf nach dem Dokumentarischen [war] durchaus nicht die berühmte ›Neue Sachlichkeit‹ gemeint […], die das Dokumentarische mit dem Kunstlosen verwechseln möchte« (III, 45). Hier zeigt sich einmal mehr, dass »Schluss mit der ›Neuen Sachlichkeit!‹« keineswegs in Kontrast zu »Die Flucht ohne Ende« steht, sondern geradezu eine Lektüre-Anleitung für den Roman bereitstellt. Vgl. dazu auch die Hinweise in Anm. 4.
Neben dem Namen und der Nationalität wurden auf einem österreichischen Pass der Ersten Republik der Beruf, das Geburtsdatum, Geburts- und Wohnort sowie äußere und besondere Kennzeichen angegeben. Vgl. dazu Peter Becker: Umstrittene Formulare. Der Reisepass in der internationalen Debatte der 1920er-Jahre, in: Peter Plener/Niels Werber/Burkhardt Wolf (Hg.): Das Formular, Berlin 2021, S. 103–122, hier S. 113.
Johann Gottlieb Fichte: Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre, hrsg. von Manfred Zahn, Hamburg 1991 [1796], S. 289, Herv. i. O.
Vgl. René Ahlberg: Das sowjetische Paßsystem: Ein Instrument bürokratischer Herrschaft, in: Osteuropa 41/8 (1991), S. 802–817, hier S. 804. Dies könnte auch der Grund dafür sein, dass der osteuropäische Raum bei Roth als ein »restutopische[r] Raum« entworfen wird, wie Rahn treffend bemerkt. Rahn: Aufhalter des Vagabunden, S. 113.
Rahn: Aufhalter des Vagabunden, S. 118. Rahn zeichnet hier Roths satirische Angriffe auf das staatliche Namens-Regime in der Serie »Juden auf Wanderschaft« nach. Da sich insbesondere die jüdischen Namen gegen die staatlich verlangte Form des Namens sperren, sind ihre Träger*innen den Behörden besonders suspekt: »Gefährlicher noch als die ungeregelte Bewegung der ›realen‹ Individuen erscheint dem polizeilichen Blick, so suggeriert es Roth, die Offenheit bzw. Herkunftslosigkeit des Namens, der Namensnomadismus.« (119)
Rahn: Aufhalter des Vagabunden, S. 124. Rahn erinnert in diesem Zusammenhang an eine mindestens so pointierte wie witzige Passage aus dem Text »Für die Staatenlosen«: »Denn es ist bekannt, daß ein Dokument nur entstehen kann auf Grund eines anderen, bereits vorhandenen – und daß die Entstehung des aller-allerersten Dokuments ein eigenes Kapitel der Schöpfungsgeschichte beanspruchen würde.« (III, 135)
Vgl. dazu Anm. 5. Auch wenn die Darstellung des Konsuls in »Die Flucht ohne Ende« stellenweise ins Lächerliche kippt, nimmt Roth mit diesem Staatsdiener, der dem Dialekt mehr traut als den Dokumenten, genau den bei Wolf beschriebenen Typus des maßnehmenden Beamten vorweg.
Cornelius Castoriadis: Gesellschaft als imaginäre Institution. Entwurf einer politischen Philosophie, übers. von Horst Brühmann, Frankfurt/Main 1990.
Der Begriff wird hier der geschichtswissenschaftlichen Forschung entlehnt, wo er personenbezogene Quellen bezeichnet, »in denen ein Mensch Auskunft über sich selbst gibt, unabhängig davon, ob dies freiwillig – also etwa in einem persönlichen Brief, einem Tagebuch, einer Traumniederschrift oder einem autobiographischen Versuch – oder durch andere Umstände bedingt geschieht«. Winfried Schulze: Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen für die Tagung »EGO-DOKUMENTE«, in: ders. (Hg.): Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte?, Berlin 1996, S. 11–30, hier S. 21.
Die »Diskrepanz zwischen den ›tatsächlichen‹ Ereignissen und Tundas eigener Version« der Ereignisse wirft nach Gelzer, der die Widersprüche und Unzuverlässigkeiten im Roman detailliert herausgearbeitet hat, »ein bedenkliches Licht auf seine Erzählungen«. Aus diesem Grund positioniert Gelzer den Text auch näher an den sprachkritischen Werken der Wiener Moderne als an der Neuen Sachlichkeit. Gelzer: Unzuverlässiges Erzählen, S. 31.
Bis Mitte der 1920er-Jahre verfasste Roth im weitesten Sinn engagierte Beiträge für unterschiedliche Zeitungen im Kontext der Arbeiter*innen-Bewegung, beispielsweise den »Vorwärts« in Deutschland oder die »Arbeiter-Zeitung« in Wien. Gelegentlich unterschrieb er diese Beiträge als der »Rote Joseph«. Vgl. dazu bspw. die frühe Studie von Ingeborg Sültemeyer: Das Frühwerk Joseph Roths. 1915–1926. Studien und Texte, Wien 1976.
Vgl. dazu beispielsweise Joseph Strelka, der den »Stummen Propheten« als einen »Roman im traditionellen Stil« liest, in dem Roth »in korrekter Vorausschau vorweg[nimmt], was Andrej Sinyavsky mehr als ein halbes Jahrhundert später in seiner Darstellung der Sowjet-Zivilisation dargelegt hat«. Joseph Strelka: Die beredten Vorhersagen des »Stummen Propheten«. Joseph Roths Roman der russischen Revolution, in: Alexander Stillmark (Hg.): Joseph Roth. Der Sieg über die Zeit. Londoner Symposium, Stuttgart 1996, S. 44–61, hier S. 57.
»Über die Verbürgerlichung der Russischen Revolution?«, Vortragsmanuskript vom Januar 1927 (vgl. II, 688–693).
Fichte: Grundlage des Naturrechts, S. 290.
Jacques Rancière: Das Unvernehmen, übers. von Richard Steurer, Frankfurt/Main 2002 [1995].
Rancière: Das Unvernehmen, S. 40.
Rancière: Das Unvernehmen, S. 41.
Rancière: Das Unvernehmen, S. 43.
In »Wirtschaft und Gesellschaft« heißt es dazu: »Es gilt das Prinzip der
Am drastischsten formuliert dies sicherlich Wirthensohn, demzufolge sich Roth in Anschluss an »Der stumme Prophet« in die »Sprachsicherheit, ja Sprachgläubigkeit des Spätwerks« rette. Wirthensohn: Die »Skepsis der metaphysischen Weisheit« als Programm, S. 314.
Vgl. Klaus Peter: Die Stummheit des Propheten. Zu Joseph Roths nachgelassenem Roman, in: Basis. Jahrbuch für deutsche Gegenwartsliteratur 1 (1970), S. 153–167, hier S. 154. Kritisch dazu: Wirthensohn: Roths Romanpoetik, S. 299.
Rancière: Das Unvernehmen, S. 33, Herv. i. O.
Rancière: Das Unvernehmen, S. 34, Herv. i. O.
Rancière: Das Unvernehmen, S. 48.
Rancière: Das Unvernehmen, S. 48.
Auch in »Der stumme Prophet« finden sich Briefe, die Kargan an seine Geliebte Hilde von Märker schreibt, und ein Tagebucheintrag. Beides erweist sich jedoch als gleichermaßen dysfunktional wie problematisch. Beim Tagebucheintrag wird die Gattungskonvention insofern unterlaufen, als dieser mit einem sehr langen direkten Zitat von einem Genossen Kargans beginnt, das zugleich eine Rechtfertigung für das Tagebuchschreiben umfasst; seinen ersten Brief an Hilde wird Kargan vor ihren Augen zerreißen (vgl. IV, 815), ein weiterer wird erst mit vier Jahren Verspätung bei ihr eintreffen (vgl. IV, 887), der dritte und letzte Brief schließlich kann ohne zusätzliche mündliche Erklärung nicht verstanden werden (vgl. IV, 920).
Die Überlegungen in diesem Aufsatz konnte ich in unterschiedlichen Kontexten präsentieren und diskutieren, was einen unverzichtbaren Beitrag zu dessen schlussendlicher Form geleistet hat. Ich danke Burkhardt Wolf und den Teilnehmer*innen des Wiener Colloquiums für ihre instruktiven Hinweise, ebenso den Teilnehmer*innen des Author-Workshops, den das Herausgeber*innen-Team dieser Ausgabe organisiert hat und in dessen Rahmen eine erste Version des Textes besprochen werden konnte. Maddalena Casarinis Begeisterung für (falsche) Pässe und den Gesprächen mit Rafael Jakob und Annika Klanke verdanke ich weitere wichtige Impulse. Zu guter Letzt bedanke ich mich herzlich bei der*m anonymen Gutachter*in für die genaue Lektüre und die konstruktiven Anmerkungen, die nicht nur geholfen haben, die Überlegungen umfassender zu kontextualisieren, sondern auch den letzten Anstoß für die thematische Zuspitzung gegeben haben.