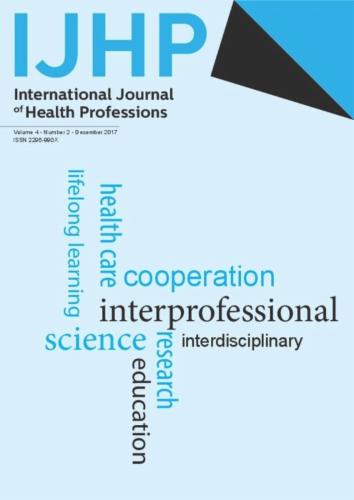Presenteeism and team culture: a qualitative study of health care and office professionals / Präsentismus und Teamkultur: eine qualitative Befragung von Gesundheit- und Bürofachpersonen
Published Online: May 05, 2025
Page range: 1 - 14
Received: Mar 16, 2023
Accepted: Jan 27, 2025
DOI: https://doi.org/10.2478/ijhp-2025-0001
Keywords
© 2025 Flurina Anna Klopfenstein et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Arbeiten trotz Krankheit – ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und als Präsentismus bezeichnet wird (Oster & Mücklich, 2019). Präsentismus kann schwerwiegende negative Auswirkungen sowohl auf Unternehmen als auch auf Mitarbeitende und Kundinnen und Kunden haben. Dazu gehören die Übertragung von Krankheitserregern, fehlerhaftes Arbeiten, verminderte Arbeitsqualität und ein erhöhtes Risiko von Arbeitsunfällen (Lohaus & Habermann, 2018). Diese Faktoren führen nicht nur zu einer Einschränkung der Produktivität, sondern auch zu erheblichen betriebs- und volkswirtschaftlichen Verlusten (Solf, 2019). Studien zeigen, dass die wirtschaftlichen Einbußen durch Präsentismus doppelt so hoch sind wie durch Absentismus, das Fernbleiben vom Arbeitsplatz (Solf, 2019).
Ein wesentlicher Anteil der Erwerbstätigen ist in verschiedenen Berufsgruppen von Präsentismus betroffen (Hägerbäumer, 2017; Oster & Mücklich, 2019). Besonders im Gesundheitswesen tritt Präsentismus häufig auf (Oster & Mücklich, 2019), insbesondere bei Berufsgruppen mit direktem Patientenkontakt, die die höchste Prävalenz aufweisen (Solf, 2019). Mögliche Gründe hierfür sind unter anderem moralische Verpflichtungen und Personalmangel (Kinman, 2019). Eine Untersuchung zeigt, dass Präsentismus bei Pflegefachpersonen aufgrund von Schuldgefühlen und mangelnden Personalressourcen besonders häufig vorkommt, was negative Folgen für die Patientenversorgung, das Arbeitsumfeld und die Gesundheit der Pflegefachpersonen hat (Rainbow, 2019).
Gesundheitsfachpersonen (GfP) scheinen somit vermehrt von Präsentismus betroffen zu sein. Im Gegensatz dazu zeigen Bürofachpersonen (BfG), insbesondere im Bereich der Informationstechnologie, eine geringere Prävalenz von Präsentismus (Solf, 2019). Allerdings gibt es nur wenige Daten über den Zusammenhang zwischen Homeoffice und Präsentismus (Solf, 2019). Es ist denkbar, dass BfG häufig trotz Krankheit im häuslichen Umfeld arbeiten (Solf, 2019). Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeitende, die Mobile Office (im Sinne von Homeoffice) nutzen, häufiger Präsentismus zeigen als diejenigen, die an einer zentralen Betriebsstätte arbeiten (Strasser & Varesco Kager, 2018). Dies könnte durch die fehlende räumliche Distanz zum Arbeitsequipment und die empfundene Unverzichtbarkeit der eigenen Person erklärt werden (Dahlke et al., 2018).
Ein tieferes Verständnis für die Entscheidungsmuster, die Mitarbeitende zu Präsentismus oder Absentismus bewegen, bietet das Modell von Lohaus et al. (2021). In diesem Modell werden die beeinflussenden Faktoren, die die Entscheidung für Präsentismus oder Absentismus bestimmen, in distale (ferne) und proximale (nahe) Variablen unterteilt. Zu den distalen Variablen gehören unter anderem Politik, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Gesetzgebung. Die proximalen Variablen, die unmittelbarer auf die Entscheidung einwirken, werden weiter in personenbezogene, arbeitsbezogene und organisationale Faktoren gegliedert. Die Teamkultur, als Teil der organisationalen Faktoren, spielt dabei eine wesentliche Rolle, da sie das Verhalten von Mitarbeitenden in Bezug auf Präsenz oder Abwesenheit bei Krankheit maßgeblich beeinflussen kann. Sowohl GfP als auch BfP arbeiten häufig in Teams, die durch gegenseitige Abhängigkeit und ein gemeinsames Ziel gekennzeichnet sind (Kauffeld, 2014). Die Teamkultur am Arbeitsplatz und die Teamstruktur werden als beeinflussende Faktoren für Präsentismus genannt (Steinke & Badura, 2011). Ebenso wird die Gesundheitskultur als Risikofaktor beschrieben, wobei eine gesundheitsorientierte Kultur Präsentismus senken kann (Hägerbäumer, 2017).
Obwohl die bestehende Literatur darauf hinweist, dass die Teamkultur am Arbeitsplatz das Auftreten von Präsentismus beeinflussen kann, fehlen Studien, die sich mit der Rolle der Teamkultur in unterschiedlichen Berufsgruppen und deren Zusammenhang mit Präsentismus befassen. Insbesondere gibt es keine Untersuchungen, die die Teamkulturen von Berufsgruppen, die nachweislich in unterschiedlichem Maße von Präsentismus betroffen sind, miteinander vergleichen. Diese Lücke in der Forschung bietet die Gelegenheit, ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen zu entwickeln und eine Grundlage für präventive Maßnahmen zur Reduzierung von Präsentismus zu erarbeiten.
Die vorliegende Studie hat zum Ziel, zu untersuchen, wie GfP und BfP ihre Teamkultur im Zusammenhang mit Präsentismus erleben und inwiefern sich ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen unterscheiden. Dies soll dazu beitragen, die spezifischen Einflussfaktoren in unterschiedlichen Arbeitsumfeldern besser zu verstehen.
Ausgehend von diesem Ziel wurden eine Haupt- und eine Subfragestellung formuliert:
Wie erleben Gesundheits- und Bürofachpersonen ihre Teamkultur in Zusammenhang mit Präsentismus?
Inwiefern unterscheiden sich die Teamkulturen von Gesundheits- und Bürofachpersonen bezüglich Präsentismus?
Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein qualitativ deskriptives Forschungsdesign gewählt. Dieses Design eignet sich besonders gut im Bereich der Gesundheitsforschung, da es sachliche Antworten auf Fragen in Bezug auf die Wahrnehmung der Teilnehmenden liefert und einfache Beschreibungen von Erfahrungen und Wahrnehmungen erlaubt (Colorafi & Evans, 2016). Die «COREQ-Checkliste» (Consolidated criteria for Reporting Qualitative Research) (Tong et al., 2007) wurde verwendet, um die Qualität und Transparenz des Forschungsprozesses sicherzustellen. Die Studie wurde im Rahmen einer Master-Thesis durchgeführt und war Teil des Forschungsprojektes «Occupational Health Management and Presenteeism among Swiss employees» (Golz et al., 2023). Das Forschungsteam bestand aus fünf Personen, darunter drei Frauen und zwei Männer, alle aus den Bereichen Pflege und Gesundheitswissenschaften. Die Erstautorin (FAK), war zum Zeitpunkt der Studie als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und verfügte über mehrjährige Berufserfahrung als diplomierte Pflegefachfrau sowie Erfahrung in der Durchführung von Interviews. FAK war hauptverantwortlich für die Datenerhebung, -analyse und -interpretation. Sie wurde vom Forschungsteam (KAP, CE, CHG, RB) durch regelmäßiges Coaching und Projektsitzungen unterstützt, wobei das Forschungsteam die kontinuierliche Begleitung und methodische Beratung sicherstellte.
Für die Studie wurden Mitarbeitende in den Bereichen der GfP und BfP im Zeitraum von September bis November 2021 angefragt. Die Rekrutierung der Interviewteilnehmenden erfolgte mittels Gelegenheitsstichprobe. Im Bereich der GfP wurden Pflegefachpersonen, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Hebammen sowie Ärztinnen und Ärzte angefragt, die bei ihrer Arbeit direkten Kontakt mit Patientinnen und Patienten haben. Für die GfP war die physische Anwesenheit am jeweiligen Arbeitsplatz unabdingbar und Homeoffice mehrheitlich keine Möglichkeit. Die BfP wurden in Versicherungen, Banken und Verwaltungen rekrutiert. Auf eine Differenzierung der Berufsgruppen bei den BfP wurde verzichtet, da die Berufsbezeichnungen unabhängig von der Ausbildung oft stark variieren. Eingeschlossen wurden BfP, deren Tätigkeit keinen permanenten Kontakt mit Kundinnen und Kunden vor Ort erforderte und Homeoffice somit möglich war.
Für die Rekrutierung wurde auf das Netzwerk des Forschungsteams zurückgegriffen. Eingeschlossen wurden Mitarbeitende, welche seit mindestens einem Jahr berufstätig waren und seit drei Monaten zu mindestens 50 % in einem Team arbeiteten. Grund dafür war, dass die Teilnehmenden die Arbeitswelt im Allgemeinen und auch die Teammitglieder in einem Mindestmaß kennen sollten. Vorliegende Studie konzentriert sich auf das Erleben der Basisteammitglieder, weshalb keine Führungspersonen befragt wurden. Da bei den Interviews sehr persönliche Ansichten und Verhaltensweisen erfragt wurden, die u. U. Auswirkungen auf andere Menschen haben können, wurden Personen ausgeschlossen, die im selben Arbeitsteam wie die Interviewerin arbeiten oder die zu deren nahem privaten Umfeld zählen.
Eine erste Kontaktaufnahme erfolgte telefonisch oder schriftlich per E-Mail oder Kurznachricht. Äusserten die angefragten Personen Interesse, wurde ihnen eine schriftliche Studieninformation und Einverständniserklärung zugestellt. Die Dokumente enthielten Informationen zum Ziel und Ablauf der Studie, zur Verwendung der Daten sowie die Kontaktangaben der Interviewerin.
Die Datensammlung erfolgte durch halbstrukturierte Leitfadeninterviews, die von FAK in Einzelsettings mit den GfP und BfP durchgeführt wurden.
Der Interviewleitfaden wurde nach dem Prinzip von Kurse (2015) aufgebaut. Zunächst wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um die wichtigsten Konzepte und Einflussfaktoren im Zusammenhang mit Präsentismus zu identifizieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen und dem Modell von Lohaus et al. (2021) wurden drei Hauptthemen definiert, da es die zentralen Themenbereiche von Präsentismus strukturiert und eine systematische Analyse ermöglicht: Kranksein/Krankheitsabsenzen, Präsentismus am Arbeitsplatz und mögliche Einflussfaktoren.
Die inhaltlichen Aspekte des Interviewleitfadens wurden auch auf Grundlage der Arbeiten von Rieger (2018) und Diel und Schmitt (2010) entwickelt. Diese entwickelten Fragebögen zur Teamkultur, der Fragen zur Arbeitsatmosphäre, Rivalität und Konkurrenz (Diel & Schmitt, 2010) sowie zur Kooperationsbereitschaft (Rieger, 2018). Die darin abgefragten Aspekte, wie das Respektieren anderer Meinungen oder das sich auf andere Verlassen, wurden in übergeordnete und offene Fragen umformuliert: «Wie reagiert das Team, wenn sich jemand krankmeldet?» oder «Gibt es in Ihrem Team Verhaltensweisen oder Haltungen, welche dazu führen, dass Mitarbeitende krank zur Arbeit kommen?» (Anhang A).
Die Teilnehmenden sollten zuerst an die Thematik Präsentismus herangeführt werden, indem der Leitfaden zunächst allgemeine Fragen zu den Bereichen Kranksein und Absenzen stellte. Diese dienten dazu, das Verständnis und die individuellen Erfahrungen der Teilnehmenden in diesen Bereichen zu ermitteln. Anschliessend wurden gezielte Fragen zur Problematik Präsentismus und den potenziellen Einflussfaktoren gestellt, um die Tiefe und Breite des Themas aus Sicht der Teilnehmenden zu erfassen. Die Leitfragen wurden durch Aufrechterhaltungsfragen und konkrete Nachfragen ergänzt (Kurse, 2015). Der Interviewleitfaden wurde mit insgesamt fünf Testpersonen aus unterschiedlichen Berufssettings auf Verständlichkeit, Inhalt sowie Zeitdauer geprüft und entsprechend den jeweiligen Erkenntnissen adaptiert.
Die Interviews wurden im deutschen oder schweizerdeutschen Dialekt der Teilnehmenden und je nach Wunsch per Videocall in Microsoft Teams oder an einem geeigneten, physischen Treffpunkt durchgeführt. Einleitend wurden soziodemografische Merkmale erfragt und festgehalten. Anschließend wurden die Interviews gestartet und mittels Video- oder Audioaufnahme aufgezeichnet. Bei den letzten Interviews konnten nur noch wenige neue Erkenntnisse gewonnen werden, was darauf hinweist, dass die Datensättigung nahezu erreicht war. Daher wurde die Datenerhebung nach insgesamt 16 Interviews abgeschlossen.
Alle Interviewaufnahmen wurden von FAK nach den Regeln der inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing and Pehl (2018) transkribiert. Die Datenanalyse erfolgte durch FAK nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalysen von Kuckartz (2018), um das Erleben der Teamkultur von GfP und BfP im Zusammenhang mit Präsentismus zu untersuchen. Diese Methode ermöglichte es, relevante Themen systematisch zu identifizieren und zu analysieren. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) umfasst drei Auswertungsverfahren. In der ersten Phase wurden die Transkripte mehrfach gelesen, relevante Textstellen markiert und Notizen in Form von Memos angefertigt. Auf Basis der Forschungsfrage, des Interviewleitfadens und unter Berücksichtigung des Präsentismus Framework-Modells von Lohaus and Habermann (2019) wurden die deduktiv gebildeten Hauptkategorien (Kranksein/Krankheitsabsenzen, Präsentismus am Arbeitsplatz und mögliche Einflussfaktoren) verwendet, um das gesamte Datenmaterial in einem ersten Durchgang zu codieren. Die Subkategorien wurden in einer weiteren Phase durch die akribische Bearbeitung des Datenmaterials gebildet, wobei alle Textstellen codiert wurden. Die anfänglich große Anzahl von Codes wurde durch stetige Überarbeitung zusammengefasst und auf wesentliche Kategorien reduziert. Abschließend wurde ein finales Kategoriensystem, welches im Ergebnisteil aufgeführt wird, auf das gesamte Datenmaterial angewendet. Die Codierung erfolgte mithilfe der Software MAXQDA.
Die interne Studiengüte wurde anhand einer Checkliste von Kuckartz (2018) geprüft, welche einerseits die Qualität der Datenerfassung und Transkription und andererseits die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse beleuchtet. Die Zuverlässigkeit der Datenanalyse wurde zudem mittels konsensuellen Codierens nach Kuckartz (2018) erhöht. Umgesetzt wurde dies, indem zwei Forschende (CHG und RB) über das Code-System instruiert wurden und anschließend ausgewählte Sequenzen der Interviewdaten codierten. Die Rückmeldungen wurden verglichen und für das weitere Analyseverfahren berücksichtigt. Die externe Studiengüte wurde durch regelmäßiges Coaching mit der Erstgutachtenden (KAP) gewährleistet, um methodische Fragen zu klären und die Analyse konsequent an den Forschungszielen auszurichten. Master-Thesis-Kolloquien und Projektsitzungen mit dem Forschungsteam (KAP, CE, CHG, RB) boten die Gelegenheit, das Forschungsvorgehen kontinuierlich zu reflektieren und Feedback zur methodischen Ausrichtung zu erhalten, um die Robustheit der Studie zu gewährleisten. Zudem wurden mit einer Interviewteilnehmerin pro Bereich (GfP und BfP) ein Member Checking nach Kuckartz (2018) durchgeführt, bei dem die Analyseergebnisse besprochen wurden. Die Rückmeldungen aus dem Member Checking waren kongruent mit den Resultaten der Analyse.
An der Studie haben insgesamt 16 Personen im Alter zwischen 26 und 51 Jahren (Mittelwert: 34.9 Jahre) aus der deutschsprachigen Schweiz teilgenommen. Die Teilnehmenden setzten sich aus jeweils acht GfP und acht BfP zusammen. Innerhalb beider Gruppen waren jeweils 6 Frauen und 2 Männer vertreten. Zum Zeitpunkt des Interviews waren die Teilnehmenden seit durchschnittlich viereinhalb Jahren an ihrem derzeitigen Arbeitsort tätig. Sieben der 16 Teilnehmenden gaben an, dass es ihnen in ihrem Team gut gefalle und neun beschrieben die Teamsituation gar als sehr gut. Die Interviews dauerten durchschnittlich 31,6 Minuten. Der Tabelle 1 sind die jeweiligen Berufsbezeichnungen und Arbeitssettings sowie die Teamgrößen der Interviewteilnehmenden zu entnehmen.
Interviewteilnehmende nach Bereich, inkl. Berufsbezeichnung, Arbeitssetting und Teamgröße
| 1 | GfP1 | Diplomierter Pflegefachmann | Spitex-Organisation | 40 |
| 2 | GfP | Expertin Intensivpflege | Zentrumsspital | 45 |
| 3 | GfP | Hebamme | Zentrumsspital | 20 |
| 4 | GfP | Hebamme | Universitätsspital | 40 |
| 5 | GfP | Assistenzärztin | Zentrumsspital | 40 |
| 6 | GfP | Assistenzarzt | Stadtspital | 8 |
| 7 | GfP | Physiotherapeutin | Zentrumsspital | 55 |
| 8 | GfP | Physiotherapeutin | Praxis | 16 |
| 9 | BfP2 | Externe Vermögensverwalterin | Finanzbranche | 5 |
| 10 | BfP | Investmentberater | Finanzbranche | 14 |
| 11 | BfP | Umzugskoordinator | Bundesverwaltung | 3 |
| 12 | BfP | Juristin | Bundesverwaltung | 12 |
| 13 | BfP | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Kantonsverwaltung | 7 |
| 14 | BfP | Juristin | Versicherung | 7 |
| 15 | BfP | Mitarbeiterin SPOC3 | Versicherung | 5 |
| 16 | BfP | Juristin | Versicherung | 18 |
GfP= Gesundheitsfachpersonen,
BfP = Bürofachpersonen,
SPOC = Single Point of Contact)
Die zentralen Ergebnisse zum Erleben der Teamkultur von GfP und BfP im Zusammenhang mit Präsentismus werden in drei Haupt- und insgesamt neun Subkategorien beschrieben.
Fast alle Teilnehmenden beschrieben körperliche Beschwerden als zentral für ihr Krankheitsverständnis, wobei GfP häufiger die Auswirkungen auf ihre Arbeitsleistung betonten, während BfP dieses Thema seltener ansprachen.
Die Teilnehmenden wurden gefragt, was für sie Kranksein bedeutet. Insgesamt 15 Teilnehmende nannten körperliche Symptome wie Schmerzen, Fieber oder Magen-Darm-Beschwerden. Acht von ihnen brachten die Bedeutung von Kranksein zudem mit einer verminderten Leistungsfähigkeit bei der Arbeit in Verbindung, wobei dieser Aspekt mehrheitlich von den GfP (n=6) diskutiert wurde.
Beide Berufsgruppen äusserten, dass es nicht immer klar sei, ab wann man krank ist. Die Teilnehmenden gaben ausserdem zu verstehen, dass sie sich im Verlauf des Tages unterschiedlich gesund fühlen können und nicht immer wissen, ob sie noch krank werden. Dazu sagte eine BfP:
Die Interviewteilnehmenden beschrieben überwiegend konstruktive oder neutrale Reaktionen auf Krankmeldungen. GfP berichteten jedoch häufiger von zusätzlichem Teamstress und vorwurfsvollen Reaktionen der Vorgesetzten, während BfP eher ein Desinteresse ihrer Vorgesetzten wahrnahmen.
13 Teilnehmende (GfP und BfP) beschrieben die Reaktionen ihrer Teamkolleginnen und Teamkollegen als konstruktiv oder neutral, wenn sich jemand krankmeldet. Zugleich erwähnten elf Personen, dass über die erkrankte Person gesprochen wird: Die Hälfte (n=4) der BfP nannte Beispiele, bei denen es darum ging, wie oft die betroffene Person krank ist oder zu welchem Zeitpunkt. Folgende Aussage verdeutlicht beide Aspekte:
Die Hälfte (n=4) der GfP erwähnte ähnliche Reaktionen; der Zeitpunkt der Krankmeldung wurde jedoch nur von einer GfP thematisiert. Fünf GfP beschrieben verbale Reaktionen auf Krankheitsabsenzen, dass durch die Krankheitsabsenz einer Person, das Team noch mehr zu tun hat als sonst. Zudem berichteten vier Befragte von nonverbalen Gesten wie Augenrollen als Reaktion auf Krankheitsabsenzen.
12 Teilnehmende empfanden die Reaktion der Vorgesetzen auf Krankheitsmeldungen als angenehm und professionell. Drei GfP sagten jedoch, dass sie bereits bei der telefonischen Abmeldung eine vorwurfsvolle Reaktion erlebten oder das Gefühl hatten, sich rechtfertigen zu müssen. Vier GfP sagten, dass sie durch direkte oder indirekte Aussagen der Vorgesetzen deren Mehraufwand und Stress spüren würden. Eine GfP beschrieb:
Die BfP stellen bei ihren Vorgesetzten keinen zusätzlichen Stress durch Krankheitsabsenzen fest. Jedoch stellten zwei BfP bei ihren Teamleitungen ein allgemeines Desinteresse fest, denn:
Die Wahrnehmung der Krankheitsursachen unterscheidet sich zwischen GfP und BfP nur geringfügig. Während GfP tendenziell strenger bei der Bewertung von Krankheitsursachen sind, zeigen BfP häufiger Verständnis für verschiedene Krankheitsgründe. Eine GfP meinte dazu:
Zehn Teilnehmende gaben zu verstehen, dass sie bei gewissen Krankheitsursachen weniger Verständnis für die Absenz eines Teammitglieds haben, weil sie selbst in dieser Situation arbeiten würden.
Jeweils drei BfP und GfP bemerkten, dass die Krankheitsursache nicht bei allen im Team gleich gewertet wird. Insbesondere bei Mitarbeitenden, die häufiger oder an bestimmten Tagen krank sind, scheint Skepsis aufzutauchen. Die Abbildung 2 zeigt Krankheitsursachen, die von GfP und BfP in ihren Teamkulturen unterschiedlich akzeptiert werden. Die Ursache einer Krankheitsabsenz ist jedoch nicht für alle Teilnehmenden relevant. Zwei GfP und vier BfP gingen davon aus, dass in ihrem Team eigentlich alle Gründe akzeptiert werden oder die Ursache nicht thematisiert wird.

Haupt- und Subkategorien zur Beantwortung der Fragestellung, wie Gesundheits- und Bürofachpersonen ihre Teamkultur in Zusammenhang mit Präsentismus erleben (eigene Darstellung)

Krankheitsursachen, die in den verschiedenen Teamkulturen gute oder geringe Akzeptanz finden. In Klammer ist aufgeführt, von wie vielen Personen das jeweilige Beispiel genannt wurde (1GfP = Gesundheitsfachpersonen, 2BfP = Bürofachpersonen, [eigene Darstellung])
Die Haltung zu Präsentismus wird von den meisten Teilnehmenden als problematisch wahrgenommen. GfP und BfP sind sich einig, dass kranke Mitarbeitende zu Hause bleiben sollten, doch unterscheiden sich in der Wahrnehmung der Problematik und den Erwartungen an Arbeitsleistung und Durchhaltevermögen.
Die Mehrheit (n=14) betrachten Präsentismus in ihrem Team als ein großes Problem. Eine GfP sagte:
Eine GfP und eine BfP meinten hingegen, dass Präsentismus in ihrem Team kaum vorkomme. Die GfP ergänzte:
Grundsätzlich waren sich alle GfP und BfP einig, dass jemand, der wirklich krank ist, zu Hause bleiben und nicht arbeiten sollte. Bei manchen Teilnehmenden (n=6) zeigte sich hinsichtlich Arbeitsleistung und Durchhaltevermögen zudem eine gewisse Erwartungshaltung – sowohl sich selbst wie auch dem Team gegenüber. Fünf Personen brachten die Haltung zum Thema Präsentismus damit in Verbindung, wie man aufgewachsen ist und was man für ein Verhalten erlernt hat. Eine BfP sagte:
GfP (n=5) und BfP (n=4) berichteten, dass aufgrund der Covid-19 Pandemie in manchen Teamkulturen ein Bewusstsein für Präsentismus entstanden sei. Angesichts der Ansteckungsgefahr wurde vermehrt darüber gesprochen, wann man nicht zur Arbeit kommen dürfe und was dies auch auf andere Krankheiten bezogen bedeuten könnte.
GfP und BfP erleben unterschiedliche Reaktionen auf Präsentismus am Arbeitsplatz, wobei GfP häufiger auf Verständnis stoßen, aber auch Intoleranz von Vorgesetzten wahrnehmen, während BfP eine eher gleichgültige Haltung ihrer Vorgesetzten feststellen.
Dreizehn Teilnehmende sagten, dass Personen, die krank am Arbeitsplatz erscheinen, von den Teamkolleginnen und Teamkollegen nach Hause geschickt werden, um sich zu erholen. Eine GfP beschrieb die Reaktionen der Teammitglieder auf kranke Mitarbeitende wie folgt:
Eine GfP sagte, dass sie in ihrem Team mehr Verständnis feststelle, wenn eine Person halbkrank erscheine, als wenn jemand eindeutig krank bei der Arbeit auftauche. Drei GfP verdeutlichten, dass es dem Team nichts bringe, wenn jemand krank arbeiten komme und dann nicht voll einsatzfähig sei. Zudem sei es einfacher, wenn man von Beginn an für Ersatz sorgen und anders planen könne. Jeweils zwei GfP und BfP verwiesen auf die mögliche Ansteckungsgefahr und gaben zu bedenken, dass kranke Mitarbeitende in ihrem Team auch deshalb nicht gerne am Arbeitsplatz gesehen werden. Drei GfP und eine BfP sagten aber auch, dass es in ihrem Team je nach Arbeitslast sehr geschätzt werde, wenn erkrankte Personen trotzdem arbeiten, da man sonst noch mehr zu tun hätte.
Die Hälfte der Teilnehmenden (n=8) sagte, dass die vorgesetzte Person die kranken Mitarbeitenden nach Hause schicke und grundsätzlich verständnisvoll reagieren würde. Eine GfP bezeichnete die Reaktion der Vorgesetzten auf kranke Mitarbeitende als eher intolerant und eine weitere GfP befand es als einfacher, krank zur Arbeit zu kommen, als sich vorher telefonisch abzumelden, denn:
Jeweils zwei der GfP und BfP erzählten, dass die Vorgesetzten wenig Interesse an kranken Mitarbeitenden zeigen und kaum darauf reagieren würden.
GfP wünschen sich mehr Personal und effizientere Krankheitsabmeldungen, während beide Gruppen betonen, dass Vorgesetzte empathischer reagieren und Präsentismus thematisieren sollten.
Acht Befragte meinten, dass eine empathische Reaktion der Vorgesetzten auf Krankheitsabsenzen Präsentismus verringern könnte. Die Hälfte der GfP (n=4) wünschte sich mehr Personal oder ein Auffangnetz für schnellen Ersatz der erkrankten Person, um das schlechte Gewissen bei eigener Krankheit und den Unmut im Team zu verringern. Zwei GfP bemängelten zudem das Prozedere zur Krankheitsabmeldung als hinderlichen Faktor, den man verbessern könnte. Jeweils zwei GfP und BfP erwähnten, dass das System der bezahlten Krankheitstage ausgenutzt werde, als unfair empfunden werde und sie sich ein Umdenken wünschen. Es wurde mehrmals geäussert (n=5), dass die Vorgesetzten in der Pflicht seien, die Thematik «Präsentismus» aufzugreifen.
Dreizehn Teilnehmende wünschen sich, dass offener über Themen wie Kranksein am Arbeitsplatz oder, was Kranksein überhaupt bedeutet, gesprochen würde. Sechs Teilnehmende sagten, dass sie sich ein teamkulturelles und gesellschaftliches Umdenken in der Thematik «Präsentismus» und «Absentismus» erhofften. Eine BfP beantwortete die Frage nach Wünschen wie folgt:
Pflichtgefühl als Grund für Präsentismus wird sowohl bei GfP als auch bei BfP genannt, wobei GfP zusätzlich Verantwortung gegenüber, dem Team und den Patientinnen und Patienten betonen, während BfP häufiger auf die fehlende Stellvertretung und die Notwendigkeit, eigene Aufgaben zu erledigen, hinweisen.
Sieben GfP nannten das Team als Grund, warum sie krank bei der Arbeit erscheinen. Sie gaben zu verstehen, dass sie die Arbeitssituation nicht verkomplizieren wollen und nicht möchten, dass jemand anderes ihre Arbeit übernehmen muss. Zudem sei es oft schwierig, einen Ersatz zu finden. Eine GfP sagte:
Weiter nannten drei GfP die Patientinnen und Patienten als Grund, um krank bei der Arbeit zu erscheinen.
Bei den BfP wurde das Pflichtgefühl dem Team gegenüber von fünf Teilnehmenden genannt. Auch sie gaben an, dass sie die Mitarbeitenden im Team nicht mit der eigenen Arbeit bemühen wollen und dass sie nicht alle ihre Arbeit an jemand anderes abgeben können. Eine BfP beschrieb dies wie folgt:
Bei beiden Berufsgruppen wurde das Pflichtgefühl gegenüber dem Arbeitgeber von jeweils einer Person erwähnt, um krank zu arbeiten.
Beide Gruppen, GfP und BfP, berichten von einer ausgeprägten Sorge um ihre Reputation als Grund für Präsentismus, wobei die GfP stärker unter dem Druck von Vorgesetzten und der Angst vor negativen Konsequenzen leiden.
Die Hälfte (n=8) – gleichmäßig aufgeteilt auf beide Berufsgruppen – ging davon aus, dass ihre Teammitglieder oder auch sie zu Präsentismus neigen, weil sie sich Gedanken um ihre Reputation machen. Man wolle durch eine Krankheitsabsenz nicht schwach erscheinen oder den Eindruck erwecken, die Arbeit nicht machen zu wollen. Die Angst vor einem Imageverlust ist bei neuen Mitarbeitenden zusätzlich erhöht, weil sie sich zuerst beweisen müssen. Eine BfP beschrieb ihre Situation nach sechs Jahren im gleichen Team mit derselben Vorgesetzten folgendermaßen:
Fünf Teilnehmende fürchteten sich zudem vor dem Gerede, hinter ihrem Rücken und davor, dass die Teammitglieder und die vorgesetzte Person schlecht von ihnen denken könnten.
Die Angst vor einer schlechten Reputation wurde auch mit Befürchtungen über Statusverlust, Druck von den Vorgesetzten und Angst vor den Folgen verbunden. Zwei GfP sagten, dass Teammitgliedern, die oft krank sind, empfohlen wurde, das Arbeitspensum zu reduzieren. Eine GfP und eine BfP erwähnten Verwarnungen oder Kündigungen, wenn man sich nicht an die internen Abläufe bei Krankheitsmeldungen halte. Zudem sagte eine BfP, dass es in ihrem Team zu einer Kündigung aufgrund einer längeren Krankheitsabsenz kam und eine weitere BfP erklärte, dass die Anzahl Krankheitstage einen Einfluss auf die Bonusauszahlung habe. In beiden Berufsbereichen wurde von Gesprächen mit den Vorgesetzten oder dem Human Ressort berichtet, die ab einer bestimmten Anzahl Krankheitstage angeordnet würden. Jedoch verneinten auch sechs Befragte, Kenntnisse über Folgen von häufigen Krankheitsmeldungen zu haben.
Die Möglichkeit des Homeoffice beeinflusste die Entscheidungen der BfP zu Präsentismus oder Absentismus, während GfP diese Option nur bedingt hatten. Beide Gruppen erkannten Vor- und Nachteile, wobei BfP Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen Arbeit und Kranksein erlebten.
Alle BfP (n=8) hatten die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Die GfP konnten nicht von zu Hause aus arbeiten, ausser zwei Befragten, die ein kleines Pensum, welches Büroarbeit betrifft, im Homeoffice erledigen konnten. Sechs BfP bestätigten, dass sie sich bei der Entscheidungsfindung zu Präsentismus oder Absentismus von der Möglichkeit des Homeoffice beeinflussen lassen. Eine BfP verneinte eine Beeinflussung und eine BfP sagte, sie lasse sich nur beim Auftreten einer bestimmten Krankheit beeinflussen. Die GfP gingen einstimmig davon aus, dass sie sich von der Möglichkeit des Homeoffice vermutlich beeinflussen lassen würden, wenn sie dort ihrer Arbeit nachgehen könnten.
Die Teilnehmenden waren sich einig, dass Homeoffice Vor- und Nachteile hat. Vorteile waren der entfallende Arbeitsweg, die erhöhte Erholungsmöglichkeit, ein flexibleres und reduziertes Arbeitspensum und bei den GfP die Vermeidung des Patientenkontaktes. Als problematisch wurde die fehlende Abgrenzung von Kranksein und der Arbeit genannt. Manche BfP arbeiteten im Homeoffice, obwohl sie nicht ins Büro gegangen wären. Eine BfP beschrieb das so:
Die vorliegende Studie untersuchte, wie GfP und BfP ihre Teamkultur in Zusammenhang mit Präsentismus erlebten und welche Unterschiede zwischen beiden Berufsgruppen erkennbar sind. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass GfP und BfP ihre Teamkultur in Bezug auf Präsentismus unterschiedlich wahrnehmen, wobei GfP verstärkt negative Konsequenzen und zusätzlichen Stress erleben. Zudem bestehen Unterschiede in den Einflussfaktoren, wie Pflichtgefühl und Reputation, die bei GfP stärker durch Verantwortung gegenüber dem Team und Patientinnen und Patienten sowie durch Druck von Vorgesetzten geprägt sind, während BfP vor allem durch organisatorische Strukturen wie Homeoffice beeinflusst werden. Es wurde auch deutlich, dass der Begriff «Kranksein» schwer zu definieren ist. Obwohl alle GfP und BfP gefragt wurden, was für sie Kranksein bedeutet, ergänzten viele ihre Aussagen, dass es darauf ankomme, wie man Kranksein definiert. Dies entspricht der Auslegung von Hausteiner-Wiehle and Henningsen (2020), welche Kranksein als subjektives Empfinden beschreiben. Die Unsicherheit – ab wann jemand krank ist und damit auch die Legitimation hat, sich krankzumelden – fliesst sowohl bei den GfP wie auch bei den BfP in nahezu alle Ergebniskategorien mit ein und beeinflusst vermutlich auch das Erleben der jeweiligen Teamkultur. Diese Problematik greift auch Hägerbäumer (2017) auf und verweist als Hilfestellung auf ein Stufenmodel, welches krankheitsbedingte Absenzen aufgrund objektiver und subjektiver Kriterien von illegitim über bedingt legitim zu legitim kategorisiert.
Hinsichtlich der Relevanz der Krankheitsursachen fällt auf, dass die meisten Teilnehmenden klar definierte Symptome und Diagnosen als Beschreibung für ihr eigenes Kranksein verwendeten. Die von den GfP und BfP als gut akzeptierte Krankheitsabsenzen umfassen mehrheitlich objektiv messbare Diagnosen und Symptome. Diese objektivierte Beschreibung lässt sich mit der gesetzlichen Formulierung in Verbindung bringen, welche besagt, dass «Krankheit […] eine medizinische Untersuchung oder Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat» (Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts; ATSG, SR 830.1). Es könnte sein, dass die Teilnehmenden das eigene Krankheitsempfinden bewusst oder unbewusst mit möglichst präzisen Symptomen und/oder Diagnosen beschreiben, damit sie sich überzeugend erklären können. Denn obwohl eine offizielle Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit gemäß Lohaus et al. (2021) für den Begriff «Krankheit» nicht ausschlaggebend ist, fordern Arbeitgebende ab dem dritten Krankheitstag meist ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis ein (Wachter, 2024).
Unterschiede zwischen den Berufsgruppen zeigen sich in der Teamkultur kaum. Auffallend ist jedoch, dass unabhängig davon, ob es sich um GfP oder BfP handelt, verschiedene Haltungen zum Phänomen «Präsentismus» bestehen. Manche Teilnehmende sehen Präsentismus als grundsätzliches Problem, während andere befürchten, dass in ihrem Team unbegründeter Absentismus vorkommt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die meisten GfP und BfP eine offenere Kommunikation über die Themen «Präsentismus» und «Kranksein» zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses sowie zur Förderung einer gemeinsamen Haltung wünschen. Dieser Verbesserungswunsch entspricht dem Ansatz von Rieger (2018), welcher besagt, dass die geteilten Werte einer Gruppe als ausschlaggebend gelten, um von einer gemeinsamen Kultur zu sprechen. Zudem machen Diel und Schmitt (2010) ein positives Klima im Team an der Summe der geteilten Vorstellungen fest, inklusive Wertehaltungen. Es scheint somit sinnvoll, dass die verschiedenen Teamkulturen in die Entwicklung und Förderung einer gemeinsamen Haltung investieren.
Hinsichtlich des Verhaltens der Vorgesetzten lässt sich ein Unterschied in den beiden Berufsgruppen erkennen. So reagierten manche Vorgesetzte der GfP mit einer merklichen Stressreaktion auf Krankmeldungen – was mit der Verteilung der Arbeitslast in Zusammenhang stehen könnte – wohingegen einige BfP bei ihren Vorgesetzten ein Desinteresse feststellten. Das Verhalten der vorgesetzten Personen scheint ein zentraler Aspekt zu sein, denn gemäß Lohaus und Habermann (2018) wird Präsentismus durch die Unterstützung von Vorgesetzten reduziert.
Die Ergebniskategorie
Im Hinblick auf die Organisationsstrukturen weist Solf (2019) darauf hin, dass Homeoffice für BfP ein zusätzlicher Faktor bezüglich Präsentismus sein könnte. In vorliegender Studie bestätigte die Mehrheit der befragten BfP, dass sie sich von der Möglichkeit des Homeoffice in der Abwägung für oder gegen Präsentismus beeinflussen lassen. Dieses Ergebnis entspricht bisherigen Untersuchungen, welche besagen, dass Mitarbeitende im Homeoffice häufiger krank arbeiten (Strasser & Varesco Kager, 2018) und grundsätzlich gefährdeter für Präsentismus sind (Seinsche et al., 2021). Die Überlegungen der GfP zum Thema «Homeoffice und Präsentismus» verdeutlichen dies interessanterweise, denn alle GfP gingen davon aus, dass sie sich von der Möglichkeit des Homeoffice vermutlich beeinflussen lassen würden, wenn sie dort ihrer Arbeit nachgehen könnten.
Eine Stärke dieser Studie liegt in der erreichten Datensättigung, die durch 16 Interviews erzielt wurde. Trotzdem weist die Studie gewisse Limitationen auf. Während eines Interviews stellte sich heraus, dass die befragte Person zusätzlich als stellvertretende Teamleitung tätig ist. Somit wurde das Kriterium, wonach keine Führungspersonen in die Studie eingeschlossen werden, nicht vollständig eingehalten. Weiter ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse durch die Covid-19-Pandemie beeinflusst wurden; die Pandemie wurde in der vorliegenden Studie jedoch kaum thematisiert. Die Fragen rund um die Thematik des Homeoffice wurden den GfP in hypothetischer Form gestellt und entsprechend hypothetisch beantwortet, da Homeoffice für sie keine realistische Option darstellt. Dies stellt eine Limitation der Studie dar, da die hypothetischen Antworten der GfP die tatsächlichen Erfahrungen der BfP im Homeoffice nicht vollständig widerspiegeln. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ausgangslagen ist die Vergleichbarkeit der Antworten beider Gruppen eingeschränkt. Zukünftige Studien sollten daher stärker auf reale Arbeitsbedingungen fokussieren oder hypothetische Szenarien so gestalten, dass sie die Praxisnähe erhöhen und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verbessern. Der Begriff «Teamkultur» ist sehr umfangreich und von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Es stellte sich heraus, dass es auch in Zusammenhang mit Präsentismus schwierig ist, die spezifischen Einflüsse der Teamkultur klar abzugrenzen. Dadurch wurden bestimmte Themen, wie die Erwartungen an Anwesenheit und die Bewertung von Krankheitsursachen, besonders beachtet, während andere Aspekte, wie individuelle Bedürfnisse oder Stressfaktoren, vernachlässigt wurden.
Die vorliegende Studie weist darauf hin, dass das Erleben der Teamkultur in Zusammenhang mit Präsentismus von verschiedenen Faktoren – insbesondere dem individuellen Krankheitsempfinden – geprägt ist und eine Beschreibung wie «positiv/negativ» nicht anwendbar ist. Die Beschreibung der verschiedenen Teamkulturen trägt jedoch dazu bei, die Ursachen von Präsentismus bei GfP und BfP besser zu verstehen. Zudem konnten bei der Betrachtung der beiden Berufsgruppen Unterschiede festgestellt werden, die hauptsächlich im Kontext der jeweiligen Organisationsstrukturen zu erklären sind.
Die Ergebnisse lassen erkennen, dass in den Teamkulturen der GfP und BfP ein Gesprächs- und Diskussionsbedarf über Präsentismus, Krankheitsempfinden und die Legitimität von Absentismus besteht. Es ist davon auszugehen, dass eine gemeinsame Haltung die Teamkultur stärkt und das gegenseitige Verständnis verbessern kann. Die Umsetzung in der Praxis könnte, abhängig vom Bedarf und den verschiedenen Organisationsstrukturen, in Form von Themen-Workshops oder integriert in Teamsitzungen und Alltagsgesprächen stattfinden. Führungspersonen haben eine Vorbildfunktion und können durch ihr Verhalten einen positiven Beitrag leisten – sei es hinsichtlich ihres eigenen Krankheitsverhaltens oder im Umgang mit kranken Mitarbeitenden. Offenheit und Gesprächsbereitschaft sind von allen Teammitgliedern gefragt, denn die Entwicklung der Teamkultur ist von jedem abhängig. Weiter zeigt die Studie, dass manche Organisationsstrukturen Risikofaktoren für Präsentismus bergen. Gewissen Faktoren könnte mit Maßnahmen wie einer Stellvertreterregelung, einem Personal-Pool oder der Erhöhung des Personalschlüssels vorgebeugt werden. Weiterer Forschungsbedarf besteht insbesondere im Bereich «Homeoffice». Seit der Covid-19-Pandemie gehört Homeoffice in vielen Berufsgruppen zum Alltag und die Ergebnisse bestätigen, dass Homeoffice als Risikofaktor für Präsentismus ernst genommen werden muss. Ein tieferes Verständnis des Phänomens «Präsentismus» ermöglicht es, gezielte präventive Maßnahmen auf gesellschaftlicher, betrieblicher und individueller Ebene zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen.