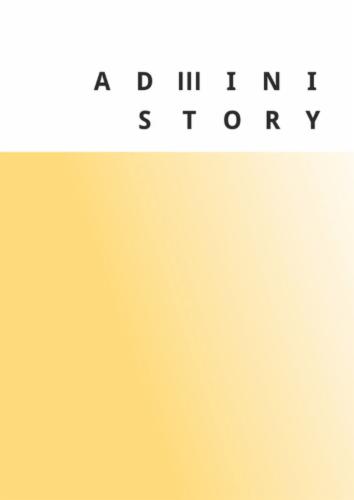Mitschrift revisited: Hans Joachim Schädlichs »Papier und Bleistift« (1971)
Pubblicato online: 09 lug 2025
Pagine: 117 - 126
DOI: https://doi.org/10.2478/adhi-2023-0005
Parole chiave
© 2022 Kerstin Stüssel, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Es muss kein »Federzug« sein, der die Welt »neu erschaff(t)«
(1)
: »Papier und Bleistift« tun es auch: Joachim Schädlichs gleichnamige Erzählung, datiert auf das Jahr 1971 und enthalten im literarischen Debüt des Autors: dem Kurzprosaband »Versuchte Nähe«
(2)
ist eine Schöpfungsgeschichte
Die hier vorgetragene Lektüre von Schädlichs »Papier und Bleistift« führt, nach einer zurückhaltenden Historisierung und Einbindung in die Literatur- und Kulturgeschichte der DDR mit ihrer Trias aus partei-, staats- und volkseigener Bürokratie, zur Revision des von mir 2004 entwickelten Mitschrift-Konzepts. (4)
Am Anfang von »Papier und Bleistift« steht eine Besitzanzeige, die die Relation zwischen Erzählinstanz (in der 1. Person Singular) und ›seinen‹ Objekten, einem Bogen Papier und einem Bleistift markiert. Und sofort folgt eine erzählte Schreibszene (5) (»Auf den Bogen schreibe ich:« (PB 160)), die zwischen kindlicher Selbstvergewisserung und göttlicher Souveränität changiert, und es startet der syntaktische Sprung in eine Binnenerzählung. Statt aber in einem Nebensatz mit einleitender Konjunktion den Inhalt des Schreibens zu referieren, erfolgt dieser Inhalt als Hauptsatz nach einem Doppelpunkt, der gleichermaßen die Mitschrift der Vorschrift und den Start eines Programms markiert. Die Parataxe lässt die narrative Vermittlung in den Hintergrund und die erzählte Welt (Diegese) in den Vordergrund treten. Aus dem Protokoll, das regelhaft vorschreibt, wird ein Mitschrift-Protokoll. Und die schreibende Person wechselt die Rolle. (6)
Mit dem Start der Binnenerzählung bleibt die Frugalität des Anfangs zunächst erhalten: Ein Haus mit leeren Zimmern, das der Ich-Erzähler betritt. Der nächste Schritt ist sachlich und/oder syntaktisch naheliegend; er entspricht gängigen kognitiven
In der Folge werden Wachdienste und »Fensterputzer« (PB 162) erzeugt; ein großer Raum erhält gepolsterte Stühle, einen breiten Tisch mit fünf Stühlen dahinter und ein Rednerpult. Eine funktionale Ordnung garantiert, dass die Organisation ihrer Aufgabe nach innen und außen gewachsen ist. Das Setting mit seinen durch Mobiliaranordnung und kommunikative Privilegien markierten Unterschieden führt folgerichtig zur Generierung einer Verwaltungshierarchie: Chefs und Chefs von Chefs agieren miteinander und mit den »Leuten« (PB 162, 164), ohne dass dieses zunächst über deiktische Präsenzpostulate hinausginge, die einen rhetorischen Nullpunkt markieren könnten: »Der erste Chef ruft den zweiten bis fünften Chef in sein größtes Zimmer und sagt, Hier und heute.« (PB 162)
Nach etwa der Hälfte der Erzählung, die nur 8 Seiten umfasst, erzeugt der Schreiber in der Schrift einen mündlich übermittelten Arbeitsauftrag, der für die von ihm erzeugten »Leute« genauso wie für ihn selbst gilt, mitsamt seinen medialen und organisatorischen Voraussetzungen:
Der Schreiber reiht sich ein in diejenigen, die diesen Auftrag erfüllen, indem er zum einen die »Leute« auf »sechzehn Abteilungen« verteilt, die schriftlichen »Vorarbeiten« des Vorhabens in die Bücherregale verteilt und die Porträts ihrer Verfasser »auf uns« (PB 163) niederblicken lässt, zum anderen Arbeitserleichterungen einführt: Der Lärm wird eingestellt, Papier und Bleistift vermehren sich weiter. Die literarische Mitschrift der Welterzeugung und des Welterzeugten löst hier einen weitergehenden Erkenntnisanspruch ein. Sie macht mindestens andeutungsweise kenntlich, dass die Organisation ihr Verhältnis zur Zeit verändert: An die Stelle von Erschließungsbewegungen rücken Stabilisierungsbemühungen und Verstetigungsoperationen; sie wandelt sich zur Institution. (7) Zusätzlich generiert werden Chefvertreter, Sekretariate, eingerichtet werden weitere Zimmer und »Konferenzzimmer« (PB 164). Iterativ präsentiert das Protokoll das organisationstypische Rauchen, Kaffee-oder Teetrinken, das Gießen von Zimmerpflanzen, das Telefonieren, das Miteinandersprechen auf horizontaler oder vertikaler Ebene. Erst nach einem Jahr heißt es: »Die Arbeit kann beginnen.« (PB 165) Doch der Umgang mit den Vorarbeiten, die internen Maßnahmen zur Zeitgewinnung, die hierarchisch gestaffelten und ineinander verschachtelten Verfahren zur Gewinnung von »Überblick« (PB 165), sie alle kosten ›naturgemäß‹ Zeit und führen erneut zur wundersamen Vermehrung von Papier, Bleistift und, naturgemäß, von Schrift. Statt Fortschritt erfolgen Rekursion und Komplexitätssteigerung, auf der temporalen Ebene stellen sich Dehnungseffekte und Stillstandserfahrungen ein.
Nach ca. 3/4 des Textes kippen die Verhältnisse und der Programmbefehl ändert sich; Material und Zeit werden knapp (gemacht): »Aber es ist Zeit, daß ich schreibe: Im Spätherbst nimmt der fünfte Chef ein älteres Rundschreiben […] und entwirft auf der Rückseite ein Rundschreiben. Ich darf kein Papier mehr auf die Tische legen. Papier genehmigt der Chef.« (PB 165 f.) Der Schreiber-Erzähler gibt zwar einen Teil seiner Souveränität an den selbsterzeugten Chef-Aktanten ab, hegt diesen Verlust jedoch ein, indem er an die Logik und die Zeit des Schreibprozesses erinnert: »Ich frage mich, ob ich vielleicht schon die Hälfte geschrieben habe. Oder vielleicht auch schon mehr. […] Ich rechne nach und schreibe: Es bleibt nur noch die Hälfte der Zeit.« (PB 166) Maßnahmen folgen, die das neue, vergrößerte Arbeitsquantum auf die »vielen Leute« (PB 165) verteilt. Doch dann enden Text, Schreiben und Zeit: Das Ende des Textes und des Schreibprozesses zelebriert in seinem algorithmischen Wenn-dann-Schema zunächst eine Bifurkation zwischen Biologie und Organisation: Die Pflanzen besitzen eine andere Zeit, sie haben sich unaufhaltsam ausgebreitet, kleben an den Fenstern, versperren den Blick nach außen und provozieren verzweifelte, zeitraubende Versuche, dem Übel nun wieder
Zwar wird mit dem Bleistift auch angedeutet, Schrift (und Welt) wieder rückgängig machen zu können, da Bleistiftschrift im Unterschied zum durchstreichbaren »Federzug« ausradierbar ist, doch verbleibt diese Möglichkeit in der Latenz. Der Versuch reiht sich stattdessen ein in eine Vielzahl gleicher Versuche.
Obwohl der Text kaum zeitliche und örtlich Indizes enthält und eher eine historisch verbürgte, (8) universalisierende und abstrahierende Schreibweise aufweist, die die selbsterzeugenden und -tragenden Elemente von Bürokratie charakterisiert und obwohl die Bürokratie entschieden als Phänomen der Schrift und die Literatur über die in Rede stehende Organisation als Protokoll in seinem doppelten Sinne aufgefasst werden muss, enthält der Text mehrfach eingestreute Gegenwartsreferenzen. Daher lässt er sich behutsam historisieren: Innerdiegetisch sind es die mitgehörten und mitgeschriebenen Gespräche über »den Ferienplatz an der Ostsee« und »den Garten in Heinersdorf« (PB 161), die eindeutig auf die DDR verweisen und die den Text, obwohl er dort nicht erscheinen konnte, in den Kontext ihrer Literatur und ihrer soziokulturellen Entwicklung einbinden. Die Vertagung des utopischen Ziels, die aktivistische Revision der organisatorischen Wege zu dessen Erreichung sowie die umfassende Inklusionslogik einer Organisationsgesellschaft ›von oben‹ (»Jeder von uns spielt eine Rolle«) zeugen ebenfalls von diesem Hintergrund. (9)
Als literarische Ressourcen für »Versuchte Nähe« und insbesondere für »Papier und Bleistift« werden u.a. Samuel Beckett und Franz Kafka in Anschlag gebracht, (10) d. h. Traditionen der klassischen Moderne bzw. der Avantgarde, die sich ihre politische Dimension nicht durch bestimmte Negation und explizite Kritik, sondern durch die Analyse von Sprachschablonen, von Schreib-, Text- und Zeitpraktiken und von kommunikativen Störungen und Friktionen erarbeiten. (11) Insbesondere die Bürokratiedarstellung in »Papier und Bleistift« ließe sich mit Kafkas Bürokratieanalysen und ihrer DDR-Rezeption abgleichen: Wo die strikte Historisierung zu vorsichtiger Akzeptanz Kafkas führte, weil so die generalisierenden Momente, mithin der subversiv-kritische Bezug seines Schreibprogramms auch auf die DDR abgewiesen werden konnten, (12) fällt dieser Ausweg für »Papier und Bleistift« weg: Es handelt sich bei Schädlichs Text um Gegenwartsliteratur, die Referenzen sind rar, aber eindeutig, und vor der hier entfalteten Analyse bürokratischer Integrationsprozesse kann sich auch die DDR nicht wegducken.
Daher signalisiert die komplizierte Publikationsgeschichte, (13) dass der Duktus des Textes und seiner Ko-Texte für die einschlägigen DDR-Behörden und ihre Praktiken letztlich nicht akzeptabel war, (14) obwohl er an historische Entwicklungen und literarische Traditionen der Kritik bürgerlich-bürokratisch organisierter Gesellschaften im ‚stahlharten Gehäuse‘ (Max Weber) anknüpft, die für die offizielle DDR in Literatur und Politik relevant waren. Nach wiederholten Versuchen, Texte bei DDR-Verlagen unterzubringen, hingehalten und abgelehnt, gelingt es Schädlich schließlich, den Band ›Versuchte Nähe‹ bei einem West-Verlag unterzubringen. Die Repressalien gegen ihn und seine Familie und die Ausreise aus der DDR führen jedoch zu einer verkürzten, systemkritischen Lektüre seiner Texte, die ihrer Faktur oft nur annähernd gerecht wird. (15)
Die analytisch-kritische Potenz des Textes »Papier und Bleistift« zeigt sich nur, wenn man seine abstrahierend-generalisierende und insbesondere seine literarische Faktur im Abgleich mit literaturhistorischen Kontexten ernst nimmt, mithin wenn sowohl seine historisch spezifischen wie auch seine auf systemübergreifende Phänomene der Schrift und der Bürokratie zielenden Momente analysiert werden. (16) Wodurch »Papier und Bleistift« genau den Rahmen sprengt, zeigt sich nach Historisierung und Kontextualisierung in dem Interesse, das Schädlich für die Vorannahmen und Konsequenzen von Schreibakten der Mitschrift entwickelt, welche sich ihrer bürokratischen Natur gewissermaßen bewusst werden und so über Strukturierungsprozesse und ihre Effekte im Allgemeinen nachzudenken beginnen.
Auf werkbiografischer Ebene muss Hans Joachim Schädlichs langjährige Berufstätigkeit in DDR-Wissenschaftsorganisationen knapp in die Betrachtung einbezogen werden. Seine Entscheidung, in der DDR das Fach Germanistik vor allem sprachwissenschaftlich zu studieren und beruflich zu praktizieren, um auf diese Weise ideologische Zumutungen zu umgehen, rückt ihn in die Nähe avancierter linguistischer Forschung in der DDR, wo strukturalistische und transformationsgrammatische Positionen mit informationstheoretischen und mathematischen Verfahren kombiniert wurden. (17) Schädlich ist Teil und Beobachter dessen, was in der DDR „Wissenschaftlich-Technische Revolution“ hieß und was sich auch in administrativen Neugründungen im Feld der Geisteswissenschaften niederschlug. Seine langjährige Tätigkeit in der Akademie der Wissenschaften im Umfeld der prominenteren Forschungen von Manfred Bierwisch und Georg Klaus sowie halb-familiäre, halb professionelle Netzwerke, die sein erster Schwiegervater, der bekannte Slavist und Ethnologe Wolfgang Steinitz, vermittelte, (18) bestärken die hier vorgetragene Lektüre von »Papier und Bleistift«. Insbesondere der Aufsatz »Phonologie und Poetik«, den Schädlich an prominenter Stelle, im ersten »Jahrbuch für Internationale Germanistik« 1969 veröffentlichte, spielt eine zentrale Rolle und sollte intensiver analysiert werden. Der Text lässt, obwohl noch im Banne binärer Logiken, sehr deutlich Schädlichs Interesse an kybernetisch-informationstheoretischen Verfahren, an der Logik der Algorithmen und an Wahrscheinlichkeitskalkülen erkennen. (19) Für das Problem der Mitschrift und die Frage, nach welchen Regeln protokollarische Mitschriften in Entscheidungsgrundlagen und Handlungswissen überführt werden, ist das auch deswegen relevant, weil es den Übergang von den Verfahren der klassischen Bürokratie zu den Operationen moderner Datenverarbeitungssysteme reflektiert.
Im engeren Zusammenhang der DDR-Literatur und ihrer Pragmatik greift der Text die aus den Traditionen des sozialistischen Realismus entwickelten Topoi der Planer- und Leiterliteratur auf,
(20)
um sie umgehend zu ironisieren und zu dekonstruieren. Mit dem Eigentum an den Produktionsmitteln
Doch der Schreiber-Erzähler schreibt und folgt nicht nur schreibend diesem Programm, sondern er demonstriert dessen Paradoxien und selbstzerstörerische Kräfte: Durch die auf die Spitze getriebene Entfaltung der Königs-Perspektive, ja mehr noch, einer Schöpfergottes-Perspektive, markiert »Papier und Bleistift« nämlich eine generative und dirigistische Potenz der Literatur, die weit über das hinausgeht, was ihr in der DDR zugestanden wurde. Und: Nicht nur die Widersprüchlichkeit solcher Programmatik zeigt der Text, sondern auch die Alternativen zur männlichen Sozialfigur Arbeiter der Faust sowie ihre Weiterführungen in genderirritierten und -irritierenden Sozialfiguren des Bürokratischen (Funktionär, Planer und Leiter). (21) Präsentiert wird außerdem eine sich selbst tragende, aber durch einen einzigen menschlichen Aktanten erzeugte Bürokratie, die einerseits in ihren Rekursionsschleifen eine interne Komplexität und Stabilität aufbaut, welche einerseits die sozialistische Ökonomie mit ihrem Wachstumsmodell von Produktivkräften und ihren Eigentums- und Produktionsverhältnissen infrage stellt, welche andererseits die materiellen und ideologischen Interventionen der DDR-Bürokratien »(h)ier und heute« apostrophiert und in der Schrift vollführt.
Mit der Planer- und Leiterprogrammatik verbindet sich außerdem ein wissenschafts- und technikgeschichtlicher Kontext, dessen Erschließung zu den soziotemporalen Implikationen von Mitschriften in Gesellschaften zurückführt: Die DDR-spezifische Begriffsprägung »Wissenschaftlich-Technische Revolution« (WTR) dient als Mobilisierungsschlagwort, mit dem den alten und neuen Eliten der DDR die administrativen und technischen Innovationen und Denkfiguren der 1960er Jahre, vor allem die Praktiken und kontroversen Diskurse der Informationstheorie und Kybernetik vertraut gemacht werden.
(22)
Was davon Eingang in die Betriebe und Bürokratien findet, hängt von ideologisch-langfristigen wie kurzfristigen wirtschaftspolitischen Kalkülen und Machtverhältnissen ab.
(23)
Immer hatte es mit der Sorge zu tun, den Anschluss an revolutionäre technische Entwicklungen zu verpassen und dadurch das Versprechen nicht mehr einlösen zu können, als sozialistische Gesellschaft die Spitze des menschheitsgeschichtlichen Fortschritts zu verkörpern. Die Erzählung »Papier und Bleistift« ist somit auch als ein literarisch reflektierender Beitrag zu den sich hier entfachenden Beobachtungen und Diskussionen zu lesen. Der Text enthält zwar, außer dem wiederholten Verweis auf die »Chefs« und die notorisch knappen und abhöraffinnen »Telefone«,
(24)
keine eindeutigen Verweise auf diesen Kontext der operativen Durchdringung von Kommunikation und Gesellschaft in Echtzeit; ihr intrikates Schreibverfahren jedoch, das im ersten Teil dargestellt wurde, lässt mindestens die ›unentrinnbaren‹, irreversiblen Rekursionen,
(25)
also Selbstbezüglichkeiten bürokratischer Operationen und das Abarbeiten von Programmbefehlen der allmählich implementierten Elektronischen Datenverarbeitung in einer Gesellschaft erahnen, die von ihren marxistischen Eliten als organischer Bewegungszusammenhang imaginiert wurde. Auf die Spitze und an das Ende des Denkbaren getrieben wird in Schädlichs Text die in der DDR-Kultur verstärkt diskutierte Wahrnehmung, dass der Arbeiter der Faust dem Arbeiter des Kopfes Platz zu machen beginnt. Wenn dann selbst die im Büro und in der Organisation Tätigen Schriftgeburten sind, wenn ihre Praktiken und Ziele, die Hierarchien und die Dinge, vom Mobiliar über die Zimmerpflanzen und die Schreibgeräte durch die demiurgische Schrift des Ich-Erzählers erzeugt werden, dann werden Zweifel an der Arbeiter- und Bauern-
Gerade das – fast – ahistorische Setting von Rahmen- und Binnenerzählung, das rekursiv-potenzierte Schreiben des Schreibens, das spielerisch, aber auch unentrinnbar-irreversibel daherkommt, rückt die DDR-Kultur in das Licht einer literarischen Modernekritik, von der sich diese jedoch nicht getroffen sieht und die sie passiv-aggressiv ausschließlich den westlich-kapitalistischen Gesellschaften zuschreibt. (26) Damit radikalisiert und präfiguriert Schädlichs Text eine DDR-spezifische Gesellschaftskritik an der eigenen, längst historisch gewordenen Modernität, die vor allem Heiner Müllers Stück »Der Auftrag« mit einem ausgedehnteren historischen Blick weitertreibt, die aber wohl erst von Rudolf Bahro explizit gesellschaftstheoretisch vorgetragen wird.
In Anlehnung an Schädlichs Text, der ein Changieren zwischen Vorschrift und Mitschrift und deren metaleptischen Verschleifungen narrativ entfaltet, gilt es zuletzt einen anderen Blick auf eigene, frühere Gedanken zu werfen: Die Verfasserin hat vor geraumer Zeit (27) mit der zweifellos forcierten Funktionalisierung des Begriffs der Mitschrift auf die Kopräsenz von Schrift, Bürokratie und sprachlich konstituierter Welt und nicht minder auf die unvermeidliche Vermischung von Objekt- und Beschreibungssprache bei der Analyse von literarischen Texten zur Bürokratie verweisen wollen. Um die Büro- und Angestelltenromane der Weimarer Republik historisch zu kontextualisieren, hatte sie Studien zur Geschichte der Stenografie in der Dresdner Stenografischen Sammlung mit ihren Beständen zur internationalen Geschichte der Silben- und Kurzschriften zum Ausgangspunkt genommen. Die Beobachtung eines hier deutlich erkennbaren Gender-Bias, der weiblichen Büroangestellten eine besondere Fähigkeit zur hermeneutischen Einfühlung in männliche Diktate zuschreibt, impliziert zum einen die Aufmerksamkeit für politische und/oder technologische Machtverhältnisse, in die Schriftpraktiken traditionell involviert sind, damit korrespondierend aber auch für die Subversions- bzw. Störungsoptionen, die darin eingekapselt sein mögen.
Die hermeneutische Kompetenz besonders ›flotter‹ Stenotypistinnen, die ahnt, worauf ein Diktat hinausläuft und wie ein Diktator seine Rede fortsetzen wird, hat die Verfasserin gegen die durch die Kittler-Schule forcierte Fokussierung auf die technische Form der Mitschrift als phonografisches Registrieren gesetzt. Dass indes maschinelle Mitschriften bereits im Horizont der Zeitgenossen präsent waren und dass die physiologische Transformation von Schall in menschliche Sprache sowohl Formen der Manipulation wie auch der Trivialisierung menschlicher Kognition am Horizont erscheinen lassen, (28) ist genauso selbstverständlich anzuerkennen wie die Tatsache, dass hermeneutische Kompetenzen, mediengeschichtliche Innovationen und subversiv-poetologische Strategeme in einem prozessualen Sozialzusammenhang der Koproduktion entstehen. (29)
Dieses Mitschriftverständnis hat, wenn man die Schädlich-Lektüre nun mitbedenkt, gleichermaßen einen linguistisch-rhetorischen wie einen ins Soziale ausgreifenden Zugriff zur Folge: Syntagmatische Fortsetzungserwartungen, die Statistik der Kookkurrenzen und die (realistische?) Trope der Metonymie sind mit einem Fokus auf die Stellvertretungsverfahren und ihre sozialen Implikationen zu entfalten. Hier wären neuere Arbeiten
(30)
und die Kritik vor allem an der strikten Jakobsonschen Kontrastierung von Metapher und Metonymie via Paradigma/Syntagma einzuarbeiten. Auch Moritz Baßlers wiederholte Kritik an metonymischen Schreibweisen könnte im Anschluss an diese Überlegungen revidiert werden: Wenn Metonymien derart an Mythen des Alltags (Barthes) und an die Aktivierung kognitiver
All dies wäre heute wahrscheinlichkeitstheoretisch weiter zu entwickeln, da spätestens die allenthalben in den unterschiedlichen technischen
Friedrich Schiller: Don Karlos, in: Dramen II, hg. von Gerhard Kluge (Friedrich Schiller: Werke und Briefe in zwölf Bänden Bd. 3), Frankfurt/Main 1989 [1787], S. 317.
Hans Joachim Schädlich: Versuchte Nähe, Reinbek 1980 [1977], S. 160–167. Für Belege aus Papier und Bleistift wird im folgenden die Sigle PB samt nachfolgender Seitenzahl verwendet.
Peter Becker: Bürokratie, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 30.08.2016, online:
Kerstin Stüssel: In Vertretung. Literarische Mitschriften von Bürokratie zwischen früher Neuzeit und Gegenwart, Tübingen 2004, S. 23 u. 206–215.
Rüdiger Campe: Die Schreibszene. Schreiben, in: Hans Ulrich Gumbrecht/Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche, Frankfurt/Main 1991, S. 759–772.
Vgl. Sibylle Cramer: Schädlichs Autor. Hans Joachim Schädlichs Erzählen vom Erzählen, in: Text+Kritik 125: Hans Joachim Schädlich (1995), S. 30–37; Michael Niehaus: Epochen des Protokolls, in: ZMK Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung. Medien des Rechts (2011), 2/2, S. 141–156, online in DOI:
Zur Ambivalenz von Stabilisierungsleistungen, deren Verdichtung in der „totalen Institution“ zum topischen Repertoire kritischer Denkfiguren der klassischen Moderne zählt vgl. Erving Goffman: Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates, Garden City, N.Y. 1961.
Becker: Bürokratie; Wolfgang Seibel: Verwaltung verstehen. Eine theoriegeschichtliche Einführung, Berlin 2016, S. 132–141.
Detlef Pollack: Das Ende einer Organisationsgesellschaft. Systemtheoretische Überlegungen zum gesellschaftlichen Umbruch in der DDR, in: Zeitschrift für Soziologie 19 (1990), H.4, S. 292–307; Maren Lehmann: Die Eitelkeit der Organisation. Protokolle als Vor- und Mitschriften formaler Mitgliedschaft, in: Peter Plener/Niels Werber/Burkhardt Wolf (Hg.): Das Protokoll. AdminiStudies. Formen und Medien der Verwaltung 2, Berlin 2023, S. 129–143, online in DOI:
Theo Buck: Hans Joachim Schädlich. Leben zwischen Wirklichkeit und Fiktion, Köln 2015, S. 72; vgl. auch Anon.: Dokumentation. Aus der Akte Hans Joachim Schädlich, in: Karl Deiritz/Hannes Krauss (Hg.): Verrat an der Kunst? Rückblicke auf die DDR-Literatur, Berlin 1993, S. 24f.
Im Detail zu erforschen wären weiterhin die Bezüge zu Uwe Johnson und zu weiteren Autoren insbesondere der französischen Avantgarde, etwa George Perec; die Phantasmen der Überwucherung dessen, was als gesellschaftliches Ordnungsprojekt und soziale Modernisierungsinstanz ins Werk gesetzt wird, weist wiederum auf Wolfang Hilbig voraus.
Kerstin Stüssel: Klaus Hermsdorf: Kafka. Weltbild und Roman. Berlin 1961, in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 64 (2017), H. 2, S. 145–147.
Hans Joachim Schädlich: Der andere Blick, in: Ders.: Über Dreck, Politik und Literatur. Aufsätze, Reden, Gespräch, Kurzprosa, Berlin 1992, S. 103–112; Theo Buck: Verhinderte Innovation. Die in der DDR ungedruckt gebliebenen Bücher von Uwe Johnson und Hans Joachim Schädlich, in: Hans-Christina Stillmark (Hg.): Rückblicke auf die Literatur der DDR, Amsterdam 2002, S. 11–44.
Anon.: Aus der Akte Hans Joachim Schädlich.
Dirk Pilz: Die Schrift bleibt verwischt. Überlegungen zur Aktualität von Hans Joachim Schädlichs Band Versuchte Nähe anhand des Textes „Lebenszeichen“, in: Hans-Christina Stillmark (Hg.): Rückblicke auf die Literatur der DDR, Amsterdam 2002, S. 45–69; Michael Neumann: »…sozusagen kalt und kommentarlos.« Die Moral der Mitschrift in Hans Joachim Schädlichs Prosa, in: Walter Schmitz/Jörg Bernig (Hg.): Deutsch-deutsches Literaturexil. Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der DDR in der Bundesrepublik, Dresden 2009, S. 468–484.
Yaak Karsunke: Benennungsverbote. Hans Joachim Schädlich: „Versuchte Nähe“, in: Karl Deiritz/Hannes Krauss (Hg.): Verrat an der Kunst? Rückblicke auf die DDR-Literatur, Berlin 1993, S. 187.
Knapp bei Buck: Leben zwischen Wirklichkeit und Fiktion, S. 45–56.
Buck: Leben zwischen Wirklichkeit und Fiktion, S.40f.
Hans Joachim Schädlich: Über Phonologie und Poetik, in: Jahrbuch für Internationale Germanistik 1 (1969), S. 48f.
Peter Zimmermann: Industrieliteratur der DDR. Vom Helden der Arbeit zum Planer und Leiter. Stuttgart 1984; Stüssel: In Vertretung, S. 245–250.
Kerstin Stüssel: ›Dem Morgenrot entgegen‹? oder ›...dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint‹? Aurora in der DDR-Kultur, nach ihrem Ende, in: Christoph Oliver Mayer/Elisabeth Tiller (Hg.): Aurora – Indikator kultureller Transformationen, Heidelberg 2007, S. 292–297.
Vgl. Elke Seefried: Der kurze Traum von der steuerbaren Zukunft: Zukunftsforschung in West und Ost in den ‚langen‘ 1960er Jahren, in: Lucian Hölscher (Hg.): Die Zukunft des 20. Jahrhunderts. Dimensionen einer historischen Zukunftsforschung, Frankfurt/Main 2017, S. 179–220.
Vgl. Sebastian Bähr: Hammer, Zirkel, Kybernetik. In der DDR forschten Wissenschaftler an Grundlagen einer digitalen Planwirtschaft, in: nd, online:
Ilko-Sascha Kowalczuk: Telefongeschichten. Grenzüberschreitende Telefonüberwachung der Opposition durch den SED-Staat, in: Ders./Arno Polzin (Hg.): Fasse Dich kurz! Der grenzüberschreitende Telefonverkehr der Opposition in den 1980er Jahren und das Ministerium für Staatssicherheit, Göttingen 2014, S. 24–38.
Erhard Schüttpelz/Sebastian Gießmann: Medien der Kooperation. Überlegungen zum Forschungsstand, in: Navigationen 15 (2015), H. 1, S. 7–54; Kerstin Stüssel: Schreibtischtaten und Wiedergutmachung. Unumkehrbarkeit und bürokratische Rekursion in Martin Walsers Roman Die Verteidigung der Kindheit, in: Dirk van Laak/Dirk Rose (Hg.): Schreibtischtäter. Begriff-Geschichte-Typologie, Göttingen 2018, S. 131–142.
Anon.: Aus der Akte Hans Joachim Schädlich.
Stüssel: In Vertretung.
Bettina Schlüter: Gegenwart und Echtzeit, in: Johannes F. Lehmann/Kerstin Stüssel (Hg.): Gegenwart denken. Diskurse, Medien, Praktiken, Hannover 2020, S. 293–318.
Zum Begriff siehe Sheila Jasanoff: The idiom of co-production, in: Dies. (Hg.): States of Knowledge. The co–production of science and social order, London 2004, S. 2f.
Harald Haferland/Armin Schulz: Metonymisches Erzählen, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 84 (2010), H.1, S. 3–43; Sebastian Matzner: Die Poesie der Metonymie. Theorie, Ästhetik und Übersetzung einer vergessenen Trope, Heidelberg 2016.
Vgl. zuletzt Moritz Baßler: Populärer Realismus. Vom International Style gegenwärtigen Erzählens, München 2022, S. 32–35.
Schädlich: Der andere Blick, 50f; Theo Buck: Von der »versuchten Nähe« zur ›versuchten Ferne‹. Schädlichs narrativer Weg zur »Freiheit in der Geschichte«, in: Text+Kritik 125: Hans Joachim Schädlich (1995), S. 20.
Neumann: Die Moral der Mitschrift, S. 468f.
Neumann: Die Moral der Mitschrift, S. 468f; vgl. auch Alexandra Irimia: Bureaucratic Sorceries in The Third Policeman. Anthropological Perspectives on Magic and Officialdom, In: The Parish Review: Journal of Flann O'Brien Studies 6 (2022), Vol.2, S. 1–21, online: