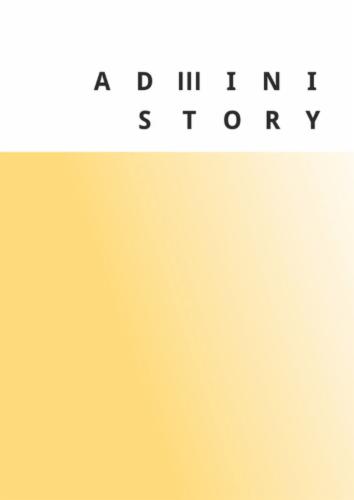Zihals Zahlen. Geschäftszahlen als Orientierungspunkte in einer bürokratischen Welt
Publié en ligne: 09 juil. 2025
Pages: 73 - 90
DOI: https://doi.org/10.2478/adhi-2023-0012
Mots clés
© 2022 Peter Becker, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Die Bearbeitung bestand in einem Blick in erleuchtete Fenster, um Frauen mit einem Fernglas bei der Abendtoilette zu beobachten.(3) Doderer legte dem Amtsrat eine euphemistische Sprache in den Mund, in denen die Fenster als »Sterne«(4) und seine voyeuristische Praxis als »terrestrische Astronomie«(5) firmierte. Mit einer derart verharmlosenden Begrifflichkeit verlagerte der Autor die visuell-sinnlichen Begierden in einen entsexualisierten Bezugsrahmen. Die Überformung von Zihals lebenslang ver-rücktem und sich nun langsam artikulierendem sexuellen Begehren präsentierte Doderer nicht nur anhand einer euphemistischen Sprache. Noch anschaulicher modellierte er diesen sinnlich-bürokratischen Komplex durch die Präsentation der Verfahren, mit denen der Amtsrat seine voyeuristischen Aktivitäten organisierte. Doderer nutzt in seiner poetologischen Strategie die
Den
Der pensionierte Amtsrat Zihal hatte Erfahrung mit Aktenbezeichnungen aus seinen vielen Arbeitsjahren in der österreichischen Bürokratie. Dort wurde seit Jahrhunderten mit der Aufgabe gerungen, einzelne Vorgänge im rasch expandierenden Datenraum möglichst eindeutig zu verorten.(12) Doch selbst am Beginn der Aktenkennzeichnung waren romantische Begriffe wie etwa Zihals
Für Zihal war die Waldfee eine hybride Referenz – ein Medium in mehrfacher Hinsicht, weil sie durch ihren evozierenden Charakter ein sinnliches Erleben versprach und gleichzeitig einem bürokratischen Verfahren als Ankerpunkt diente, das den pensionierten Amtsrat zu einer festgelegten Zeit zu klar definierten Handlungen bestimmte. Finden sich derartige Überlagerungen von Objekt- und Verfahrensmerkmalen auch im medial verfassten Gedächtnisraum der öffentlichen Verwaltung? Ab wann und unter welchen Umständen erfolgte der Schritt hin zu einem neuen, rein auf formalen Kriterien beruhenden System? Zihal vollzog diesen Schritt unter dem Druck einer rasch expandierenden Geschäftstätigkeit, wenn man die nächtlichen Explorationen seines ganz persönlichen Sternenhimmels mit diesem euphemistischen Begriff bezeichnen darf. Bietet Zihal hier erneut Anhaltspunkte für die Beurteilung einer ganz auf terrestrische Phänomene fokussierten öffentlichen Verwaltung?
Die Beziehungen, die ich zwischen dem pensionierten Bürokraten in Doderers Mitschrift und der österreichischen Bürokratie entwickeln werde, beziehen sich somit nicht auf eine phänomenologische Ebene. Mich interessieren vielmehr die Merkmale bürokratischer Struktur und Praxis, die sich im Dialog mit Doderers Roman erschließen lassen. Bereits auf der ersten analytischen Ebene lässt sich eine Figuration erkennen, die durch die eigenwillige Beziehung zwischen einem abstrakten, quasi
Zihal kannte keine Rollenkonflikte, wie sie im modernen Staat und der modernen Gesellschaft so häufig vorkamen. Doderer lässt seinen Amtsrat voller Stolz und mit einer gewissen Wehmut auf die von seinen Vorgesetzten bestätigte Erfüllung der Rollenerwartungen blicken: »Er war nicht, niemals, beanständet worden.«(19) Zihal benötigte keine Distanz zu den Rollenerwartungen an seine (ehemalige) bürokratische Existenz. Ihm fehlte selbstverständlich auch die Distanz zur eigenen Person,(20) auf deren Grundlage er kritisch über die Nutzung der Dienstpragmatik von 1914 als einzige, ins Transzendente verlagerte Orientierungshilfe zur Bewältigung aller Lebenslagen nachdenken hätte können.(21) Aus der Perspektive von Renate Mayntz hat Doderer seinen Amtsrat somit als Prototypen für
Selbst Zihals Nemesis in Form der moralischen Verurteilung seines Handelns kam nicht von außen. Sie trat langsam aus der Lektüre der Dienstpragmatik hervor. Noch bevor er durch den Einsatz eines leistungsstarken Teleskops die Kontrolle über seinen terrestrischen Himmelsraum festigen konnte, stieß er auf die Bestimmungen zur Verhängung von Ordnungs- und Disziplinarstrafen gegen Beamte, die ihre Standespflichten verletzten.(25) Die formale Legitimation des Handelns war hier plötzlich nicht mehr ausreichend. Das so genannte »persönliche Moment« erhielt in Form der Amtsehre eine Bedeutung, die Zihal während seiner Amtstätigkeit nie zum Problem geworden war und die sich hier plötzlich als Bedrohung aus den Untiefen der Dienstpragmatik erhob, wobei sie bereits durch die Entdeckung seines Treibens erstmals an Gestalt gewonnen hatte.(26) Sein jüngstes Gericht fand in einem Fiebertraum statt, der dem Ende seines voyeuristischen Tuns folgte und seine Menschwerdung endgültig besiegelte. Die richtende Instanz war der Doppeladler als symbolische Repräsentation der bürokratischen Autorität: »riesenhaft hockend, mit den zusammengelegten Schwingen bergspitzengleich bis zur Decke reichend, in einem Golde, das wäßrig-hell vom Zorn war.« Das Urteil des Richters erfolgte in der Diktion der Dienstpragmatik und seine Verurteilung war begründet mit dem »persönlichen Moment«, das »in erschwerender Weise hinzutritt.«(27)
Doderer poetologische Strategie beruht auf einer konsequenten Trennung zwischen dem Amt einerseits und dem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben andererseits. Die engelsgleiche Existenz der Beamten immunisierte sie gegen mögliche Rollenkonflikte. Damit hat der Autor einen bitteren, wenn auch ironischen Kommentar zur Stellung der Beamten geschrieben, die sich auf die formale Legitimität ihres Handelns berufen können, um die Verantwortung für ihr Tun abzulehnen. Die Figur des Engels ist gleichzeitig ein stilistisches Hilfsmittel, mit dem Doderer die verwaltungskulturelle Geschlossenheit der österreichischen Bürokratie persifliert(28) und die spezifische Position seines Helden inszeniert: ein ›gefallener Engel‹, der durch die Pensionierung zur Menschwerdung bestimmt war(29) und plötzlich die »alles bewältigende, die zurückweisende, gutheißende oder beanständende Wucht des Amtes« zurück lassen musste.(30) Mit der Figur des Engels greift Doderer außerdem eine Denkfigur auf, die in der Zeit der Aufklärung weit verbreitet war und einen interessanten Kommentar zu epistemologischen Ansprüchen der Bürokratie leistet. Die Beschränktheit des menschlichen Wirklichkeitsbezugs ergab sich für die Naturforscher des 18. Jahrhunderts aus der Körperlichkeit des Menschen. Erst die transzendente Figur des Engels konnte diese Grenzen überwinden und ein
Für Doderer ist das bürokratische Selbst mit fehlenden Rollenkonflikten und epistemologischen Ansprüchen nur zum Teil beschrieben. Für ihn sind die Rollenanforderungen der metaphysische Überbau, den er in der Lektüre der Dienstpragmatik durch Zihal geschickt als solchen inszeniert. Durch die Transposition der Dienstpragmatik aus dem Management von Behörden in die Organisation des Alltags werden Zihals Defizite als Subjekt anschaulich gemacht.(32) Denn die Dienstpragmatik ist als Regelwerk »dünn« angelegt im Sinne von Lorraine Daston, d. h. sie bezieht sich auf einen klar festgelegten Wirkungsbereich, ihre Heranziehung als Instrument zur Lebensbewältigung und zur Organisation voyeuristischer Tätigkeit war nicht vorgesehen.(33)
Die eigentliche Strukturierung der amtsrätlichen Subjektivität erfolgt durch die zur zweiten Natur gewordene Nutzung der
Mit dieser witzig-ironischen Profilierung des ehemaligen Amtsrats Zihal kommentiert Doderer, wie ich argumentieren werde, die Stellung von Subjekten in modernen, hoch entwickelten Organisationen wie der öffentlichen Verwaltung zur Zeit der Habsburgermonarchie. Welche Prägungen hinterließ die jahrzehntelange bürokratische Praxis und die Handhabung eines bestimmten Sets
Doderers Darstellung von Zihals letztlich erfolglosem Versuch, sein aufkeimendes sexuelles Begehren mit Hilfe der
Doderer setzt ein letztes Aufbäumen der Aktwerdung an den Beginn des Romans. Zihal scheitert kläglich an der aktenmäßigen Strukturierung des anstehenden Umzuges. Er musste resignieren vor der »Last des Irdischen« und dem »Inhalt mit seiner traurigen Formlosigkeit und formlosen Traurigkeit.«(40) Ohne die schützenden Mauern des Taxamtes brach die Welt ungefiltert über den Amtsrat herein. Die zarten Pflänzchen seiner sexuellen Begierden, die sich im Blick in die erleuchteten Fenster in ver-rückter Form entfalteten, führten ebenso wenig zur Produktion von Akten. Das Zihalsche Archiv sinnlicher Erfahrungen konnte nicht verschriftlicht werden, weil es sonst die Brüchigkeit der Subjektivität des Amtsrates und die Unhaltbarkeit seiner euphemistischen Selbstdarstellung offenbar gemacht hätte.(41) Für die Aktwerdung seines sexuellen Begehrens fehlte dem Amtsrat die Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion,(42) was Doderer sicherlich bewusst war, er aber aus Rücksicht auf seinen Protagonisten offenbar nicht in den Vordergrund stellen wollte. Deshalb wurde Zihal zum Menschen, bevor er sich der reflexiven Bearbeitung seiner sexuellen Regungen stellen musste.(43)
Zihals Registratur mit ihren Geschäftszahlen unterschied sich daher in einem wichtigen Punkt von derjenigen einer Behörde: sie verwies auf keine Akten. Das Ziel seiner terrestrischen Astronomie war nicht das Sammeln von Observationen, wie Klaus Nüchtern argumentiert,(44) sondern das Verzeichnen von Observationspunkten. Zihal endete sein Schreiben mit der Pensionierung und beschränkte sich auf den Akt des Verzeichnens.(45) Die Beobachtungen selbst zeichnete Zihal nicht auf, sie blieben als sinnliche Erfahrungen nicht akt- und diskursfähig im amtsrätlichen Innern.(46) Er war somit sein eigenes Archiv – in dem unterschiedliche Logiken den Niederschlag seiner Amtshandlungen strukturierten.(47) Auf unbewusster Ebene folgten seine voyeuristischen Erhebungen einem verdrängten sexuellen Begehren, auf der bewussten Ebene nutzte er ein Repertorium zu Organisation seiner Beobachtungen, das ähnlich wie frühe Ordnungslogiken von Registraturen(48) topographisch organisiert war. Im Fall von Zihal orientierte es sich an der Himmelskarte seiner terrestrischen Sterne.(49)
Doderer verzichtet in der Auseinandersetzung mit den kleinen Formen der Zihalschen Amtspraxis auf Akten, Registratur und Archiv. Er belässt es bei dem Blick auf die Aktenzahlen, die als Signifikanten für sich alleine standen und keinen Bezugspunkt im Außen hatten.(50) Darin ähnelten sie den Akten des Taxamtes, in dem Zihal lange Jahre seinen Dienst versehen hatte. Mit dieser Spiegelung von letztlich ins Leere laufenden Signifikanten – der Grundzahl bei Zihal und der Akten im Taxamt(51) – brachte Doderer erneut die Abgeschlossenheit der österreichischen Bürokratie gegenüber ihrer Systemumwelt zum Ausdruck.(52)
Doderer hat mit dieser witzigen Geschichte eines pensionierten Amtsrates auf Abwegen im Subtext auch eine Mitschrift der Beziehung von Verwaltung zu ihrer Umwelt erstellt. Sie nutzt die Menschwerdung des Amtsrates für Hinweise auf die Leitdifferenz zwischen Geschlossenheit der Verwaltung und Offenheit gegenüber ihrer Umwelt.(53) Diese Differenz wird greifbar, wenn man sich den Ausgangspunkt von Zihals
Und doch ist diese Vermutung unbegründet. Zihal, der sich in ganz ähnlicher Form die Karriere- und Kompetenzleiter hochgedient hatte, war für Einsprüche und Rekurse der Verwaltungsunterworfenen zuständig.(59) Er hatte sich durch eine ›Intelligenzprüfung‹ bis zum so genannten Konzept hochgearbeitet und war deshalb über die Aktenmanipulation hinausgewachsen und konnte selbständig Erledigungen von verwaltungsmäßigen Vorgängen machen.(60) Weshalb ließ ihn Doderer dann nach dem ersten Schock der Pensionierung(61) nicht einfach seine Aktenarbeit fortsetzen - selbst wenn der erste Versuch der Aktwerdung seines Umzugsprojektes ja kläglich gescheitert war? Weshalb bestimmte ihn der Autor zur Beschränkung auf die Registratur und auf die Nutzung der
Zihal musste nicht darauf warten, bis die terrestrischen Sterne in Form von Anträgen und Mitteilungen zu seiner Kenntnis gelangten. Er konnte von sich aus aktiv werden – gewissermaßen
Der Blick auf Zihals Zahlen, oder vielmehr auf Zihals Adressierungssystem, eröffnet uns einen zusätzlichen Zugang zu Doderers Darstellung von Bürokratie und Bürokraten. Doderer waren die neuen Geschäftszahlen der staatlichen Verwaltung mit ihren Grundzahlen und ihrer einfachen Notation bestens vertraut. Er baute sie in seinen Plot ein, wo sie eine wichtige Rolle übernehmen. Damit will ich nicht unterstellen, dass Doderer diese Rationalisierungsprozesse einfach abgebildet hätte. Das hätte einen realistischen und wohl etwas langweiligen Roman ergeben! Doderer produzierte vielmehr eine literarische Mitschrift dieser Prozesse, wobei er deren Grundthemen geschickt variierte. Die Geschäftszahlen, die keine Akten referenzierten, habe ich als einen ironischen Hinweis auf die verwaltungskulturelle Geschlossenheit von Verwaltung gelesen. Die Ausgestaltung dieser Zahlen durch Doderer kann zusätzlichen Aufschluss darüber bieten, wie er die Leitdifferenz zwischen Geschlossenheit und Offenheit dazu einsetzte, um die Menschwerdung seines Amtsrates in Szene zu setzen. Zuvor nahm er eine grundlegende Umstrukturierung seiner Geschäftszahlen vor.
Doderer präsentiert sehr geschickt einen bürokratisch-sinnlichen Raum, der aus der Sicht eines Weberianischen Bürokrativerständnisses einen Widerspruch in sich selbst darstellte. Dieser Raum war definiert durch die Spannung zwischen einem langsam sich formierenden sexuellen Begehren(70) – bezogen auf ein Außen – und einem neurotischen Festhalten an bürokratischen Ordnungs- und Gestaltungsformen, die das geschlossene bürokratische System und damit eine Form der Geborgenheit für Doderers Amtsrat vertraten. Mit dem Festhalten sollte wohl Zihals Weg durch dieses »Zwischenreich … durch das eine mystische oder zumindest mysteriöse Behörde vom Leben und den gewöhnlichen Menschen getrennt wird …«(71) leichter bewältigt werden. Dieses Miteinander von Offenheit und Geschlossenheit führte zu einer zunehmenden Spannung, die sich letztlich in einer kathartischen Befreiung aus dem bürokratisch-sinnlichen Komplex entladen wird.(72)
Woran konnte ein aufmerksamer Beobachter dieses so selbstverständliche Festhalten an den
»Aber mit der primitiven, für eine wenig entwickelte Sternwelt noch zulangenden Art und Weise der Standorts-Bezeichnungen war’s nun ein für alle Male vorbei: Draufsicht, unten, rechts, oder gegenüber; und auch mit kindisch-märchenhaften Namen: die
Ein wesentlicher Unterschied findet sich im Verständnis von der so genannten Grundzahl. Die Kanzleiordnung aus dem Jahr 1923 legte fest, Geschäftszahlen als laufende Nummern zu vergeben, wobei die Zählung mit jedem Kalenderjahr neu beginnen sollte. Die Grundzahl fasste alle Geschäftsstücke zusammen, »die eine und dieselbe Angelegenheit betreffen« und wurde gebildet aus der Geschäftszahl des ersten Geschäftsstückes zu der fraglichen Angelegenheit.(76) Bei Zihal waren die Geschäfts- und die Grundzahlen identisch, was aus der Perspektive eines Verwaltungsverfahrens ungewöhnlich war. Denn nur bei wiederholter aktenmäßiger Behandlung derselben Angelegenheit wurde die erste der Aktenzahlen zur Grundzahl. Zihal hatte jede seiner terrestrischen Sterne als ein wiederholt zu bearbeitendes Objekt angelegt. Es fehlten jedoch die Akten über die einzelnen Bearbeitungsschritte, weil diese Geschäftsstücke nur in ihm selbst vorhanden waren. Nur aus diesem Grund lässt sich ein Zusammenfallen dieser beiden Zahlen erklären.
Zihal nahm sich allerdings noch weiter gehende Freiheiten im Umgang mit bürokratischen Adressierungen. Anstelle der Verwendung einer neutralen fortlaufenden Nummerierung führte er ein
Zihal wird von Doderer als ein korrekter, aber nicht unbedingt ehrgeiziger Beamter geschildert. Er hatte die so genannte Intelligenzprüfung erfolgreich bestanden, war zum Konzeptbeamten aufgestiegen. Doch dort scheint er sich nicht besonders als Triebkraft für kanzleitechnische Änderungen hervorgetan zu haben. Wenn Zihal tatsächlich ein Verfechter der Reformen von Erich Graf von Kielmansegg, dem Statthalter von Niederösterreich, gewesen wäre oder gar wie Eduard Freiherr von Hohenbruck eine Studienreise in die deutschen Staaten unternommen hätte, um die dortige Verwaltungspraxis zu studieren, hätte uns das Doderer sicherlich nicht verschwiegen. Umso beeindruckender ist die Schöpferkraft des Amtsrates, der durch die Versenkung in den reinen Geist der Bürokratie eine Neugestaltung von Geschäftszahlen hervorbringt, mit der zahlreiche Reformer seit den 1910er-Jahren gerungen hatten.(78)
Die Kanzleireform war auf der Agenda der Kommission des Jahres 1911, doch wurde ihr nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt. Zihal kann hier offenbar kein Vorwurf gemacht werden! Kielmansegg, selbst Mitglied der Kommission, sah »zu viele Professoren (Theoretiker) und autonomistisch gesinnte Elemente als Mitglieder in dieselbe berufen«, was aus seiner Sicht mit dazu beitrug, dass die Kommission »nach dreijähriger Tätigkeit ohne richtiges Ergebnis ihrer Beratungen, nach schwerem Siechtum sanft verschied.«(79) In der Verwaltungsreform der 1920er-Jahre wurde die Kanzleireform erneut zum Thema – sie war ein Bestandteil des Reform- und Finanzprogramms von 1922. Die Kanzleireform wurde als Bestandteil des Reformprogramms umgesetzt und wurde am 1. Januar 1927 verbindlich bei allen Landesregierungen eingeführt;(80) sie blieb aber in ihrem Kern den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts verpflichtet.(81) Der zeitliche Rahmen der Kanzleireform, der sich vom späten 19. Jahrhundert bis in die Mitte der 1920er-Jahre erstreckte, entspricht somit der Zeit, in der wir Doderers Amtsrat auf dem Weg zu seiner Menschwerdung begleiten.
Welche Bedeutung hatte die Kanzleireform für Zihal, der ja eine ihrer Ergebnisse – die Neugestaltung der Geschäftszahlen – aus sich selbst hervorgebracht hatte. Löste das in seiner höchst persönlichen Registratur ähnliche Erschütterungen aus, wie sie die staatlichen Behörden zu gewärtigen hatten? Zur Beantwortung dieser Frage ist ein genauer Blick auf die Abläufe erforderlich. Rasch wird erneut der deutliche Unterschied im Geschäftsgang sichtbar. Das Taxamt – die eigentliche Heimat des pensionierten Amtsrates – entwickelte ein hohes Maß an Geschlossenheit in der arbeitsteiligen Erledigung von Geschäftsstücken. Das Taxamt, wie übrigens die meisten der Behörden, war im Bereich einzelner zentraler Schnittstellen an die Umwelt angebunden. Diese Offenheit betraf den so genannten Einlauf. Grundsätzlich durfte kein an die Behörde adressiertes Schriftstück zurückgewiesen werden.(82) Das führte zu einem stetigen Strom an Geschäftsstücken, die in der Registratur verzeichnet und von den Bearbeitern in den einzelnen Abteilungen erledigt werden mussten.
Zihals Amt war von seinem persönlichen Element geprägt. Er hatte ja den Olymp verwaltungskultureller Geschlossenheit verlassen und konnte sich nicht mehr darauf beschränken, die an ihn herangetragenen Vorgänge zu erledigen. Er musste selbst aktiv werden, wollte er seine Amtstätigkeit weiter aufrecht erhalten. Dieser Nachteil wurde mehr als aufgewogen durch die Antizipation einer Bestimmung der Kanzleiordnung des Jahres 1923, dass für die Bearbeitung eines Vorganges »immer jene Art zu wählen [sei], die nach den Umständen des Falles als die zweckmäßigste und einfachste anzusehen ist.«(83) Über die Zweck-Mittel-Relation lässt sich ja immer streiten, aber die Entscheidung von Doderers Amtsrat, den gesamten Aktenlauf in sein Inneres zu verlagern, hatte große Vorteile für die Organisation seines Amtes. Die Verfügbarkeit der Vorakten, wie man seine früheren Beobachtungen zu demselben Objekt bezeichnen kann, war unmittelbar, durch einen kognitiven wie körperlich-sinnlichen Vorgang, gegeben und musste nicht über eine Lagerstelle innerhalb der Registratur abgerufen werden.
Die Überlegenheit von Zihals Speicherlogik, die in gewisser Weise den digitalen Akt ja vorweggenommen hatte, zeigt sich im Vergleich mit der Umsetzung der Kanzleireform in den Ämtern staatlicher Behörden. Dort war die konventionelle, noch ganz dem Papier vertrauende Aktenführung ein echtes Hemmnis zur Verwirklichung eines neuen, rationellen Kanzleibetriebs. Lassen wir dazu Max Iglseder, Kanzleioberdirektor und Landesregistrator von Oberösterreich, zu Wort kommen:
Sie sollten sich dazu äußern, welche konkreten Folgen die Neugestaltung der Aktenmanipulation haben würde. Wie sah diese Reorganisation konkret aus? Zur verbesserten Kontrolle des Aktenlaufs und zur erhöhten Übersichtlichkeit sollte die zentrale Einlaufstelle und der zentrale Expedit beibehalten, die eigentliche Aktenmanipulation jedoch in fünf thematisch definierten Kanzleiabteilungen ausgelagert werden. Dort sollte das Eingangsbuch geführt und die gesamte Evidenzhaltung der Akten erledigt werden. Waren die Beamten der Hilfsämter und damit die Herren und Bewahrer der
Die vier Experten begrüßten explizit die Vereinfachung in der Adressierung von Akten. Sie griffen dabei eine Art

Die Rationalisierung im Zuge der neuen Kanzleiordnung machte Schluss mit diesem Mehrwert und reduzierte die Akten-Adressen auf ein Minimum, ohne die für den neuen Aktenlauf wichtigen Informationen über die Zuordnung des Vorgangs zu Ressorts auszublenden. Die neuen Bezeichnungen für die Geschäftsstücke gaben deshalb die Bruchzahl auf, setzten an den Beginn die dafür zuständige Kanzleiabteilung, gefolgt von der Kennzeichnung des Gegenstandes, wobei die laufende Nummer nach dem Schrägstrich die einzelnen Geschäftsstücke zu einer Angelegenheit auswies. Die letzte Position bezeichnete den für die Bearbeitung zuständigen Landesrat:
Welche Verwirrung hier entstehen konnte, zeigt sich in den Geschäftszahlen, die in einem Gutachten zur Reform und in der abschließenden Verfügung verwendet wurden, um die neue Notationsform zu veranschaulichen. Der Durchführungserlass zur Amtsverfügung vom 2. Oktober 1926 verwendete noch dieselbe Notation wie der fünf Tage später entstandene Bericht von Kanzleidirektor Dirr aus der Registratur beispielhaft für eine Armensache aus dem Bezirk Ried/Innkreis: II 635/1 Schw. Die Zuständigkeit für den Bezirk Ried und damit auch für die dortigen Armensachen lag demnach bei Landesrat Josef Schwinner (CSP). Das war falsch. Schwinner war laut Landesratsprotokoll vom 7. Juli 1925 für die Bezirke Perg und Steyr-Land zuständig.(90) Bei der Endredaktion des Durchführungserlasses wurde der Fehler entdeckt und die korrekte Form eingesetzt: II 635/1 G. Damit wurde Landesrat Anton Gasperschitz (CSP) richtig als zuständige Entscheidungsinstanz bezeichnet.(91)
Dieses Detail unterstreicht das Risiko, das die Offenheit gegenüber der Umwelt bei grundlegenden internen Abläufen mit sich bringen konnte. Die Adressierung war ein zentrales Moment des Geschäftsgangs, weil sie Informationen über laufende und vergangene Vorgänge innerhalb des Entscheidungssystems verfügbar machte. Das war von existenzieller Bedeutung für die Verwaltung des modernen Staates. Ein Vorgang musste nach seinem Eintreffen in der Kanzlei im Datenraum der Registratur verortet werden, um darauf bezogene frühere Geschäftsstücke ermitteln und dem Akt beischließen zu können.(92) Die staatliche Verwaltung nutzte ihre rasch akkumulierenden Datensammlungen nicht nur zum Aufbau von programmspezifischen Wissensbeständen,(93) sondern als Ausgangspunkt für lokale Entscheidungssammlungen. Diese waren eine wichtige Voraussetzung für sachbezogene, neutrale und kompetente Bearbeitung komplexer Sachverhalte, wie sie durch einen rasch expandierenden Staat und die zunehmende Bereitstellung von öffentlichen Gütern seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts notwendig wurde.(94) Das stellte die Verarbeitungskapazität der Bürokratie vor große Herausforderungen. Die stetige Zunahme von Beamtenstellen und Gebäuden und die damit einhergehende erhöhte Sichtbarkeit und Bedeutung des öffentlichen Dienstes wurde mehr als wettgemacht durch die noch rascher wachsende Zahl der aktenmäßigen Vorgänge.
Die Verwaltung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts steckte in einem Dilemma fest. Der Zugriff auf Vorakten und bereits getätigte Entscheidungen wurde angesichts der sich etablierenden Politikfelder(95) immer wichtiger. Gleichzeitig wurde es immer schwieriger, diesen Zugriff mit den bestehenden Instrumenten auch sicherzustellen. Die Verwaltungsreformdebatte dieser Zeit setzte sich gezielt auch mit der Kanzleireform auseinander, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Eine zentrale Rolle spielte in den Lösungsansätzen die Registratur. Die zentral erstellten Register- und Protokollbände des damaligen österreichischen Staates beeindrucken noch heute aufgrund ihres Umfangs. Die Statthalterei von Niederösterreich, eine wichtige staatliche Regionalbehörde, produzierte jährlich
Die Registratur und die Kanzlei erhalten eine Rolle zugeschrieben, für die am besten das Sprachbild der panoptischen Beobachtung passt. Sie sollten nicht nur die Bewegung der Akten dauernd im Blick behalten, sondern auch den rasch wachsenden Bestand an Wissen und Entscheidungen anhand ihrer, praktisch und nicht theoretisch entwickelten Instrumente überwachen.(97) Einen anderen Anspruch hatte auch Zihal nicht. Seine Kontrolle bezog sich auf die Objekte in seinem terrestrischen Sternenhimmel. Seine libidinösen Vorgänge konnte er nur solange durch die Nutzung der
War Doderer auch in dieser Hinsicht der Autor einer Mitschrift von bürokratischen Prozessen? Auf der rein phänomenologischen Ebene wohl nicht. Die emotionale Befindlichkeit von einzelnen Beamten lässt sich nur in Ausnahmefällen ermitteln und wäre für diese Überlegungen auch gar nicht relevant. Doderers Auseinandersetzung mit der Rationalisierung von Zihals Geschäftszahlen erschließt sich als Mitschrift, wenn man sie aus der Perspektive der oben eingeführten Leitdifferenz zwischen Offenheit und Geschlossenheit liest. Macht und Kontrolle bezieht sich im Amtsbetrieb von Zihal nach außen, auf die Objekte seines sexuellen Begehrens. Sie werden ihrer romantischen Attribute entkleidet und einem objektivierenden Verfahren zur Befriedigung seines nicht diskursfähigen libidinösen Begehrens unterworfen. Zihals sexuelles Begehren kann durch den Einsatz
Doderers Roman kann auch deshalb als Mitschrift bürokratischer Rationalisierung gelten, weil er mit der bürokratischen Aufladung von Zihals voyeuristischer Tätigkeit einen Problemkomplex anspricht, der für die Entwicklung des Staates und die Nutzung der
Aus meiner Sicht ist die öffentliche Verwaltung als Organisation ganz besonders von dieser Problematik getroffen. Die Geschäftsordnungen, Aktenläufe und selbst die Festlegung von Geschäftszahlen können nicht
Doderers Roman »Die erleuchteten Fenster« ist bereits intensiv innerhalb der Literaturwissenschaft behandelt worden.(103) Mein Beitrag steht außerhalb dieser werkgeschichtlichen und poetologischen Reflexion. Ich habe die Darstellung von bürokratischer Persona und von verwaltungstechnischen Verfahren als eine
Die
Die Inszenierung von Zihals bürokratischer Persona, vermittelt über die Nutzung der
Lässt sich Doderers Roman als eine Mitschrift der öffentlichen Verwaltung begreifen? Ich sehe für eine solche Lektüre zwei Ansatzpunkte. Der erste betrifft die Thematisierung der Leitdifferenz von Offenheit und Geschlossenheit durch Doderer. Wenn man die Menschwerdung Zihals aus dieser Perspektive betrachtet, bewegt sich der Amtsrat von einem System der verwaltungskulturellen Geschlossenheit mit einem panoptischen Kontrollanspruch im Hinblick auf die Akten, Vorgänge und Wissensbestände hin zu einer neurotischen Abschließung seiner libidinösen Regungen, die durch die Nutzung von kleinen Formen bürokratischer Praxis umgesetzt wird. Die Offenheit des Verwaltungssystems gegenüber der Verwaltungsumwelt, die in strukturierter Form durch einen diskursfähigen Einlauf organisiert wird, bricht im Prozess von Zihals Menschwerdung zusammen und wird ersetzt durch eine libidinös gesteuerte, distanzlose Bezugnahme auf seinen terrestrischen Sternenhimmel.
Die Katharsis von Zihal schafft einen erneuten Ausgleich zwischen Offenheit und Geschlossenheit. Der im Ernst seiner bürokratischen Persona ruhende und damit in sich geschlossene Amtsrat öffnet sich der romantischen Liebe zur kleinbürgerlichen, wenn auch etwas neurotischen Postoberoffizial Opladek. Kann man dieses Happy End auch auf die öffentliche Verwaltung übertragen? Das wäre ja die wesentliche Anforderung an eine solche Lektüre. Aus meiner Sicht könnte man in diesen Roman die Aufforderung an die Verwaltungsreform hineinlesen, sensibler auf die gesellschaftlichen Brüche zu reagieren, damit die Verwaltung auch tatsächlich in den
Ich bedanke mich bei den Herausgeberinnen und dem Gutachter für ihre Anregungen.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 41.
Zu den Beschreibungskategorien für diese Frauen vgl. Sigrid Nieberle: Metalepsen. Heimito von Doderer: »Die erleuchteten Fenster oder Die Menschwerdung des Amtsrates Julius Zihal«, in: Sigrid Nieberle/Elisabeth Strowick (Hg.): Narration und Geschlecht. Texte – Medien – Episteme, Köln 2006, S. 117–139, hier S. 134.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 40.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 119.
Nieberle: Metalepsen, S. 129, 136, sieht die Menschwerdung in einer Bereitschaft zum zwischenmenschlichen Austausch und zur reflexiven Position in der Welt.
Vgl. Stefan Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre. Bürokratie bei Heimito von Doderer, in: Stefan Winterstein (Hg.): ›Er las nur dieses eine Buch‹. Studien zu Heimito von Doderers ›Die erleuchteten Fenster‹, Würzburg 2009, S. 237–342, hier S. 256, 297; zur „produktiven Selbstentfremdung“ im Zuge der Menschwerdung vgl. Klaus Nüchtern: Kontinent Doderer. Eine Durchquerung, München 2016, S. 45; zu Doderers Roma als Metalepse vgl. Nieberle: Metalepsen, S. 120.
Zum Voyeurismus von Doderer als Vorbild vgl. Nüchtern: Kontinent Doderer, S. 43f.
Doderer nutzt die
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 14: »Aber ich bin ein ernster Mensch. Und ich lese keine Romane. Literatur ist für mich das, was ein Jud’ vom anderen abschreibt.« Zum Antisemitismus bei Doderer vor dem Hintergrund seiner Unterstützung des Nationalsozialismus vgl. Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 95–100.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 38f.
Zu den Geschäftszeichen und ihre Bedeutung in der Organisation des Aktenlaufs vgl. Michael Hochedlinger: Aktenkunde. Urkundenund Aktenlehre der Neuzeit, Wien 2009, S. 106–116.
Zu diesem Konzept vgl. Kerstin Stüssel: In Vertretung. Literarische Mitschriften von Bürokratie zwischen früher Neuzeit und Gegenwart, Tübingen 2004, S. 23–36. Wenn man die ›erleuchteten Fenster‹ als eine Mitschrift der Bürokratie begreift, kann man einen fruchtbaren dritten Weg in der Auseinandersetzung mit diesem Roman beschreiten. Man muss darin nicht das Abbild der Bürokratie sehen, man muss sich aber auch nicht, wie Winterstein, darauf beschränken, hier nur die Darstellung des »maximal distanzierten, von der Ordnung der Objekte besessenen Blick« vorzufinden. (Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 296) Man kann vielmehr die engen Verbindungen zwischen bürokratischer Persona, der Logik des Verwaltungshandelns, der Nutzung von
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Bd. 3: Die Philosophie des Geistes, Berlin 1845, § 462, S. 347f.
Hans-Ulrich Derlien/Doris Böhme/Markus Heindl: Bürokratietheorie. Einführung in eine Theorie der Verwaltung, Wiesbaden 2011, S. 79.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 10, 13f.
Deshalb eröffneten sich für Zihal keine Karriereoptionen nach der Pensionierung im Bereich der Wirtschaft oder gar der Literatur, wie sie für ehemalige Beamte der Ersten Republik dokumentiert sind. Vgl. dazu Therese Garstenauer: Beamte im Un/Ruhestand. Überlegungen zu österreichischen Staatsbediensteten, in: ÖZG 22 (2011), S, 81–111, hier S. 93–102.
Vgl. zur sozialen Herkunft Zihals aus dem Kleinbürgertum und die aus diesem Grund idealisierte Beamtenexistenz vgl. Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 255f. Zur Persona der Beamten vgl. Peter Becker/Rüdiger von Krosigk, New Perspectives on the History of Bureaucratic and Scientific Subjects, in: Peter Becker/Rüdiger von Krosigk (Hg.): Figures of Authority. Contributions towards a Cultural History of Governance from the Seventeenth to the Twentieth Century, Brüssel 2008, S. 11–26, hier S. 24f.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 29.
Zur mangelnden produktiven Selbstentfremdung vgl. Nüchtern: Kontinent Doderer, S. 45.
Zur Dienstpragmatik als Orientierungspunkt vgl. Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 265–283; Stefanie Augustin: In die Fenster geschaut. Anspielungen und Motive in Heimito von Doderers ›Die erleuchteten Fenster‹, in: Winterstein (Hg.): ‚Er las nur dieses eine Buch‘, S. 21–71, hier S. 27f.
Renate Mayntz: Role Distance, Role Identification, and Amoral Role Behavior (1970), in: Ariane Leendertz/Uwe Schimank (Hg.): Ordnung und Fragilität des Sozialen. Renate Mayntz im Gespräch, Frankfurt am Main 2019, S. 137–148, hier S. 142f.; Doderers Roman bezieht sich durchaus auf diesen Komplex, wie Wendelin Schmidt-Dengler argumentiert: kommentiert mit diesem Roman die Destruktivität eines rein formal begründeten Handlungssystems in der Bürokratie des Nationalsozialismus: Wendelin Schmidt-Dengler: Jederzeit besuchsfähig. Über Heimito von Doderer, München 2012, 115–120; vgl. dazu auch Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 297f.
Vgl. dazu Mayntz: Role Distance, S. 146.
Augustin sieht in dem »ironischen Pathos«, das Doderer bei den Hinweisen auf die Anwendung der bürokratischen Formen auf das Privatleben einsetzt, einen Distanzierungsgestus: Augustin: In die Fenster geschaut, S. 30f.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 135.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 96f.; zu den moralischen Anforderungen an Beamte im Sinne des Anstands und der Amtsehre vgl. Peter Becker: Decency and Respect. New Perspectives on Emotional Bonds between State and Citizens, in: Administory 3 (2018), S. 80–95, hier 80–83. Zur Amtsehre bei Doderer vgl. Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 237–342.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 186 und 187; vgl. dazu Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 170, sowie Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 300–303.
Vgl. dazu Peter Becker: Der Staat – eine österreichische Geschichte?, in: MIÖG 126 (2018), S. 317–340, hier S. 331f.; zur Weltfremdheit der österreichischen Bürokratie bei Doderer vgl. Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 258f.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 7.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 28; s. dazu auch Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 45, zum ›selbständigen‹ Charakter einer staatlichen Behörde, die letztlich frei jeder Zweckmäßigkeit existiert hätten.
Vgl. Kirsten Winther Jorgensen: Towards the Angels. British Zoology and the ›Persona Sapientis‹, ca. 1660–1800, in: Becker/von Krosigk (Hg.): Figures of Authority, S. 127–150, hier S. 129–134.
Zur Transposition als eine »Verkleinerungsoperation« vgl. Maren Jäger/Ethel Matala de Mazza/Joseph Vogl: Einleitung, in: Maren Jäger/Ethel Matala de Mazza/Joseph Vogl (Hg.), Verkleinerung. Epistemologie und Literaturgeschichte kleiner Formen, Berlin 2021, S. 1–12, hier S. 9f.
Vgl. Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 287–290; zur Unterscheidung zwischen ›dünen‹ und ›dicken‹ Regeln vgl. Lorraine Daston: Rules. A short history of what we live by, Princeton 2022.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 136.
Luhmann verweist auf die Steuerungsfunktion einfacher Interaktionssysteme in Organisationen, die Verhalten auch jenseits einer Disziplinierung bestimmen. Anzeichen eines solchen Verständnisses finden sich auch bei Doderers Charakterisierung seines Amtsrates Julius Zihal: Niklas Luhmann: Überlegungen zum Verhältnis von Gesellschaftssystemen und Organisationssystemen, in: ders.: Schriften zur Organisation, Bd. 2, hg. Ernst Lukas/Veronika Tacke, Wiesbaden 2019, S. 3–10, hier S. 6. Die Kolonialisierung der Lebenswelt von Beamten durch die bürokratische Persona findet sich in zahlreichen literarischen Mitschriften der Verwaltung. Vgl. dazu Sabine Zelger: Das ist alles viel komplizierter, Herr Sektionschef! Bürokratie – literarische Reflexionen aus Österreich, Wien 2017, S. 276–278.
Vgl. dazu den Verweis bei Pierre Bourdieu: Über den Staat: Vorlesungen am Collège de France 1989–1992, Berlin 2017, S. 88f.
Becker/Krosigk: New Perspectives, S. 24–26; vgl. auch Robert Vance Presthus: The Organisational Society, London 1979, S. 16; sowie Lorraine Daston/Peter Galison: Objectivity, New York 2007, S. 223–228.
Es wäre vermessen, Zihal auf eine Ebene mit dem bedeutenden preußischen Staatskanzler Hardenberg zu stellen. Die Bemerkung von Cornelia Vismann zu dieser Leuchtgestalt preußischer Staatskunst lässt sich jedoch auch für den fiktiven Beamten der österreichischen Habsburgermonarchie nutzbar machen. Vismann sieht bei Hardenberg die »Tendenz zur aktenmäßigen Verwaltung des eigenen Lebens« — eine Tendenz, die Doderer seinem Protagonisten in höchstem Maße zuschreibt: Cornelia Vismann: Das Recht und seine Mittel, Frankfurt/Main 2012, S. 132–141.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 15.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 20; zur poetologischen Diskussion der Aktwerdung vgl. Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 148.
Zur Rolle der Akten als Selbstverwaltungstechnik vgl. Cornelia Vismann: Akten. Medientechnik und Recht, Frankfurt/Main 2000, S. 235–242.
Vgl. dazu Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 138f.
In diesem Sinn ist die Positionierung Zihals durch Winterstein — »ein Verwalter gerät an sich selbst und wird dabei zurechtgerückt …« — irreführend; vgl. dazu Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 259. Denn das Zurechtrücken im Sinne der Menschwerdung von Zihal ergab sich nicht aus der Anwendung bürokratischer Handlungslogik auf sein Privatleben.
Nüchtern: Kontinent Doderer, S. 49; Zihal entwickelte auch keine neue Sprache für seine »Protokollierungspraxis«, wie Winterstein argumentiert (Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 299), sondern entwickelt ein System von Geschäftszahlen.
Zu Zihal als Autor vgl. Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 174f.; zum Zusammenfallen von Verwaltetem und Verwaltendem vgl. Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 290.
Ich beziehe hier eine andere Position als Winterstein (Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 294). Für ihn ist der erste Schritt der Menschwerdung von Zihal durch die Wahrnehmung von dessen sexuellen Bedürfnissen erreicht. Aus meiner Sicht waren die libidinösen Antriebe von Zihal nicht bewusst als sexuelle Bedürfnisse wahrgenommen. Dieser Schritt erfolgt erst mit seiner erfolgten Menschwerdung.
Doderer blendet die Körperlichkeit des Amtsrats Zihal weitgehend aus. In der Fortführung des Gedankens, dass Zihal sein eigenes Archiv sei, könnte man den spezifischen Charakter dieses Archivs in enger Beziehung zu seinem Körper und zu den von ihm beobachteten Körpern bestimmen. Vgl. zum Körper als Archiv Hannelore Bublitz: Das Archiv des Körpers. Konstruktionsapparate, Materialitäten und Phantasmen, Bielefeld 2018, bes, Kap. 1.
Zur ›Landkarte des Aktenbestandes‹ als einem ursprünglichen Hilfsmittel zur Orientierung in einer Registratur vgl. Angelika Menne-Haritz: Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen. Grundlagen für ein Referenzmodell für Elektronische Bürosysteme, Heidelberg 1999, S. 64.
Zum Wechsel der Ordnungsmuster vgl. Nieberle: Metalepsen, S. 119.
Die Adressierungsfunktion war in diesem Fall nicht nach Außen gerichtet – an die Nutzer aus Behörden oder an Externe – sondern war ein ausschließlich internes Verweissystem: Vgl. zum Verweissystem von Findbüchern: Liam Cole Young: Lists and other fragments from a general history of compression, in: Jäger/de Mazza/Vogl (Hg.): Verkleinerung, S. 189–204, hier S. 195f.
Das Taxamt war nicht die einzige Organisation, die auf eine »papereality« setzte, d.h. auf »written representations, that take precedence over the things and events represented«. Vgl. David Dery: ›Papereality‹ and Learning in Bureaucratic Organizations, in: Administration & Society 29 (1998), S. 677–689, hier S. 678. Für Zihal hatte das ideale Amt den Zwischenschritt der ›representation‹ bereits hinter sich gelassen und existierte ohne direkten Bezug zur Umwelt – als »l’art pour l’ar«“: Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 45.
Vgl. Becker: Staat, S. 328–331.
Doderer folgt hier seiner eigenen Lesart der Apperzeptionstheorie, um die das Einlassen des Protagonisten auf die Objektwelt auszuloten. Vgl. dazu Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 102–105. Ich stelle diesen Zugang in einen psychoanalytischen und nicht in einen literarischen Kontext im Hinblick auf die narrative Gestaltung der Menschwerdung von Zihal. Zur literarischen Leseweise vgl. Augustin: In die Fenster geschaut, S. 60–62.
Damit kann Doderer die Spannung zwischen Distanz und Distanzlosigkeit sehr gut bearbeiten, auf die Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 127, hinweist. Die Distanzlosigkeit ergibt sich ja aus der anfänglich rein libidinös bestimmten Offenheit. Der durch Distanz bestimmte Umgang mit Menschen war dagegen auf den geschlossenen Raum der bürokratischen Welt und ihres Parteienverkehrs bezogen. Siehe dazu Alexander Preisinger/Stefan Winterstein: ›Die erleuchteten Fenster‹ — ein ›Wieder Roman‹? Über Raum und Ort in Doderers Zihaloide, in: Winterstein (Hg.), ›Er las nur dieses eine Buch‹, S. 189–212, hier S. 194f. Erst als sich diese Offenheit in den Bahnungen einer romantischen Beziehung bewegt, konnte Zihal soziale und persönliche Distanz in einem ›offenen‹ System leben.
Vgl. dazu Evelyn Polz–Heinzl: Zihal aus dem Sack. Zur Sinneswahrnehmung in Heimito von Doderers ›Die erleuchteten Fenster‹, in: Winterstein (Hg.), ›Er las nur dieses eine Buch‹, S. 225–235, hier S. 233.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 179f. Augustin verfolgt in der Lektüre dieser Textstelle einen alternativen Zugang und verweist auf die humoristische Entlastung, die der Autor dem Treiben seines Protagonisten gewährt: Augustin: In die Fenster geschaut, S. 34.
Es fehlte ihm jedoch der Einblick in die konkreten Abläufe des Verwaltungshandelns. Diese blieben in seinen literarischen Arbeiten ausgeblendet. Vgl. dazu Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 245.
Menne-Haritz: Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen, S. 111.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 15f; zur literarischen Kongruenz von Form und Inhalt bei der Beschreibung von Zihals ehemalige Arbeitsplatz und des abweisenden Umgangs mit Petenten vgl. Augustin: In die Fenster geschaut, S. 58f.
Vgl. Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 162f.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 16.
Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 150 betont bereits in der Auseinandersetzung mit der Gestaltung von Form und Inhalt, dass er die »alte Form, die zugleich sein Inhalt war, auf die reine Form zurückführt …«.
Eine weitere spannende Perspektive zur verwaltungskulturellen Bestimmung des Zihalschen Handelns würde die gezielte Nutzung von verwaltungssprachlichen Wendungen im Roman betreffen. Vgl. dazu Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 283–293.
Menne-Haritz: Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen, S. 109.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 7.
Zur Registratur als der Steuerungszentrale einer Behörde vgl. Menne-Haritz: Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen, S. 121.
Vgl. Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 130f. zur rein ichbezogenen Sexualität von Zihal.
Michael Hochedlinger: Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Wien 2009, S. 69.
Vgl. zu den Ablagesystemen im modernen Büro Vismann: Akten, S. 276–299.
»Sie trug lange Strümpfe, Hemd und Höschen, Arme und Schultern ruhten weiß im Licht (das war jetzt der Augenblick, da der Amtsrat den Schnurrbart strich)«: Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 35.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 8.
»Ungerührt schwebte der gewesene Amtsrat über allem was war, überall in gleichem Abstand davon. Und so lächelte er nur …«: Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 188. Zirnbauer sieht die Menschwerdung im Umschwung von Apperzeptionsverweigerung hin zu Apperzeption, mit der die Form schliesslich von der Wirklichkeit eingeholt wurde: Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 151. Im Blick auf das Zwischenreich sehe ich aus einer psychoanalytischen Perspektive die Entstehung neuer Bahnungen im Umgang mit dem Objektbereich.
Die Beziehung zwischen Zihal und Doderer beruhte auf Fantasie, sprachlicher Brillanz und Identifikation. So hatte ihn seine Verlegerin einmal als »Literatur-Zihal« bezeichnet: Heimito von Doderer: Zur Matinée bei Dr. Berger. Herausgegeben und kommentiert von Gerald Sommer, in: Winterstein (Hg.), ›Er las nur dieses eine Buch‹, S. 13–18, hier S. 16. Diese Identifikation bestand laut Thomas Zirnbauer auf einer fundamentalen Ebene, weil Doderer sich zunehmend für die Sprache als selbstgenügsames Ausdrucksmittel entschied: Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 88f. u. 154.
Doderer: Sie erleuchteten Fenster, S. 170f.; diesen Schritt hin zu einer neuen Form der Adressierung lese ich nicht als die Entwicklung einer neuen Sprache (s. dazu Zirnbauer: Lesen – Schreiben – Sprache, S. 169), sondern als Nutzung der
Vgl. Winterstein: Torpedierung und Apologie der Amtsehre, S. 299.
Kanzleiordnung für die Bundesministerien. Genehmigt mit Beschluss des Ministerrates vom 18. Juli 1923, Wien 1947, 1f.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 170.
Vgl. Kielmansegg: Geschäftsvereinfachung, S. 22f.
Kielmansegg: Kaiserhaus, S. 72.
Vgl. Erlass vom 21. Oktober 1926 mit Erläuterungen zur Durchführung der Amtsverfügung vom 30. Dezember 1925 zur Einführung der Kanzleireform, OÖLA, Landesausschuss Allgemeine Reihe, B II 5 348.
Exemplarisch verweise ich für die Jahrhundertwende auf die Darstellung der Studienreisen von Hohenbruck und Sacken nach Preußen, Sachsen und Baden: Kielmansegg: Geschäftsvereinfachung, 22f.
Kanzleiordnung für die Bundesministerien, S. 9.
Kanzleiordnung für die Bundesministerien, S. 2.
Gutachtliche Äußerung des Amtsvorstandes Max Iglseder vom 19.11.1925, OÖLA, B II 5 348 (Unterstreichungen im Original).
Vgl. Peter Becker: ›… dem Bürger die Verfolgung seiner Anliegen erleichtern‹. Zur Geschichte der Verwaltungsreform im Österreich des 20. Jahrhunderts, in: Heinrich Berger et al. (Hg.): Politische Gewalt und Machtausübung im 20. Jahrhundert. Zeitgeschichte, Zeitgeschehen und Kontroversen. Festschrift für Gerhard Botz, Wien 2011, S. 113–138, hier S. 124f.
Stellungnahme der steierm. Landesregierung (Burg) zu der von der Ersparungskommission mit der Note Zl. 71/III/A ex 1921 eingeleiteten Aktion, betreffend den Arbeitsabbau in der staatlichen Verwaltung, OÖLA, Statthalterei-Präs-42-1661-Reform, 11.
Bericht über die bei den Landes-Kanzleiämtern geplanten Reformen, Linz, 18.11.1925, OÖLA B II 5 348. Zur Neuausstattung der Registraturzimmer vgl. Michael Dirr: Bericht über die Einführung der Kanzleireform 1927 vom 7.10.1926, OÖLA, B II 5 348; die Verwaltungsreformprojekte vor 1914 standen den Beiträgen der nicht-akademisch ausgebildeten Beamten deutlich skeptischer gegenüber. Vgl. dazu Menne-Haritz: Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen, S. 158.
Menne-Haritz: Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen, S. 158.
Durchführung der Amtsverfügung vom 30. Dezember 1925 zur Kanzlei-Reform, 2.10.1926, OÖLA B II 5 348.
LRProt 7.7.1925, 4.
Durchführung der Amtsverfügung (2.10.1926); Dirr: Bericht (7.10.1926).
Vgl. Kanzleiordnung für die Bundesministerien, S. 11f.
Zum Wissen des Staates vgl. die Beiträge in Peter Collin/Thomas Horstmann (Hg.): Das Wissen des Staates. Geschichte, Theorie und Praxis, Baden-Baden 2004.
Vgl. Pieter M. Judson: The Habsburg Empire: a New History, Cambridge 2016, S. 336f.; sowie John Deak: Forging a Multinational State. State Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War, Stanford 2015, S. 249f.; aus einer vergleichenden Perspektive vgl. Gary B. Cohen: Neither Absolutism nor Anarchy. New Narratives on Society and Government in Later Imperial Austria, in: Austrian History Yearbook 29/1 (1998), S. 37–61; vgl. dazu Becker: Staat, S. 321f.
Aus der Perspektive der Kabinettskanzlei des österreichischen Kaisers vgl. die Beiträge in dem Sammelband: Clemens Ableidinger et al. (Hg.): Im Büro des Herrschers. Neue Perspektiven der historischen Politikfeldanalyse, Göttingen 2022.
Zu den Reformplänen, mit denen man dieser Herausforderung begegnen wollt, vgl. Peter Becker: The Administrative Apparatus under Rekonstruktion, in: Franz Adlgasser/Fredrik Lindström (Hg.): The Habsburg Civil Service and Beyond: Bureaucracy and Civil Servants. From the Vormärz to the Inter-war Years, Wien 2019, S. 233–257.
Zur fehlenden theoretischen Durchdringung dieser Instrumente vgl. Menne-Haritz: Geschäftsprozesse in öffentlichen Verwaltungen, S. 162–164.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 172f.
Doderer: Die erleuchteten Fenster, S. 173.
Damit soll keinesfalls das Eingriffspotenzial der Staatsverwaltung dieser Zeit ausgeblendet werden. Es wurde von der zeitgenössischen Kritik, vor allem in den späten 1940er-Jahren, durch Adorno und Horkheimer nachhaltig kritisiert: Theodor W. Adorno/Max Horkheimer/Eugen Kogon: Die verwaltete Welt oder: Die Krise des Individuums, in Gunzelin Schmid Noerr (Hg.): Max Horkheimer, Gesammelte Schriften 13, Nachgelassene Schriften 1949–1972, Frankfurt am Main 1989, S. 121–142; vgl. dazu Peter Becker: Bürokratie in: Docupedia-Zeitgeschichte (30.08.2016), S. 15–18.
Jacques Lacan: Die Ethik der Psychoanalyse, Weinheim 1996, S. 65.
Vgl. Becker: Staat, S. 318f; Becker: Administrative Apparatus, S. 248–251.
Vgl. Stefan Winterstein: Bibliographie der Sekundärliteratur zu Heimito von Doderers ›Die erleuchteten Fenster‹, in: Winterstein (Hg.): ›Er las nur dieses eine Buch‹, S. 415–421.
Vgl. zur Nutzung von Zihals Lektüre der Dienstpragmatik für die Deutung von Doderers Roman als Mitschrift der Verwaltungskultur der Habsburgermonarchie Peter Becker: Rechts, Staat und Krieg. ›Verwirklichte Unwahrscheinlichkeiten‹ in der Habsburgermonarchie, in: Administory 1 (2016), S. 28–53, hier S. 41–45.