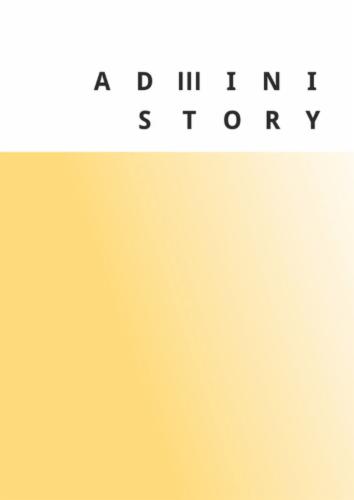Schreibwohnung, Akten und Archiv. Literarisches paperwork bei Elfriede Jelinek und Friederike Mayröcker
Publié en ligne: 09 juil. 2025
Pages: 127 - 142
DOI: https://doi.org/10.2478/adhi-2023-0003
Mots clés
© 2022 Sophie Liepold, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Das Archiv operiert durch Transformationsprozesse: Ganz gleich, ob es sich um bürokratische Akten oder schriftstellerisches Material handelt, das institutionell abgelegt werden soll, es gilt nach Jacques Derrida: »Die Archivierung bringt das Ereignis in gleichem Maße hervor, wie sie es aufzeichnet.«
(1)
Wenn etwa Goethe die Verwaltung seiner Papiere in beinahe amtlicher Manier und höchstpersönlich besorgte und sich dabei Überschneidungen zwischen dem Verwaltungs- und dem Literaturarchiv ergeben
(2)
, unterscheiden sich die Archivkulturen jedoch in Materialbeschaffung und Ordnungslogiken grundlegend. In jedem Fall ist Literatur ohne spezifisches Verhältnis zu Archiv und Verwaltung nicht denkbar: Spätestens die Einrichtung von Literaturarchiven im deutschsprachigen Raum um 1900 provoziert eine Haltung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu ihrem eigenen Material. Indem das »Nachlassbewusstsein«, das im 19. Jahrhundert entsteht, »zu einem Antrieb poetischer Produktivität, zu einer werkbildenden Kraft« wird und entsprechend dem Goethe’schen Konzept des Nachlasses mussten Autorinnen und Autoren ab einem gewissen Bekanntheitsgrad damit rechnen, dass ihre Papiere nach ihrem Tod aufbewahrt und für die Forschung zugänglich gemacht werden.
(3)
Vor allem ökonomischer Gründe wegen und einem zunehmenden Interesse der Literaturwissenschaft an Gegenwartsliteratur geschuldet, gewinnt schließlich im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ein neues Konzept stetig an Aufmerksamkeit, sowohl vonseiten der Archive als auch der Autorinnen und Autoren: der literarische Vorlass. Gemeint ist der Verkauf von schriftstellerischem Material bereits zu Lebzeiten, was auf eine Transformation des Literaturarchivwesens, des Literaturmarkts und des Kulturbetriebs verweist sowie Gegenwartsliteratur und ihre Archivierung in ein eigentümliches Verhältnis stellt. Die Aufnahme schriftstellerischen Materials in ein Archiv bedingt somit in jedem Fall eine bürokratische Transformationsleistung, die wiederum literarisch zum Thema gemacht werden kann. Der Archivierungsvorgang wird selbst beobachtet und zum literarischen Gegenstand, während dadurch spezifische
»Archiv oder Büro. Beides wird ineinander übersetzbar, denn die Aufbewahrung generiert die Arbeit mit dem Aufbewahrten.«
(4)
Und aufbewahrt werden in jedem Fall Akten, »die umfassenden Aufzeichnungsapparate«, die prozessgeneriert, 〉autorlos〈 und selbstdokumentarisch sind und von Aktenvermerken gesteuert werden.
(5)
Wenn Akten als Beweismittel etwa in juristischen Belangen vor Gericht eingesetzt werden sollen, muss ihre Genese aufgrund von Verfahrensordnungen nachvollziehbar und gerechtfertigt sein, denn erst dadurch ergibt sich ihre Beweiskraft. Bruno Latour hat Akten in diesem Sinne als »Ursprung aller essentiellen Macht«
(6)
bezeichnet. Als gegen die Autorin Elfriede Jelinek ein steuerliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, das sie zum Anlass für ihren im Jahr 2022 am Deutschen Theater Berlin uraufgeführten (Regie: Jossi Wieler) und im Rowohlt-Verlag erschienenen Theatertext »Angabe der Person« nimmt, legt die Behörde als erste Verfahrenshandlung einen Akt zu ihr an. Im Laufe der Ermittlungen werden zahlreiche Papiere aus ihrer Wohnung konfisziert, E-Mails und anderes digitales Material sichergestellt und zum Akt genommen:
Durch die Beschlagnahme durchläuft Jelineks analoges und digitales Material einen Transformationsprozess: Landen Schriftstücke erst einmal in einem Akt – der sich zunächst durch nichts anderes konstituiert als durch einen Aktenordner im Büro oder am Computerbildschirm – können sie eine gewisse Wirkungsmacht entfalten und als Beweismaterial fungieren.
(8)
Die Werkmaterialien von Jelinek erhalten somit einen neuen Status. Dokumentierten sie auf Jelineks Schreibtisch und abgelegt in ihrer Wohnung die Entstehung ihres Werks, werden sie durch den bürokratischen Ablauf und die Amtshandlung der Steuerfahndung als potenzielle Beweismittel deklariert. Der Zugriff der Bürokratie auf die Autorin evoziert nun einen Kampf um die Schriftmacht und die Deutungshoheit der Dokumente. Da sie nicht nur in Wien, sondern aufgrund ihrer Ehe auch in München wohnt, soll sie nicht nur in Österreich, sondern könnte sie auch in Deutschland als steuerpflichtig gelten. Das Verfahren wurde schlussendlich eingestellt; in »Angabe der Person« setzt sich Jelinek literarisch zur Wehr und schreibt gegen die Staatsmacht an, von der ihre Biografie und ihr Werk einverleibt werden sollen:
Indem die Finanzbehörde sie zur Preisgabe von Informationen zwingt, die sie nicht teilen will und der Staat sich auf eine unnachgiebige Weise Zugang zu ihren privaten und Werkmaterialien verschafft, antwortet Jelinek mit biografischen Angaben, die weit über das behördliche Interesse hinausgehen. Das staatliche
Bereits in dem 2001 erschienen Text »Oh mein Papa« beschreibt Jelinek einen Ausschnitt der Biografie ihres jüdischen Vaters. Dabei greift sie auf ein Schriftstück der nationalsozialistischen Verwaltung zurück, die ihren Vater, der das NS-Regime durch die Ehe mit ihrer nicht-jüdischen Mutter überlebt hat, im Jahr 1939 – ohne die Möglichkeit auf ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung – in den Ruhestand versetzt.
(12)
Jelinek zeigt, wie die »totalitäre Bürokratie« das Leben ihres Vaters verwaltet und »sich in alle Angelegenheiten der Bürger […] mit gleicher Konsequenz und Brutalität einzuschalten« weiß.
(13)
Indem sie das Dokument durch ihre verfremdete Zitierweise in den Text über ihren Vater aufnimmt, setzt sie dem nationalsozialistischen
Jelinek verknüpft ihr Anschreiben gegen das Vergessen und die Kontinuitäten der Gewalt bis in die Gegenwart nur selten mit ihr eigenen Familiengeschichte und gibt in ihren Texten kaum biografische Details preis. Die Sprecherinnenrolle zeichnet sich durch diese Zurückhaltung im autobiografischen Schreiben aus: »Ich sage kaum jemals 〉ich〈, wenn ich mich in meinen Texten meine.«
(15)
Erst als Antwort auf das bürokratische Begehren, das die staatlichen und privaten Bereiche miteinander verschränkt, macht Jelinek 〉Angaben〈 zu Biografien ihrer jüdischen Familienmitglieder. So schildert Jelinek etwa die Ermordung ihrer Tante, die Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungsbürokratie geworden ist. Das tatkräftige Mitwirken deutscher Großkonzerne an der Vorbereitung und Realisierung der Shoah und die Auswirkungen davon auf individuelle Biografien zeigt Jelinek, wenn sie schreibt:
Erst durch die »umfassende Kooperationsbereitschaft« von staatlichen und privaten Akteuren wurde die Shoah möglich.
(17)
Das industrielle Massenmorden und die bürokratischen Vorbereitungen wurden durch banale administrative Tätigkeiten organisiert und von gewöhnlichen Beamtinnen und Beamten durchgeführt.
(18)
Auf jene 〉Schreibtischtäter〈 rekurriert Jelinek in ihrem Bericht von der nazistischen Verfolgung und Vernichtung ihrer Verwandten: »Die Bürokraten wollen doch auch einmal schlafen, doch etwas läßt ihnen keine Ruhe!«
(19)
Wenn Jelinek die Geschichte ihrer Familie zum Thema macht und ihren eigenen Lebenslauf damit in eine Linie stellt, bezichtigt sie sich ungeheuerlicher Anmaßung und stellt stets die Frage, ob es überhaupt ihr 〉Recht〈 sei, von ihrer Familie zu sprechen. Sie führt sich und ihre Schreibhaltung vor und klagt schlussendlich immer auch sich selbst an: »Ich weiß nichts, das ist meine eigene Schuld.«
(20)
Die
Um gegen die Verhältnisse anzuschreiben, produziert Jelinek haufenweise Papier. Fundamental ist dabei immer ihre Sprachkritik, denn die Sprache ist nicht nur ideologisch geprägt und keineswegs unschuldig, sondern erst Sprache ermöglicht Unterdrückung und agiert als dressiertes und machtaffines Wesen stets opportun:
Jelineks poetologisches Programm ist geprägt davon, durch ihre Verfahren diese gewaltvollen Dispositionen der Sprache sichtbar zu machen, indem sie durch Doppeldeutigkeiten, phonetische Ähnlichkeiten und den steten Drang nach Assoziationen die Regelhaftigkeiten der Sprache selbst zum Objekt ihres Schreibens macht. Indem sie ihr Schreiben als ein Sprechen über die Schrift konzipiert
(23)
, wird auch die Amtssprache, die sich nun in Gestalt der Behörde gegen sie wendet, zum Gegenstand. Die Brutalität der Sprache ist in dieser schon angelegt, entzieht sich dem Zugriff der Autorin und lässt ihr dennoch keinen Ausweg: »Ich bin die Gefangene meiner Sprache, die mein Gefängniswärter ist.«
(24)
Den Bürokratien als »unablässig tätige 〉Schreib-Maschinen〈«
(25)
setzt Jelinek ihre zu ausführliche und abschweifende literarische Antwort entgegen, die sich jeglichen administrativen Verwertungslogiken entzieht. Als »Beobachtung zweiter Ordnung«
(26)
macht Literatur den Blick auf die verborgene Seite der Macht, die Perversionen und Geheimnisse sowie die Voraussetzungen der Bürokratie möglich. Indem Jelinek von außerhalb schreibt – nicht nur der Bürokratie, sondern auch der Gesellschaft – ist diese Perspektive möglich. Literatur protokolliert in diesem Sinne die Verhältnisse, nimmt aber eine andere Position ein; sie kann zwar beobachten, aber nicht direkt ins Geschehen eingreifen; sie kann Machtverhältnisse erkennen und benennen, aber die Wirklichkeit nicht abbilden, sondern diese durch sprachliche Mittel 〉zweideutig〈 werden lassen. In ihrer Rede zur Nobelpreisverleihung im Jahr 2004, die sie nur per Video der Schwedischen Akademie zukommen ließ und dabei zwar auf mehreren Bildschirmen präsent, aber dennoch abwesend war, markiert sie den Ort, von dem aus sie schreibt und in dem sie sich selbst positioniert als »Im Abseits«:
Indem das Schreibsubjekt verschwindet und Autorschaft nicht durch Originalität, sondern durch das Zitieren bereits vorhandenen Materials in Frage gestellt wird, und damit im Schreiben (wie im Falle des Ermittlungsverfahrens) reale oder fiktive Instruktionen aufnimmt und diese jedoch
Nicht nur in ihrem Standpunkt, von dem aus sie schreibt, sondern auch medial hat sich Jelinek seit der Nobelpreisverleihung zurückgezogen und entzieht sich in gewisser Weise der Verwertungslogik des konventionellen Literaturbetriebs. Ihren Roman »Neid« veröffentlicht Jelinek 2007/2008 ohne Verlag auf ihrer Webseite (was sie sich als Nobelpreisträgerin leisten kann) und hält vor allem zum Literaturbetrieb, den sie als »extrem korrupt und nepotistisch« (29) bezeichnet, großen Abstand. Doch bereits seit ihren literarischen Anfängen nimmt sie eine Sonderrolle im literarischen Feld ein und grenzt sich von diesem ab. Schon 1970, jenem Jahr, in dem ihr erster Roman »wir sind lockvögel baby!« veröffentlicht wurde, markiert sie in einem literarischen Statement ihren Literaturbegriff: weder für »literaten & künstler«, noch für »literaturmanager« soll ihre Literatur sein, vielmehr wird diese »ihre isolation aufzugeben haben«. (30) Ihre ästhetische Haltung richtet sich gegen die etablierten literarischen Formen nach 1968, arbeitet mit avantgardistischen Mitteln und grenzt sich formal jedoch nicht ein, sondern drückt sich durch Irritation, Intervention und Provokation aus. (31)
Jelineks Abwehrhaltung gegenüber dem Literaturbetrieb zeigt sich auch in ihrem literarisch ausgeführten
Jelineks Verhältnis zu ihrem potenziellen Nachlass ist, wie auch ihr Verhältnis zu ihrem Schreiben, von einer Negativität geprägt. Ausgelöst von der Steuerfahndung, in der ihr eigenes Material gegen sie verwendet werden könnte, soll es durch Transformation unlesbar gemacht werden:
Das Misstrauen Jelineks gegen ihren zukünftigen Nachlass, der schließlich aus disparatem Sprach- und Sprechmaterial besteht, lässt sich auf ihre Sprachkritik zurückführen. Just in dem Moment, in dem sie »im Schreiben Schutz gesucht« hat, »kehrt sich dieses Unterwegssein, die Sprache, […] gegen mich.«
(37)
Demnach könnte sich auch der Nachlass gegen sie wenden. Der fiktive testamentarisch verfügte Wunsch, nach ihrem Tod die Papiere zu zerstören, erinnert an die 〉letzte Bitte〈 Franz Kafkas an Max Brod, die ihm auftrug, jegliches Material aus seinem Nachlass »restlos und ungelesen zu verbrennen«
(38)
. Diltheys »Plädoyer für die Ausbildung starker Vernichtungshemmungen«
(39)
hat in diesem Fall geradezu gegenteilige Wirkung. Jelineks literarische Reflexion ihres »Nachlassbewusstseins« zeigt die Geste einer Autorin, die den Wert ihres Materials kennt und ist gleichzeitig direkt an den Kontakt mit der staatlichen Verfügungsmacht geknüpft. Ihre Familiengeschichte, ihre Biografie, ihr Schreiben und schließlich auch ihr Nachlass sind nur im Verhältnis mit institutioneller Gewalt möglich. Durch das Schreddern soll ihr schriftstellerisches Material jedoch nicht vollständig zerstört, sondern transformiert werden. Mit einer sarkastischen Anspielung an die Auferstehung Jesu Christi schreibt sie: »Es wird neu erstehen, mein Werk, in andrer Form, aber doch, so stelle ich es mir vor, dafür habe ich es hergestellt […].«
(40)
Erst durch die Transformation wird die Unendlichkeit des Materials erreicht – zumindest bis sein materielles Verfallsdatum gekommen ist. Wenn auch in einer anderen Dimension, ist die Veränderung von Schriftstücken durch institutionelle Eingliederung eine der Grundoperationen des Archivs: Die Einpassung in die Archivordnung und das Katalogisieren macht Schriftstücke zu Archivgut, indem sie durch die Praktik des
Bei einer Nachlassübergabe befinden sich die zu archivierenden Materialien und Dokumente zumeist noch in der Arbeitsstätte der Schriftstellerin oder des Schriftstellers und stehen somit
Doch auch im Archiv können Materialien noch 〉anarchiviert〈 bleiben, sofern die Erschließung und Katalogisierung und damit die Einfügung in die Archivordnung ausständig bleibt.
(52)
Literarisches Material, wie Notizen, Entwürfe, Briefe oder auch Lebensdokumente, zeichnet sich durch seine Disparatheit aus; zum archivarischen Bestand wird es erst, in dem es einheitlich verwahrt und dadurch vergleichbar und quantifizierbar gemacht wird.
(53)
Das Verhältnis von Literatur und seiner Archivierung ändert sich grundlegend mit dem Instrument des Vorlasses: Das sich im 19. und 20. Jahrhundert herausgebildete Nachlassbewusstsein schlägt Ende des 20. Jahrhunderts in ein
Neben die Arbeit des Schreibens und die Kommunikation mit dem Verlag treten nun die Vorbereitungen für das Literaturarchiv; durch die Lieferung in Tranchen erfolgt die Zuordnung der schriftlichen Materialien zu dem jeweiligen publizierten Werk bereits durch die Autorin. (56) Der Vorlass verleiht den Notizen, Manu- und Typoskripten als Archivbestand nun Werkcharakter und kann von der Autorin als Bestandsbildnerin entscheidend arrangiert und inszeniert werden. (57) Mayröcker ist sich zudem dessen symbolischer und möglicher finanzieller Bedeutung bewusst: »[…] ich weiß ja, daß alle diese Handzettel und Manuskripte und Typoskripte wertvoll und wichtig sind zum Aufbewahren für diesen Vorlaß.« (58) Mayröckers Vorlass an der Wienbibliothek im Rathaus wird das letzte Mal im Jahr 1997 ergänzt und umfasst insgesamt 32 Archivboxen. (59)
Das
Indem Mayröcker den Archivierungsvorgang beschreibt, beobachtet sie mit literarischen Mitteln jenes von Minor beschriebene
Mayröcker beginnt ihre literarischen Überlegungen zum Archiv mit einer Unruhe, die dem Schreiben vorausgeht und gleichzeitig zu dessen Bedingung wird. Durch das Wissen, dass ihre Materialien zukünftig archiviert werden sollen, stellt sich zunächst die Frage, ob das Schreiben überhaupt gelingen wird. Archiv und Literatur sind in ihrer gemeinsamen Prozessualität untrennbar miteinander verbunden; in einem gewissen Sinn ist bereits das Schreiben selbst eine »implizite Selbstarchivierung«
(67)
, die in der institutionellen Verwahrung schließlich gegenständlich wird. Das Interesse des Literaturarchivs an der Text- und Werkgenese und das Interesse der Literatur an seiner eigenen institutionellen Archivierung bewirkt eine wechselwirkende Aufmerksamkeit für die jeweiligen Verfahrensweisen. Durch die Transformation des Literaturarchivs zugunsten »prospektiver Erwerbungsstrategien«
(68)
wird dieses Verhältnis nicht nur enger, sondern es ergibt sich eine weitere sonderbare Möglichkeit. Die Autorinnenfigur Mayröcker ist Zeugin der Übergabe ihres eigenen Materials und kann zur Besucherin ihres eigenen Archivbestands werden:
Das Nebeneinanderhalten des schriftstellerischen und archivarischen
Die mechanische Dimension des Schreibvorgangs rückt in den Vordergrund, indem das Geräusch der Schreibmaschinentastatur mit den Bewegungen der Autorin parallel gesetzt wird. Die prominente Position des Schreibgeräts im Text lässt im Zusammenhang mit der Archivierung des Vorlasses von Gegenwartsliteratur nach dem Status von Manuskripten und Typoskripten im Literaturarchiv fragen. Die Handschrift wurde Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts genau in jenem Moment zu einem Objekt der Philologie gemacht, in dem seine Obsoleszenz deutlich wurde, nämlich
Die Schreibmaschine ist jedoch als technisches Gerät Anfang des 21. Jahrhunderts schon längst obsolet geworden. Das 〉Aufschreibesystem 2000〈 zeichnet sich durch den »totale[n] Medienverbund auf Digitalbasis« aus – zentral ist das Universalmedium Computer: »Statt Techniken an Leute anzuschließen, läuft das absolute Wissen als Endlosschleife.« (73) Dadurch schwingt in dem Archivierungstext Mayröckers, die nie einen Computer besessen und stets mit der Hand oder der Schreibmaschine geschrieben hat, eine Nostalgie mit, die das affektiv besetzte Schreibgerät durch literarische Neuerfindung wiederbelebt. (74) Indem Mayröcker in »Archiv« außerdem beschreibt, wie ihr der Ehrenring der Stadt Wien überreicht wird, legt sie zudem die Wertzuschreibung ihres Werks und frei und situiert die Archivierungs-Szene auch im Zusammenhang mit dem Literaturbetrieb, in dem der Vorlass als Förderungs- und Kanonisierungsinstrument fungiert. (75)
In enger Verbindung mit dem Schreiben und dessen Archivierung steht die Wohnung der Schriftstellerin, die zu einem Faszinosum geworden ist. Die Fülle von Zetteln und Notizen, Briefen und Büchern überlagert die Möbel, überquellende Wäschekörbe voller Papiere stapeln sich auf dem Fußboden und in Regalen, Medikamentenschachteln, Prospekte und Plakate belegen fast jeden freien Millimeter. Inmitten des großen Chaos auf einem vollgeräumten Tisch findet sich die Schreibmaschine. (76) In diesen überfüllten Räumen jene Materialien wiederzufinden, die für den Transport in die Rathausbibliothek vorgesehen sind, stellt sich als große Herausforderung dar; teilweise sei der Suchvorgang nach den Materialien, die zu einem neuen abgeschlossenen Projekt zählen, »ziemlich anstrengend und ziemlich zermürbend«, erklärt Mayröcker, obwohl sie ihre wichtigsten Manuskripte bereits in einem »Wandsafe« aufbewahrt, um sie vor Verlusten zu schützen. (77) Abhängig davon, ob sie die Materialien bereits vorsorglich in die richtige, dafür vorgesehene Kiste abgelegt oder falsch zugeordnet hat, stellen sich die Vorbereitungen für die nächste Übersendung ins Archiv mehr oder weniger schwierig dar. (78) Die Schwelle der Übergabe ereignet sich demnach nicht einmal, sondern wird durch eine Serialität gekennzeichnet, indem der Auswahl- und Abgabeprozess sich wiederholt und scheinbar niemals abgeschlossen werden kann. Denn obwohl Material aus der Schreibwohnung und in die Handschriftensammlung der Wienbibliothek geschafft wird, scheinen die Dinge nicht weniger zu werden, im Gegenteil: sie übernehmen die Herrschaft in der Wohnung. Die Ablagerung in Schichten, wie Mayröckers persönliches 〉Archiv〈 aufgebaut ist, ergibt sich aus dem Schreibprozess und ist nur diesem und keinen anderen Ordnungsmaßnahmen untergeordnet. Indem die Autorin in ihren unzähligen Notizen den ersten Schritt unternimmt, die Dinge, Wahrnehmungen und Beobachtungen in Literatur zu transformieren, bilden diese kleinen Aufzeichnungen den Ausgangspunkt für ihr Schreiben und müssen stets in erreichbarer Nähe gehalten werden. (79) Das Schreiben ist abhängig von diesem Material, und die Notizen können nicht aussortiert, sondern nur für eine andere Aufbewahrung – jene im Literaturarchiv – ihren Ort wechseln und die Wohnung verlassen.
Mayröckers Sammlung von Notizen und Objekten ist nicht hierarchisierbar. Die Zustände erinnern an eine Messie-Wohnung und die Schriftstellerin ist die Einzige, die sich in diesem undurchdringlichen Chaos zurechtfindet. Dies ist charakteristisch für jene an der
Demnach ist das einzige Unterscheidungskriterium in der Ablage der Materialien die Zeitlichkeit. Andauernde Projekte, Schreibversuche oder abgeschlossene Projekte werden an unterschiedlichen Orten in der Werkstatt der Schriftstellerin aufeinandergeschichtet – je nach aktuellem Schreibort. So heißt es etwa in einer Notiz aus ihrer Wohnung: »NICHT BERÜHREN. NEUE PROSA VERSUCHE.« (85) oder auf einer mit Kreide beschrifteten kleinen Tafel: »hier ALLES TABU« (86) .
Bei Mayröcker wird die Sorge, ob das Schreiben möglich sein wird, immer wieder selbst zum literarischen Ausgangspunkt. Das für ihre Spätprosa zentrale Thema des eigenen poetologischen Programms ist auch ein wesentlicher Bestandteil ihrer Texte, Archivierungsbewegungen sind dabei stets präsent. Die Suche nach dem Material in der Wohnung, die vornehmlich dem Schreibvorgang selbst dient, erinnert jedoch auch an die Vorbereitungen für den Vorlass und ist zentraler Gegenstand des Schreibens. So heißt es etwa in »da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete« (2020), Mayröckers letztem zu Lebzeiten veröffentlichten Buch: »ich hatte sie in der Wohnung verloren sie waren verlorengegangen ich konnte sie nicht wiederfinden sie waren ein Teil v.mir [sic!] aber die Sätze waren verlorengegangen […].«
(87)
Die Momente der Störung – mit Rüdiger Campe »Schreib-Szenen«, die sich durch ein »nicht-stabiles Ensemble von Sprache, Instrumentalität und Geste«
(88)
auszeichnen – erweisen sich als besonders produktiv. Die Wörter und Sätze sind nicht nur damit beschäftigt, sich der Autorin zu entziehen, sondern lassen sich auch nicht zu einem Ganzen fügen und bleiben dabei stets für sich, fragmentarisch, zersplittert und verstreut.
(89)
Bevor die Dinge, die sie vorfindet, in den literarischen Text aufgenommen werden können müssen sie zunächst Teil des
Der Raum, die Aufzeichnungen und die Sinneseindrücke werden durch den Schreibprozess zusammengeführt, wenn die zerstreuten Materialien Eingang in die literarische Verarbeitung finden und das, was bereits da ist, vermeintlich nur noch 〉abgelesen〈 werden muss. Indem die Notizen ihre Wohnung bevölkern, ist die Autorin von all jenem schon umgeben, das später zu Literatur gemacht werden wird. Ein eigenartiges Verhältnis zu den Dingen bestimmt auch, wie Mayröcker schreibt, ihre Autorschaft: Die Schriftstellerin als »Gassenfegerin! Krämerin! Lumpenfrau! Die Poetin als Kleptomanin, im weitläufigen wuchernden Gartengelände, die schönsten Exemplare zu raufen« (91) sammelt, hortet und nimmt alles auf; vor allem dasjenige, was von anderen als unbedeutend abgetan wird. In diesem Sinne zeichnet sich auch ihre Literatur durch fehlende Hierarchisierung aus; dem Nebensächlichen, Alltäglichen und Unwichtigen wird der gleiche Platz eingeräumt wie dem vermeintlich Wichtigen und Fundamentalen. Dementsprechend gibt es keinen Originalzustand in der Wohnung, sondern dieser wird durch die stete Schreibbewegung ständig erneuert. Als »eine Art zweiter Haut« (92) umschließt die Wohnung die Schriftstellerin und wird zum Bestandteil der körperlichen Schreibprozesse, die sich wiederum in ihr ablagern.
Die Material- und Zetteldichte in ihrer Wohnung hat mit ihrer Hinwendung zur Prosa begonnen zuzunehmen: Jahrzehntelang als Lehrerin berufstätig, schrieb Mayröcker nur nebenbei, erst als sie sich 1969 vom Unterrichten verabschieden konnte, widmet sie sich ausschließlich dem Schreiben.
(93)
Lebensraum und Büro werden eins. Indem Mayröcker von nun intensiver in ihrer Wohnung arbeitet, ist dies jener Ort, der sich stets für das Schreiben bereithalten muss. Auf den Ort des Schreibens, ihren Schreibtisch, rekurriert sie auch immer wieder in ihren Texten: »ist es eine Entfleischung […] Selbstauflösung vielleicht, eine Geisteszerreißprobe, oder was, eine Zeit der Wirklichkeitsferne, ein treibender Schreibtisch mitten im Ozean meines Zimmers«.
(94)
Die Werkstatt wird zum poetischen Möglichkeitsraum und auch das Abrufen von Vergangenem ist an das Schreiben geknüpft. Die schriftstellerische Arbeit, deren Ablagerungen sich in den Materialtürmen zeigt, wird vor allem durch körperliche Anstrengung und schmerzhafte Erinnerungen angetrieben, während die Herstellung der Literatur physisch quälend ist und überall seine Spuren hinterlässt:
Im Jahr 2019 schließt Mayröcker mit einem weiteren Archiv einen umfänglichen Vertrag ab: Sie vermacht dem Literaturarchiv der österreichischen Nationalbibliothek als (Teil-)Vorlass ihre ehemalige Schreibwohnung, in der sie jahrzehntelang gelebt und gearbeitet hat sowie ihre damalige aktuelle Wohn- und Arbeitsstätte, in der sie zu diesem Zeitpunkt noch aktiv gewirkt hat und deren Materialien daher erst später an das Archiv gelangen sollten. Da die Autorin zu diesem Zeitpunkt weiterhin produktiv war, waren auch die zukünftig verfassten Texte Teil des Abkommens.
(96)
In einem langwierigen Prozess, der nach dem Tod Mayröckers im Juni 2021 fortgesetzt wurde, werden die Tausenden Briefe, Notizen, Fotos und Lebensdokumente ins Archiv überstellt und sukzessive in Hunderten von Archivboxen sortiert. Das Bewusstsein um die Archivierung ihrer Papiere tritt trotz der Archivierungsbestrebungen von Mayröcker in ihren Schreibwohnungen nicht als reale Ordnungsmacht auf, welche die Werkstatt nach einem bestimmten Prinzip strukturieren würde; vielmehr ergeben sich die Verbindungen zu ihren Materialien durch den schriftstellerischen Produktionsprozess selbst.
(97)
Auch wenn die Autorin am Vorlass für die Wienbibliothek mitgearbeitet hat, verwehrt sich ihre Wohnung und ihr schriftstellerisches Material den Verfahren und Strukturen des Literaturarchivs. Nach dem ersten Kontakt mit der Institution des Archivs in den 1980er-Jahren, in dem eine Archivierung ihres Materials nach spezifischen Richtlinien und der institutionelle Umgang bereits erprobt wurden, radikalisiert sich Mayröckers Verhältnis zum Archiv zunehmend: Sie schreibt zwar in gewisser Weise
Die Arbeit an diesem Artikel wurde im Rahmen des DOC-Programms der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gefördert. Dank an Edith Schreiber und das Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek für die Genehmigung der Zitate aus dem Nachlass von Friederike Mayröcker.
Jacques Derrida: Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression, Berlin 1997, S. 35. Die Endfassung des Artikels wurde im April 2023 eingereicht.
Vgl. Ernst Robert Curtius: Gothes Aktenführung, in: Die Neue Rundschau 62/1 (1951), S. 110–121.
Kai Sina/Carlos Spoerhase: Nachlassbewusstsein. Zur literarturwissenschaftlichen Erforschung seiner Entstehung und Entwicklung, in: Zeitschrift für Germanistik 3 (2013), S. 607–623, hier S. 621 und vgl. Johann Wolfgang Goethe: Archiv des Dichters und Schriftstellers, in: Goethes Werke, hg. im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen, Abt. I, Bd. 41.2, Weimar 1903 [1823], S. 25–28.
Cornelia Vismann: Akten. Medientechnik und Recht, Frankfurt am Main 32011, S. 93.
Vismann: Akten, S. 26.
Bruno Latour: Drawing Things Together: Die Macht der unveränderlich mobilen Elemente, in: Andréa Belliger/David J. Krieger (Hg.): ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie, Bielefeld 2006, S. 259–307, S. 296.
Elfriede Jelinek: Angabe der Person, Hamburg 2022, S. 114.
Vgl. Bruno Latour: Die Rechtsfabrik. Eine Ethnographie des Conseil d’État, Konstanz 2016, S. 100.
Jelinek: Angabe der Person, S. 21.
Vgl. Ben Kafka: The Demon of Writing. Powers and Failures of Paperwork, New York 2012, S. 10.
Jelinek: Angabe der Person, S. 7.
Vgl. Elfriede Jelinek: Oh mein Papa, in: Das jüdische Echo (Jubiläumsausgabe) 50 (2001), S. 295–297, hier S. 295. Ebenso und mit Faksimile des NS-Dokuments vom 5. Juli 1939 veröffentlicht in: Elfriede Jelinek Webseite, online:
Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, München 202017, S. 520.
Jelinek: Oh mein Papa, S. 297.
Jelinek: Oh mein Papa, S. 295.
Jelinek: Angabe der Person, S. 96.
Raul Hilberg: Anatomie des Holocaust. Essays und Erinnerungen. Hg. v. Walter H. Pehle/René Schlott, Frankfurt am Main 2016, S. 82.
Vgl. Hannah Arendt. Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München 152018.
Jelinek: Angabe der Person, S. 62.
Jelinek: Angabe der Person, S. 42.
Vismann: Akten, S. 11.
Elfriede Jelinek: Im Abseits (2004), in: Elfriede Jelinek Webseite, online:
Vgl. Elfriede Jelinek: Das Schweigen (2000), in: Elfriede Jelinek Webseite, online:
Jelinek: Im Abseits.
Friedrich Balke/Bernhard Siegert/Joseph Vogl: Editorial, in: dies. (Hg.): Archiv für Mediengeschichte – Medien der Bürokratie, Paderborn 2016, S. 5–12, S. 5.
Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt am Main 92017, S. 157.
Jelinek: Im Abseits.
Vgl. Kerstin Stüssel: In Vertretung. Literarische Mitschriften von Bürokratie zwischen früher Neuzeit und Gegenwart, Tübingen 2004, S. 2.
Ingo Niermann: Interview ELFRIEDE JELINEK (2014), online:
Elfriede Jelinek: Statement, in: Renate Matthaei (Hg.): Grenzverschiebung. Neue Tendenzen in der deutschen Literatur der 60er Jahre, Köln/Berlin 1970, S. 215–216, S. 215.
Vgl. Uta Degener/Christa Gürtler: Provokationen der Kunst – Provokationen als Kunst. Einleitung, in: dies. (Hg.): Elfriede Jelinek: Provokationen der Kunst, Berlin/Boston, 2021, S. 1–16, S. 8f.
Wilhelm Dilthey: Archive für Literatur, in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. XV, Göttingen 31991, S. 1–16.
Dilthey: Archive für Literatur, S. 6.
Kai Sina/Carlos Spoerhase: 〉Gemachtwordenheit〈: Über diesen Band, in: dies. (Hg.): Nachlassbewusstsein. Literatur, Archiv, Philologie 1750–2000, Göttingen 2017, S. 7–17, S. 15.
Vgl. Sina/Spoerhase: 〉Gemachtwordenheit〈, S. 15.
Jelinek: Angabe der Person, S. 131.
Jelinek: Im Abseits.
Max Brod/Franz Kafka: Eine Freundschaft. Briefwechsel, hg. v. Malcolm Pasley, Frankfurt am Main 1989, S. 365. Vgl. dazu Kai Sina: Kafkas Nachlassbewusstsein. Über Autorschaft im Zeitalter des Literaturarchivs, in: KulturPoetik 13/2 (2013), S. 218–235.
Lothar Müller: Weiße Magie. Die Epoche des Papiers, München 2012, S. 286.
Jelinek: Angabe der Person, S. 132.
Vgl. Aleida Assmann: Das Kippen von Ordnung in Unordnung. Boltanskis Archiv-Installationen, in: Helmuth Lethen/Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität Linz (Hg.): Katalog der Unordnung. 20 Jahre IFK, Wien 2013, S. 26–29, S. 26.
Jelinek: Im Abseits.
Wolfgang Ernst: Das Rumoren der Archive. Ordnung aus Unordnung, Berlin 2002, S. 133f.
Vgl. Niermann: Interview ELFRIEDE JELINEK.
Vgl. Maria Sterkl/Theo Anders: Splitterhafte Erkenntnisse aus der Schredder-Affäre, in: Der Standard, 24. 07. 2019, online:
Jelinek: Angabe der Person, S. 189.
Vgl. Maria Regina-Kecht: Elfriede Jelinek in absentia oder die Sprache zur Sprache bringen, in: Seminar. A Journal of Germanic Studies, 43/3 (2007), S. 351–365, S. 361.
Jelinek: Angabe der Person, S. 181.
Das Informationszentrum des Interuniversitären Forschungsnetzwerk Elfriede Jelinek ist weniger ein Archiv mit Werkmaterial der Schriftstellerin, sondern versteht sich vorrangig als Sammelstätte zur Dokumentation von Person, Werk und Rezeption, vgl. Interuniversitäres Forschungsnetzwerk: Informationszentrum, online:
Ernst: Das Rumoren der Archive, S. 94.
Sigrid Weigel: Vor dem Archiv. Von der Unordnung der Hinterlassenschaft zur Ordnung des Archivs, in: Helmuth Lethen und Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität Linz (Hg.): Katalog der Unordnung. 20 Jahre IFK, Wien 2013, S. 160–164, S. 164.
Vgl. Sigrid Weigel: An-Archive: Archivtheoretisches zu Hinterlassenschaften und Nachlässen, in: Trajekte 5/10 (2005), S. 4–7.
Vgl. Ulrich Raulff: Sich nehmen gern von den Lebendigen. Ökonomien des literarischen Archivs, in: Knut Ebeling/Stephan Günzel (Hg.): Archivologie. Theorien des Archivs in Wissenschaft, Medien und Künsten, Berlin 2009, S. 223–232, S. 228f.
Vgl. Wienbibliothek im Rathaus: Vorlass Friederike Mayröcker, online:
Bernhard Kraller/Walter Famler: »Das ist wirklich die heiligste Ordnung«. Gespräch mit Friederike Mayröcker, in: Bernhard Kraller (Hg.): Friederike Mayröcker. Die herrschenden Zustände, Wespennest Sonderheft, Wien 1999, S. 16–27, S. 24.
Dies erfolgte mit Unterstützung von Marcel Beyer und Klaus Kastberger, vgl. Kraller/Famler: »Das ist wirklich die heiligste Ordnung«, S. 24.
Vgl. Magnus Wieland: Werkgenesen: Anfang und Ende des Werks im Archiv, in: Lutz Danneberg/Annette Gilbert/Carlos Spoerhase (Hg.): Das Werk. Zum Verschwinden und Fortwirken eines Grundbegriffs, Berlin/Boston 2019, S. 213–235, S. 230.
Kraller/Famler: »Das ist wirklich die heiligste Ordnung«, S. 24.
Vgl. Wienbibliothek im Rathaus: Vorlass Friederike Mayröcker.
Roland Barthes: Am Nullpunkt der Literatur, Frankfurt am Main 32021, S. 18.
Vgl. Friederike Mayröcker: Archiv, in: Handschriftensammlung der Wienbibliothek im Rathaus, ZPH 1372, H.I.N.-230510. Abgedruckt in: Julia Danielczyk/Sylvia Mattl-Wurm/Christian Mertens (Hg.): Das Gedächtnis der Stadt. 150 Jahre Wienbibliothek im Rathaus, Wien 2006, S. [13].
Dilthey: Archive für Literatur, S. 8.
Jakob Minor: Centralanstalten für die literaturgeschichtlichen Hilfsarbeiten, in: Euphorion I (1894), S. 17–26, S. 20f.
Mayröcker: Archiv, S. [13] (Herv. im Original).
Vgl. Holger Berwinkel: Zur Epistemologie amtlicher und literarischer Aufzeichnungen, in: Petra-Maria Dallinger/Georg Hofer/Bernhard Judex (Hg.): Archive für Literatur. Der Nachlass und seine Ordnungen, Berlin/Boston 2018, S. 31–53, S. 39f.
Mayröcker: Archiv, S. [13].
Sandro Zanetti: Einleitung, in: ders. (Hg.): Schreiben als Kulturtechnik. Grundlagentexte, Berlin 22015, S. 7–34, S. 31.
Dirk Weisbrod: Prospektiv statt retrospektiv – Einige Gedanken zur Entstehung des Vorlass-Erwerbs und seine Bedeutung für Literaturarchive, in: O-Bib. Das offene Bibliotheksjournal 5/1 (2018), S. 19–30, S. 28, online:
Mayröcker: Archiv, S. [13].
Davide Giuriato/Martin Stingelin/Sandro Zanetti: Einleitung, in: dies. (Hg.): »Schreiben heißt: sich selber lesen«. Schreibszenen als Selbstlektüren, München 2008, S. 9–17, S. 15.
Mayröcker: Archiv, S. [13] (Herv. im Original).
Christoph Hoffmann: Schreibmaschinenhände. Über »typographologische« Komplikationen, in: Davide Giuriato/Martin Stingelin/Sandro Zanetti (Hg.): »SCHREIBKUGEL IST EIN DING GLEICH MIR: VON EISEN«. Schreibszenen im Zeitalter der Typoskripte, München 2005, S. 153–167, S. 159 (Herv. im Original).
Friedrich Kittler: Grammophon Film Typewriter, Berlin 1986, S. 8.
Vgl. Dominik Schrey: Analoge Nostalgie in der digitalen Medienkultur, Berlin 2017, S. 105 und 107.
Vgl. Mayröcker: Archiv, S. [13]. Die Verleihung des Ehrenrings der Stadt Wien an Friederike Mayröcker fand am 16. 12. 2004 anlässlich ihres Geburtstags in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek (heute: Rathausbibliothek Wien) statt. Vgl. Rathauskorrespondenz: Ehrenring der Stadt Wien für Friederike Mayröcker. Archivmeldung vom 17. 12. 2004, online:
Vgl. exemplarisch die zwischen Dezember 1994 und Mai 1999 entstandenen Fotos von Bernhard Kraller und Reinhard Öhner in: Kraller (Hg.): Friederike Mayröcker.
Kraller/Famler: »Das ist wirklich die heiligste Ordnung«, S. 24.
Vgl. Kraller/Famler: »Das ist wirklich die heiligste Ordnung«, S. 24.
Vgl. Klaus Kastberger: Geheimnisse des Archivs. Friederike Mayröcker und ihre Wohnung, in: Eìtudes Germaniques 69/4 (2014), S. 517–526, S. 522.
Daniel Tyradellis: Der Messieianismus und sein Preis, in: Thomas Weitin/Burkhardt Wolf (Hg.): Gewalt der Archive. Studien zur Kulturgeschichte der Wissensspeicherung, Konstanz 2012, S. 255–272, S. 257.
Vgl. Tyradellis: Der Messieianismus und sein Preis, S. 263.
Roland Barthes: Die Vorbereitung des Romans, Frankfurt am Main 52022, S. 54 (Herv. im Original).
Vgl. dazu exemplarisch die Studie von Klaus Kastberger: Reinschrift des Lebens. Friederike Mayröckers Reise durch die Nacht. Edition und Analyse, Wien 2000.
Dieter Sperl: »Ich will natürlich immer schreiben.« Gespräch mit Friederike Mayröcker, in: Gerhard Melzer/Stefan Schwar (Hg.): Friederike Mayröcker, Graz/Wien 1999, S. 9–30, S. 13.
Friederike Mayröcker: Handschriftliche Notiz, gesichtet bei einem Besuch in Mayröckers Wohnung im August 2021, © ÖNB, Literaturarchiv. Zitate aus Friederike Mayröckers Wohnung und ihrem Teil-Vorlass am Literaturarchiv Wien der Österreichischen Nationalbibliothek mit freundlicher Genehmigung des Literaturarchiv Wien und Edith Schreiber.
Friederike Mayröcker: Handschriftliche Notiz, in: Kraller (Hg.): Friederike Mayröcker, S. 33.
Friederike Mayröcker: da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete, Berlin 32021, S. 18.
Rüdiger Campe: Die Schreibszene. Schreiben, in: Hans Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hg.): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie, Frankfurt am Main 1991, S. 759–772, S. 760.
Vgl. Luigi Reitani: Verwandlungen und Fragmente. Zur späten Lyrik Friederike Mayröckers, in: Klaus Kastberger/Wendelin Schmidt-Dengler (Hg.): In Böen wechselt mein Sinn. Zu Friederike Mayröckers Literatur, Wien 1996, S. 53–68, S. 54.
Friederike Mayröcker: Handschriftliche Notiz, in: Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, LIT/493/W33/136 (Herv. im Original), © ÖNB, Literaturarchiv.
Friederike Mayröcker: Magische Blätter I, Frankfurt am Main 1983, S. 29.
Kraller/Famler: »Das ist wirklich die heiligste Ordnung«, S. 20.
Vgl. Kraller/Famler: »Das ist wirklich die heiligste Ordnung«, S. 20.
Friederike Mayröcker: Lection, Frankfurt am Main 1994, S. 100.
Kraller/Famler: »Das ist wirklich die heiligste Ordnung«, S. 32 (Herv. im Original).
Vgl. Literaturarchiv Wien: Pressemeldung vom 06. 12. 2019, online:
Vgl. Kastberger: Chaos des Schreibens, S. 15.
Vgl. Derrida: Dem Archiv verschrieben, S. 12–25.
Vgl. Martin Stingelin: »UNSER SCHREIBZEUG ARBEITET MIT AN UNSEREN GEDANKEN«. Die poetologische Reflexion der Schreibwerkzeuge bei Georg Christoph Lichtenberg und Friedrich Nietzsche, in: Sandro Zanetti (Hg.): Schreiben als Kulturtechnik. Grundlagentexte, Berlin 22015, S. 238–304, S. 292.
Barthes: Am Nullpunkt der Literatur, S. 20.