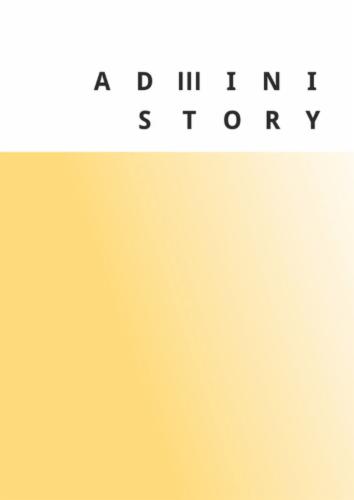Der verwaltete Souverän. Kleists Michael Kohlhaas und die preußischen Reformen
Publié en ligne: 09 juil. 2025
Pages: 12 - 34
DOI: https://doi.org/10.2478/adhi-2023-0001
Mots clés
© 2022 Rafael Jakob et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Zur preußischen Verwaltung unterhielt Heinrich von Kleist ein verwickeltes Verhältnis. Führten andere deutsche Dichter um 1800 eine Art »Doppelleben von ›Schriftstellern als Staatsbeamten oder Staatsbeamten als Schriftstellern‹«, misslang Kleist »die Einheit der Person beider«.
(1)
Und dennoch entwickelte sich seine Autorschaft in Auseinandersetzung mit dem Staatsdienst. In Briefen, die er 1800 an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge schrieb, begründete er umständlich, warum für ihn eine Ämterlaufbahn nicht in Frage kam:
Was Kleist eine Beamtenkarriere unmöglich machte, scheint das Anforderungsprofil des alten, absolutistischen Staats gewesen zu sein, wie er nicht selten als Maschine metaphorisiert wurde – der Staat, den Kant in seiner Aufklärungsschrift besprochen hat und in dessen Dienst Beamte lediglich »Privatgebrauch« von ihrer Vernunft machen sollten, während der öffentliche, auf »Fortschritt« zielende Vernunftgebrauch dem aufgeklärten Gespräch vorzubehalten war, den sie als Mitglieder der Gelehrtenrepublik zu führen hätten.
(3)
Nach 1804 und nach dem Scheitern seines
Kleist ist gerade zu jener Zeit (nämlich zwischen 1804 und 1806) zum literarischen Prosaautor geworden, da er sich im Büro des Reformers Karl Freiherr von Stein zum Altenstein und dann in Königsberg auf den Staatsdienst vorbereitete.
(6)
Hans Kiefner hat darauf hingewiesen, dass Kleists Schreibweise und insbesondere seine Erzählanfänge unübersehbar beeinflusst sind von der Relationaltechnik, die in den noch kollegial organisierten preußischen Gerichts- und Kameralbehörden dominierte und wichtiger Bestandteil der kameralistischen Ausbildung war: In Stil und Darstellung nimmt sie Eigenheiten von Relationen oder Berichten auf, mit denen Referenten dem Kollegium einen Fall vorstellten, indem sie zunächst in einer »Geschichtserzählung« (den Species Facti) die Fakten des Falls zusammentrugen, dann Aktenauszüge zusammenstellten und schließlich in einem Gutachten einen Vorschlag dafür formulierten, wie in dem Fall zu entscheiden sei.
(7)
Mit der preußischen Verwaltung, ihren Eigenarten und Defiziten hat sich Kleist ebenso gelehrig wie kritisch beschäftigt, was sich freilich, mehr noch als in praktischen Beobachtungen oder theoretischen Stellungnahmen, hauptsächlich in seiner erzählenden Prosa und insbesondere in seiner Novelle
Vor diesem Hintergrund soll hier mindestens zweierlei gezeigt werden:
Nicht nur als literarische Mit- und Umschrift der administrativen Textformen Supplik und Relation soll hier Kleists Prosa verstanden werden, sondern vielmehr als ein Erzählen, das den Übergang von einem zeremoniellen und ›darstellenden‹, Sachen und Personen »in einem strikt hierarchischen Universum« platzierenden Sprachgebrauch hin zu einer Schreibart dokumentiert, welche im Sinne der preußischen Reformverwaltung auf Effektivität und Erledigung setzt.
(9)
Und mehr noch: Sein
Vielleicht trifft auch auf Kleist und sein Schreiben zu, was Gilles Deleuze und Félix Guattari einmal zu Kafka und seiner Literatur festgestellt haben: dass er »
Der Erfahrungsbericht vom Vorstellungsgespräch bei Köckritz, dem Kleist insbesondere seine vormaligen Bemühungen plausibel zu machen hatte, sich der Armee Napoleons anzuschließen, ist schon dadurch bemerkenswert, dass es von Kleist nur wenige Briefe gibt, in denen er überhaupt ins Erzählen kommt. Vor allem aber scheinen hier bereits etliche jener Stil- und Ausdruckskomponenten erkennbar, die dann auch seine Erzählungen kennzeichnen sollten – Erzählungen, die allesamt während oder nach Kleists Versuchen entstanden, im Staatsdienst Fuß zu fassen: die strenge Äußerlichkeit der Darstellung;
(16)
der dramatische Modus; das Schreiben unter den Vorzeichen des Verdachts; oder etwa die für Kleists Prosa immer wieder festgestellte Bedeutung der
Wie im Fall der Schlagbaum-Szene aus Kleists
Der Versuch, den Souverän selbst zu adressieren, führt unweigerlich zu seinem Sekretär, der nur im günstigsten Fall einen Zugang zum König bahnen wird:
Bei Köckritz hofft Kleist also herauszubekommen, welche »Hoffnungen« er sich beim König machen und welche Erfolgsaussicht eine »Bitte um Anstellung« haben kann. Zwar wurde schon Anfang der 1790er- Jahre der Begriff des ›Staatsdiensts‹ deutlich von dem des ›Fürstendiensts‹ geschieden, sei die Amtsvergabe doch keine Gnadensache, sondern erfolge allein auf Grundlage einer wissenschaftlichen und moralischen Prüfung.
(18)
Doch folgt Kleists Anstellungsgesuch noch ganz der Logik des Fürstendiensts: »Ich hätte Lust
In Friedrich Wilhelms
Kleists Vorstellungsgespräch endet mit Köckritz' Versprechen, »nicht entgegen zu wirken«, sollte es Kleist gelingen, den König mit einem Brief »zu einer Anstellung geneigt [zu] machen«. Kleist bittet ihn »förmlich um diese Gnade«. Auf der Fahrt von Charlottenburg nach Berlin liest er dann, wie er Ulrike schreibt, noch einmal jenen Brief, in dem Wieland über das »Meisterwerk« schreibt, das Kleist mit seinem
Kleists Novelle
Die (allererste) Rechtsverletzung, von der ausgehend die Novelle ihre – mit Kleists »Erdbeben in Chili« gesprochen – »ungeheure Wendung« (DKV III, 191) nehmen wird, hat Kohlhaas durch die Person des Junkers Wenzel von Tronka erfahren. Von Tronka könnte man insofern als administrative Figur verstehen, als er – oder sein Burgvogt
(22)
– die Macht des Kurfürsten von Sachsen in einem beschränkten Bezirk und Maß verwaltet. Mit
Verwaltung ist, wie es H.G. Adler beschrieben hat, ihrem Wortsinne nach »eine gebannte, eine getilgte Gewalt«, (24) die das schiere ›Walten‹ zugunsten kommunikativer Umwege, die Gewalttätigkeit zugunsten von Verwaltungstätigkeit zurückstellt. Wenzel von Tronka aber – und mit ihm eine ganze Reihe ›administrativer‹ Figuren – ist nur dem Namen nach Verwalter, dem Handeln nach aber bloßer Nutznießer und Parasit von Souveränität. Dem Begriff und Amt des ›Verwaltens‹ leisten sie allesamt nicht Genüge. Und unter eben diesen Vorzeichen entfaltet sich in Kleists Novelle – zwischen Kohlhaas' Supplizieren und dem Kampf des Kurfürsten um den ominösen Zettel, zwischen Kohlhaas' Begehren nach dem Souverän und dessen Begehren nach dem Untertan – ein von verschiedenen Souveränen, von vermeintlichen Verwaltern und von zahlreichen Subalternen beherrschter und bevölkerter erzählerischer und imaginärer Raum: Kaiser, Kurfürsten, Kämmerer, Staatskanzler, Staatsräte, Junker, Magistrate, Geheimräte, Geheimschreiber, Gerichtsräte, Gerichtsboten, Polizeichefs oder Zöllner — eine Unzahl von ›Machthabern‹ und ihren Stellvertretern, die ›machtvolle‹ Papiere verschiedenster Art ausgeben und die an keiner Stelle sichtbar ›waltende‹ Macht im schlechten Sinne ›ver-walten‹, d. h. eher zersetzen als verwirklichen, indem sie eine Unzahl mehr oder weniger klar adressierter Schriftstücke kursieren lassen: Suppliken, Briefe, Mandate, Resolutionen, Noten, Berichte.
Zum Thema wird dieses Problem persönlicher und schriftlicher Verwaltung nur deshalb, weil zwei Pferde des Rosshändlers Kohlhaas von – in der Begrifflichkeit des »Allgemeinen Landrechts« – Dingen mit vergleichbarem Wert zu »unschätzbaren Sachen« werden, deren Beschädigung nicht abgeglichen werden kann, sondern die wieder »in ihren alten Stand« versetzt werden müssen. (25) ›Unschätzbar‹ und somit unersetzbar sind die Pferde dadurch, dass mit ihnen nichts Geringeres als die Rechtssicherheit auf dem Spiel steht – nicht nur für Kohlhaas die Bedingung der Möglichkeit dafür, seinen, wie es in der Erzählung mehrfach heißt, »Geschäften« nachgehen zu können. Nur deshalb gerät die unzureichende, durch persönliche Interessen, Privilegien und Begünstigungen korrumpierte Verwaltungspraxis, die eigentlich die Sicherheit und Durchsetzung des Rechts zu garantieren hat, ins Licht der Erzählung. Kohlhaas' Kampf um sein Recht ist – und man kann hier an den von den preußischen Reformern proklamierten Vorrang von Verwaltungsreformen gegenüber Wirtschafts- und schließlich Verfassungsreformen denken (26) – ein Widerstand gegen die Art und Weise, wie Souveränität und ein von ihr abhängiges Recht verwaltet wird. Eine Formulierung Michel Foucaults abwandelnd könnte man sagen: In Kohlhaas' Krieg eskaliert eine Regierungskritik, die darin besteht, ›nicht auf diese Weise verwaltet‹ werden zu wollen. (27)
Während etwa Carl Schmitt den Kampf von Kleists Kohlhaas als »rein kriminell« verstanden hat, »weil er nicht politisch wurde und ausschließlich für sein eigenes verletztes privates Recht kämpfte«,
(28)
kann man in ihm auch einen, mit Marx gesprochen, »negativen Repräsentanten« einer zu verwirklichenden Gesellschaft erkennen, der in sich den »
Weil Kohlhaas' Feldzug zwar auf sein ›gutes‹ Recht und auf künftige Rechtssicherheit zielt, diese aber weniger theoretisch bestritten als im Zuge ›schlechter‹ Verwaltungspraxis unterschlagen werden; weil die Handlung um Kohlhaas im 16. Jahrhundert angesiedelt ist, da der mittelalterliche Staat der Gerichtsbarkeit sich zum Verwaltungsstaat transformierte; und weil zur Entstehungszeit von Kleists Novelle der Kampf gegen die patrimoniale Herrschaft und gegen den Absolutismus sowie der Aufbau eines liberalen Rechtsstaats und mit ihm die kategoriale Trennung von Justiz und Verwaltung auf der Agenda standen
(30)
– aus all diesen Gründen liegt es nahe, Kleists Novelle nicht so sehr als eine Auseinandersetzung mit rechtstheoretischen Problemen zu lesen, sondern vielmehr als einen Text, in dem es um neuzeitliche Probleme der Administration geht, insbesondere um die Ausübung und Transformation (souveräner) Gewalt über die Kanäle ihrer Verwaltung. In Anlehnung an die Traktatliteratur des 18. Jahrhunderts könnte man auch sagen,
Welche grundsätzlichen Probleme um 1800 unter dem Titel der ›Regierungskunst‹ verhandelt werden, offenbart vielleicht schon ein flüchtiger Blick auf die Probleme von Friedrich Wilhelms III. »Gedanken über die Regierungskunst« von 1796/97: Was sichert die gute Ordnung eines Gemeinwesens? Über welche Tugenden müssen Regenten verfügen? Wie entstehen Aufstände und wie lassen sie sich abwenden? Wie hat man den Warenverkehr an den Territorialgrenzen zu regeln? Ausführlich traktiert werden in den
Kleists Kohlhaas suppliziert, nachdem er feststellen muss, dass ihm in Sachsen der Rechtsweg, auf dem er gegen das ihm widerfahrene Unrecht klagen will (gegen die falsche Forderung nach einem Passschein, gegen die Zurichtung seiner Pferde, gegen die Misshandlung seines Knechts), schlicht und ergreifend verstellt ist. Obwohl in der brandenburgischen »Schreiberei des Stadtgerichts« »ganz nach den Forderungen« aufgesetzt (DKV III, 43), erreicht die Supplik den Kurfürsten von Brandenburg nicht, sondern wird sie zum Zweck, »nähere Information« einzuholen, zunächst umgeleitet und dann vom Verwaltungsapparat der Justiz unterschlagen. Kohlhaas' Frage, »warum man also verfahre« (DKV III, 45), bleibt ohne befriedigende Antwort. Seine Frau Lisbeth wird später versuchen, die Supplik der »Person« des Kurfürsten selbst zu überreichen, indem sie ihre guten Beziehungen zu dessen Kastellan spielen lässt. Auch das misslingt. Statt Abhilfe zu schaffen für den ›Papierstau‹ im Verwaltungsapparat, kehrt sie selbst – und angeblich selbstverschuldet – mit tödlichen »Quetschungen« nach Kohlhaasenbrück zurück: »Es schien, sie hatte sich zu dreist an die Person des Landesherrn vorgedrängt, ohne Verschulden desselben, von dem bloßen rohen Eifer einer Wache, die ihn umringte, einen Stoß, mit dem Schaft einer Lanze, vor die Brust erhalten. Wenigstens berichteten die Leute so« (DKV III, 58f.), heißt es im Stile eines narrativen Vorbehalts, so als sei im Zeitalter diffus, korrupt und intransparent ›verwalteter‹ Souveränität auch und gerade Berichten über dieselbe zu misstrauen.
Suppliken sind rhetorische Medien einer stratifizierten Gesellschaft und damit Medien einer »
Das Scheitern von Kohlhaas' Supplikationsversuch lässt sich sicherlich auch auf das Unbehagen beziehen, das man um 1800 der Textform der Supplik entgegenbrachte. Vielleicht aber lässt sich auch behaupten, dass Kleists Novelle eine generelle Störung im politischen Begehrensgefüge um 1800 zum Ausdruck bringt – ein Gefüge, innerhalb dessen die Supplik eine wesentliche Funktion einnimmt, sodass ihr Scheitern auf eine grundlegende Verunsicherung der politischen und administrativen Ästhetik hinweist.
In den »Gedanken über die Regierungskunst« Friedrich Wilhelms III. heißt es zum Supplizieren:
Statt vom Regenten entschieden zu werden, sollten Klagesachen besser von der lokalen Verwaltung beschieden und sollte bei Bedarf von dort aus der Zug durch die Instanzen angetreten werden: »Sollten sie jedoch mit diesem ihren Bescheide sich nicht begnügen wollen, so bliebe ihnen nach wie vor die zweite und dritte Instanz offen«. (35) Womit eine derartige, auf den Schriftweg verwiesene Verwaltung von souveränen Entscheidungen bald einhergehen wird, ist eine Sozial- und Affektfigur, als welche auch Kleists Kohlhaas in der Novelle denunziert wird: der Querulant. (36) Die »Gedanken über die Regierungskunst« ermahnen deshalb künftige Supplikanten, »sich vor unnützem Queruliren zu hüten und sich nicht muthwillig Processe auf den Hals zu laden, deren günstiger Aussgang ungewiß und unwahrscheinlich ist«. (37)
Schon in den frühen 1790er Jahren, also noch als Kronprinz, war Friedrich Wilhelm III. mit Friedrich Leopold Kircheisen und Carl Gottlieb Svarez von zwei einflussreichen Staatsrechtlern zur Frage des Supplizierens beraten worden.
(38)
Svarez wie Kircheisen rieten Friedrich Wilhelm, sich den Gesetzen und dem juristischen Apparat zu unterstellen, den Eingriff in Rechtsangelegenheiten auf die Begnadigung von Verurteilten zu beschränken und überhaupt nur in Ausnahmefällen Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Von »Machtsprüchen«, also einem Eingriff in laufende Verfahren, rieten sie ab: »Die gesittete Welt, dieß mächtige Tribunal, ist dahin übereingekommen, sich mit dem Worte MACHTSPRUCH, – UNGERECHTIGKEIT als verschwisterte Idee, zu denken.« Ein Machtspruch würde »mit Recht das Vertrauen des Volks auf Ihre Gerechtigkeit entziehen, auf welchem Vertrauen doch ein so großer Theil der Glückseligkeit eines Königs beruht.«
(39)
Stehen in den
Dieses neue Verhältnis schlägt sich nicht nur in der Perspektive einer Verwaltung nieder, die mit ihren Regeln und Routinen weitestgehend Rechtssicherheit gewährleisten soll. Es offenbart sich auch an einem Publikandum Friedrich Wilhelms und an einer Anekdote zur Reform des preußischen Kanzleistils. Unter Friedrich II. war es noch gängige Praxis gewesen, dass sich Supplikanten an der Bittschriftenlinde am Potsdamer Schloss versammeln konnten. Der König hatte sie von seinem Arbeitszimmer aus direkt im Blick.
(41)
In einem räumlichen Arrangement kam mithin das Phantasma unmittelbarer absolutistischer Herrschaft zur Geltung – eine Vorstellung von Herrschern, die, wie es im
Am Beispiel des Supplizierens lässt sich gut nachvollziehen, wie sich die »auf dem Niveau des Alltags ausgeübte Macht«
(45)
transformierte; wie sich also jene Herrschaft veränderte, die hinter dem Schicksal auch der »infamen Menschen« stand. Statt der Macht eines Monarchen, der »nahe ist und fern, allmächtig und launenhaft, Quelle aller Gerechtigkeit und Gegenstand beliebiger Verführung«, etabliert sich eine kapillare Macht, die nicht zuletzt in Form von Schriftstücken und auf dem Weg des Schriftverkehrs, die mithin in Gestalt einer neuen Verwaltung wirkt.
(46)
Im Aktenlauf dieser neuen Administration stand der Platz in Frage, den der Name des Königs in offiziellen Schreiben bisher eingenommen hatte. Das zeigt auch eine verwaltungsinterne Diskussion des Jahres 1800: Diese ging aus von einem Immediatgesuch, das der Berliner Formschneider Johann Lorenz Has am 12. März 1800 eingereicht hatte. Gebeten hatte er darin um das Privileg, auf Ausfertigungen der Kanzleischriften von Landeskollegien den königlichen Titel durch einen Holzschnitt ersetzen zu dürfen. Die Kollegien verfügten zu dieser Zeit
Was also zur Debatte stand, war, welcher »Schein« auf die Verwalter souveräner Macht fiel. Im Verwaltungsparadigma, dem hier noch das Wort geredet wurde, gehörte der Name des Königs wesentlich zur Verwaltungsästhetik, zur Art und Weise, wie Verwaltungsautorität anschaulich werden sollte:
Der Schriftverkehr zwischen König und Ministern sollte noch eine Weile hin- und hergehen, bis Friedrich Wilhelm den Reformversuch vorerst einstellte. Dennoch zeigte sich schon hier, dass die
In direkt an den König adressierten Suppliken oder im persönlichen Supplizieren wurde, so könnte man sagen, jene virtuelle Präsenz des Königs aktualisiert, die das
Indem sie den Herrscher in seiner Gerechtigkeit und damit in seiner Allgemeinheit vor Augen stellte, zielte eine Supplikation darauf, ihr anfängliches Rollenspiel und den in Frage stehenden Einzelfall im Allgemeinen des gerechten Gesetzes und dessen evidenter Verkörperung aufzuheben. (54) In genau diesem Sinne verstand sich die Supplik als paradigmatische rhetorische Form: Sie drängt auf die Verwirklichung der in der Person des Fürsten zentrierten Allgemeinheit des gerechten Gesetzes. Woran Kohlhaas deshalb sein erstes Bittgesuch richtet, ist »Der Herr selbst«, der, in »Person« adressiert, unbedingt »gerecht« sei (DKV III, 53).
Aus dieser rhetorischen Anlage erklärt sich die besondere »Schönheit«, die Johann Heinrich Gottlob von Justi der Gnadensupplik als geglückter Herrscheradresse zuschrieb. In seiner Abhandlung über die »Deutsche Schreibart« hielt er zu dieser Form fest, sie könne das, »worauf der Monarch, oder eine andre hohe Person oder Collegium, zu gewährung unsrer Bitte Betracht machen soll«, »in der Kürze anführen«, kurz und »gleichsam erläuterungsweise,
Letztlich baute Justis »Deutsche Schreibart« auf die – im Monarchen verkörperte – Koinzidenz guter polizeylicher und guter sprachlicher Ordnung, auf den Gleichklang zwischen einem wohlbestellten Gemeinwesen einerseits, einem bestens geregelten Sprachgebrauch andererseits. Denn in beiden Fällen gäbe es einen inneren Zusammenhang von »Ordnung und Kräftigkeit«. Oder, anders gesagt: Die gute Ordnung oder ›Polizey‹ garantiert den Bestand und die Mehrung all jener »Vermögen des Staats«, zu denen neben materiellen »Güthern« auch »die Geschicklichkeiten und Fähigkeiten aller Unterthanen, und in gewissem Betracht ihre Personen selbst« gehören. (57) Justis »Deutsche Schreibart« dient also insofern als ›Sprachpolizey‹, als sie die ›Unterthanen‹ und ihr sprachliches Vermögen dazu anhält, den ›Reichtum‹ der deutschen Sprache einzusehen, ihn auszuschöpfen und dann, vermittelst der Regeln und Gesetze des rechten Sprachgebrauchs, ihre Kraft zugunsten der übergreifend ›guten Ordnung‹ wirksam werden zu lassen. Zwar arbeitet diese ›Schreibart‹, wenn es um Kontakt mit der Obrigkeit geht, bereits einem rhetorisch abgerüsteten und entzeremonialisiertem ›Geschäftsstil‹ (mit seiner Maxime der Deutlichkeit und, davon abgeleitet, der Gründlichkeit, Eindeutigkeit, Klarheit und Kürze) zu; der Verwaltungskommunikation gewährt sie jedoch keinen Eigensinn und keine Autonomie, sondern unterstellt sie den allgemeinen ›polizeylichen‹ Maßgaben im Fürstenstaat.
Ein in diesem Sinne geglücktes Vermittlungs- und Ausdrucksverhältnis zwischen Herrschaft und wohlpolizierter Einzelheit wird in Kleists
›Glanz‹, darauf hat Michel Foucault hingewiesen, begegnet in polizeywissenschaftlichen Texten des 17. und 18. Jahrhunderts als Inbegriff der Einheit von Ordnung und Kräftigkeit eines Staats.
(58)
Nach Turquet de Mayerne hat man unter dem Namen der
Doch setzt Kleists Erzählung genau in dem Moment ein, da dieser Glanz der Regierungskunst gefährdet ist, nämlich in dem Moment, da, mit Hegel gesprochen, »die Gesetze und Entscheidungen der Regierung die Einzelheit berühren und in der Wirklichkeit geltend gemacht werden«.
(61)
Auf der Burg des Junkers Wenzel von Tronka wird der aus Brandenburg kommende Rosshändler mit seinen Pferden, die er in Sachsen verkaufen will, an einem »Schlagbaum« aufgehalten. Wie Hegel von einem »Punkt« oder einer »Stelle« spricht, wo die Berührung zwischen »Regierung« und »Einzelheit« stattfindet,
(62)
ist auch der Kontakt zwischen Kohlhaas und dem Zöllner, der für den Junker das »[l]andesherrliche[] Privilegium« (DKV III, 13) geltend macht, der Anlage nach momentan und abstrakt: Worum es geht, ist eine zu passierende Grenze und eine anstehende Geldzahlung. In der
Wie die Regierungsagentur, von der hier erzählt wird, im Kontakt mit der »Einzelheit« und im unbegründeten Handeln ihrer Organe ihre Unordnung zeigt, wirft auch die Erzählung der Szene ungeordnete Einzelheiten und Umstände auf und entsichert damit das ordentliche Verhältnis von Ursache und Folge: (63) die Stimme, die Kohlhaas ruft, und der keine Figur zugeordnet ist; das »unendliche Gelächter«, das ausbricht, »als« Kohlhaas sich dem Junker nähert, und das dem Rosshändler zu gelten scheint, tatsächlich aber auf einen zuvor erzählten »Schwank« folgt (DKV III, 17); die in einem bloß temporalen oder doch kausalen Verhältnis zum Zufall des schlechten Wetters stehende und wenig später wieder kassierte Aufforderung des Junkers, Kohlhaas ziehen zu lassen, »da eben das Wetter wieder zu stürmen anfing« und die »dürren« Glieder des Junkers »durchsauste« (DKV III, 19); oder die Vielzahl nicht ausgedeuteter Gesten. Die in den »glänzenden Zinnen« und den als »glänzend« eingeführten Pferden zunächst vorgestellte gute Ordnung – hier geht sie in einer unordentlichen und aufgrund der vielen Rahmenbrüche in sich gebrochenen, unanschaulichen Szene zugrunde, in der erzählerisch prägnant, anschaulich und bildhaft nur das ist, dessen Sinn sich nicht erschließt. Doch betrifft solche Erosion nicht nur diese Stelle. Geradezu fundamental ist für Kleists Erzählkosmos jene »gebrechliche Einrichtung« (DKV III, 27), die Kohlhaas der ganzen Welt zuschreibt, die jedoch zuallererst und auch zuletzt in der Verwaltung deutlich wird. Dem entsprechen die Gelenkstellen dieser Prosa, ihre Satzanschlüsse, ihre Subjunktionen oder Satzzeichen. An ihnen stellt sich der Wirksamkeits- und Wirklichkeitsverlust jener Ordnung dar, die vormals noch im »Glanz« des Ausdrucks und der Dinge bei sich schien.
»Unendliches Gelächter« wird in der Novelle ein zweites Mal erschallen, nämlich als Kohlhaas' Pferde, die zwischenzeitlich verloren gegangen waren, über den »Wilsdrufer Schäfer« und den »Schweinehirten von Hainichen« schließlich an den »Abdecker von Döbbeln« geraten, der sie auf den Dresdner »Schloßplatz« führt, »auf wankenden Beinen, die Häupter zur Erde gebeugt«, beobachtet von einem »von Augenblick zu Augenblick sich vergrößernden Haufen Menschen [...] unter unendlichem Gelächter einander zurufend, daß die Pferde schon, um derenthalben der Staat wankte, an den Schinder gekommen wären« (DKV III, 92f.). Obschon die erzählerische Darstellung der Szene die Merkmale dessen trägt, was die klassische Rhetorik unter dem Stichwort der
Lässt sich Kleists Novelle auf die Situation des Regierens um 1800 beziehen, dann weil sie angesiedelt ist zwischen zwei Imaginationen fürstlicher Gewalt:
Kleists zu Beginn erwähnter Brief lässt sich ebenso wie seine
Die Verwaltung, die man jetzt aufzubauen versuchte, sollte, nicht zuletzt unter dem Druck französischer Kontributionsforderungen, einer wirtschaftsliberalen Grundausrichtung dienen. Sie sollte den Rahmen setzen für eine Gesellschaft selbständig wirtschaftender und miteinander ›frei konkurrierender‹ Bürger, in der nicht nur einige wenige Gutsbesitzer, sondern alle Bürger mit beträchtlichem Eigentum sich an der Provinzial- und Lokalverwaltung beteiligen konnten.
(72)
Als beispielhaftes Projekt galt dabei jenes »Befreiungs-Geschäft der Zünfte«, das Kleist in Königsberg als seinen »Lieblings-Gegenstand« bezeichnet hat (DKV III, 354). Bei diesem »Befreiungs-Geschäft« – nicht anders als bei etlichen anderen Wirtschaftsreformen, die die neu organisierte Verwaltung anbahnen sollte – ging es darum, sämtliche
Der Freisetzung und Stimulation ökonomischer Kräfte (und der erst danach in Angriff zu nehmenden Verfassungsreform) vorangehen musste allerdings die Lösung jener kommunikativen Blockaden, die die Reformer innerhalb der preußischen Verwaltung mit ihrem überkommenen »Formenkram« und starren »Dienst-Mechanismus« ausgemacht hatten.
(76)
Gehemmte Wirtschaftskraft und blockierte, weil schlecht eingerichtete Kommunikationswege der Verwaltung sah man in unmittelbarem Zusammenhang – nicht anders als es Kleists Novelle nahelegt
Im Zuge dieser neuen Organisation von Entscheidungswegen bildete sich ein geschlossenes Kommunikationssystem der Verwaltung heraus, in dem die Verwaltungsbehörden der unterschiedlichsten Ebenen innerhalb der diversen Territorien allesamt einheitlich aufgebaut und ausgestaltet waren; das sich mehr und mehr auf professionalisierte Beamte und eine nunmehr penibel geregelte Akten-, Registratur- und Archivführung stützte; und das mit seinen rasch etablierten Aufbewahrungs- und Dokumentationsroutinen die Möglichkeit zur rekursiven oder reflexiven Selbstbeobachtung und damit zur dauernden Selbstreform einräumte. (78) Erst unter diesen Vorzeichen bildet sich auch in Preußen heraus, was man in Frankreich bereits Mitte des 18. Jahrhunderts polemisch als ›bureaucratie‹ bezeichnet hatte – eine Herrschaft der Schreiber und Schriftstücke, die, wie das hier Karl Marx formulieren sollte, als »›bürgerliche Gesellschaft des Staats‹ dem ›Staat der bürgerlichen Gesellschaft‹« entgegentritt. (79)
Im Vorschlag für ein neues administratives Entscheidungssystem ging es, nicht anders als in Kleists
Dass die Einrichtung der Regierung und die Verfertigung souveräner Entscheidungen aus der Verwaltung heraus und im Rekurs auf allgemeine Prinzipien guter Regierung kritisiert wurde, entsetzte den Monarchen. In einer Tagebuchnotiz Hardenbergs heißt es zu Friedrich Wilhelms Reaktion, als ihm die Inhalte der Denkschrift vorgetragen wurden: »Le Roi a pris la chose pour une démarche révolutionnaire, l'appelle Meuterey«.
(83)
Im Kern ist die Denkschrift eine Kritik daran, dass die Praxis der Kabinettsregierung in Preußen »Gewalt« und »Verantwortung« auseinanderfallen lässt; dass also souveräne Macht von Personen verwaltet wird, die dafür nicht verantwortlich gemacht werden können. Für Stein war die eigentliche Regierung Preußens unterwandert von einer gänzlich unbehelligten Schattenregierung. Der Staatsrat, eigentlich der »Vereinigungs Punkt« sämtlicher »Haupt Departements«, sei tatsächlich »nahezu wirkungslos« und könne als »nicht existierend« betrachtet werden, hieß es in seiner Bestandsaufnahme, und dies, weil das Kabinett des Königs von einem bloßen Apparat zur Verschriftlichung des souveränen Willens zu einer machtvollen Instanz avanciert sei und sich zwischen die Minister und den König geschoben habe. Steins Denkschrift illustriert diesen Missstand mit einer kurzen Geschichte der preußischen Regierungstechnik: Friedrich Wilhelm I., so heißt es hier, »herrschte selbstständig« und beratschlagte mündlich mit seinen Ministern. Friedrich II. »regierte selbstständig«, bei ihm war aber der Kontakt zu seinen Ministern rein schriftlicher Natur, und die »Cabinets Räthe« folgten einfach seinem »Willen und waren ohne Einfluss«.
(84)
Friedrich Wilhelm II. hingegen »regierte unter Influenz eines Favoriten, seiner (männlichen und weiblichen) Umgebungen, sie traten zwischen den Thron und seine ordentlichen Rathgeber.« Und Friedrich Wilhelm III. »regiert unter der Influenz seines Cabinets«,
(85)
wie das Resümee lautet:
›Im Namen des Königs‹ agierte also eine Behörde, deren Handeln zwar entscheidend, ihr aber nicht zuzurechnen war, weil sie sich hinter der Person des Königs verbarg. Aus einer Institution, deren Zweck die bloße Verschriftlichung sein sollte, war – Steins Darstellung nach – eine so unbefugte wie uninformierte Entscheidungsagentur geworden. Einen guten Einblick in die Macht der Kabinettssekretäre gibt jene Beschreibung des königlichen Arbeitsumfelds, die von einem der Kabinettssekretäre selbst stammte, nämlich von Johann Wilhelm Lombard:
Die Macht der Kabinettssekretäre bestand also, neben der mündlichen Beratung, vor allem darin, Schriftstücke zu sortieren und zuzuteilen, einigen davon Priorität einzuräumen und sie dem König vorzulegen, andere zurückzuhalten und vor ihm zu verbergen. Statt des, wie es bei Stein heißt, »selbstständigen« Regierens früherer Monarchen hatte sich im Schatten des Königs eine unkontrollierte und willkürliche Macht der Sekretäre herausgebildet. Als solche einmal erkannt und benannt, stellten sich ihr die Reformer entgegen mit dem Ziel, Verwaltungsprozeduren als geregelte Entscheidungsverfahren durchzusetzen. Diese sollten nach Möglichkeit schriftlich vonstatten gehen oder doch zumindest schriftlich dokumentiert, nämlich penibel protokolliert und veraktet werden. Entscheidungsträger sollten nicht mehr in erster Linie Günstlinge oder Privilegierte sein, sondern diejenigen, die sich einer ordentlichen Ausbildung und Fachprüfung unterzogen und sich zudem im Sinne eines professionellen Lebenslaufs bewährt hatten.
Als Novelle, bei der, wie ein Vergleich des
Nachdem Kleists Kohlhaas daran gescheitert ist, seine Sache über die Kanäle des Rechts vorzubringen, sodass er nunmehr seinen Krieg gegen die Obrigkeit mit »Mandat[en]«, »Resolutionen« und öffentlich angeschlagenen Bekanntmachungen als einen Papier- und Informationskrieg (93) führt, versucht ihm Martin Luther mit einem Plakat Einhalt zu gebieten, das seiner Sache mit einer bemerkenswerten Begründung jedwede Legitimität abspricht: Die Obrigkeit sei nicht dafür verantwortlich zu machen, dass »eine Bank voll Gerichtsdienern und Schergen« dem Rosshändler sein Recht verweigert hat. Sie sei dadurch entlastet, dass sie »von [s]einer Sache nichts weiß«, ja, dass der Kurfürst von Sachsen, gegen den sich Kohlhaas auflehnt, »[s]einen Namen nicht kennt« (DKV III, 75). Der Souverän hat offenkundig keine Aufsichtspflicht und sieht sich auch nicht verantwortlich für jene Personen, die seine Macht verwalten. Als Luther dann Kohlhaas gegenübertritt, wiederholt er dieses Argument: »Wenn Staatsdiener hinter seinem Rücken Prozesse unterschlagen, oder sonst seines geheiligten Namens, in seiner Unwissenheit, spotten; wer anders als Gott darf ihn wegen der Wahl solcher Diener zur Rechenschaft ziehen, und bist du, gottverdammter und entsetzlicher Mensch, befugt, ihn deshalb zu richten?« (DKV III, 78) Nicht nur, weil in ihrer Mitte ein mit Schriften beladenes Pult steht und hier Luther sich immer wieder »seinen Papieren« (DKV III, 79f.) zuwendet, dreht sich diese Szene explizit um die Verwaltung und ihren Status. Luthers Lehre war für die Ausbildung einer preußischen Beamtenethik von größter Wichtigkeit, (94) was es umso triftiger und programmatischer erscheinen lässt, wenn er hier staatsbürgerlicher Verwaltungskritik jedwede Berechtigung abspricht.
Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass sich in dieser Szene verschiedene rechtshistorische Diskurse überlagern, sind Kohlhaas' Argumente doch in einem rousseauistischen Vokabular gehalten, das Martin Luther, dieser Apologet der Gehorsamspflicht gegenüber jedem Widerstandsrecht, (95) natürlich nicht kennen konnte: Gewährt der Staat einem Bürger nicht den »Schutz der Gesetze«, dessen Garantie überhaupt der Grund dafür ist, in eine staatliche Gesellschaft einzutreten, dann ist ihm gleichsam die »Keule« (DKV III, 78) der »naturzuständlichen Gewalt« (96) dessen in die Hand gegeben, der sich jenseits der Gesellschaft befindet. Rechten der Staatsbürger stehen Pflichten des Staats gegenüber, die ein Staat verletzen kann und Bürger einfordern können. Dieses Verständnis findet sich auch in Konzeptionen des Staatsdiensts wieder und lässt den Fürstendiener, dessen Logik Kleists Luther das Wort redet, zu einer »peinliche[n] Erscheinung« werden. (97) Schon Friedrich II. hatte gefordert, dass »Klagen von den Untertanen gegen die Beamten [...] jedesmal unparteiisch zu untersuchen« sind. (98) Einemnaturrechtlichen Verständnis entsprechend werden sich bald die Beamten als Diener des Staats – und nicht irgendeines Fürsten – verstehen, die vom Staat berufen werden. Sie folgen dem »großen Rufe des Staates«. (99) Und deshalb sind die Pflichten, die Beamte dem Staat gegenüber erfüllen, indem sie einen besonderen »Staatszweck« verfolgen, Pflichten der Allgemeinheit; sie helfen letztlich, »Freiheit und Eigentum« aller Staatsmitglieder zu schützen. Verletzen Beamte ihre Pflichten, dann auch die Rechte aller. In Missständen der Verwaltung ist nichts weniger gefährdet als der Gesellschaftsvertrag.
Mit einer Formulierung aus der Rigaer Denkschrift Altensteins gesprochen, kann man in Kohlhaas einen »Repräsentanten des wahren Zeitgeistes« sehen, für den sich all diejenigen Verfassungen überlebt haben, in denen »der Mensch nicht als solcher geachtet, sondern als Sache anderer Menschen im Staat« betrachtet wird.
(100)
Entsprechend gilt für Kohlhaas: »Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch!« (DKV III, 53) Und ebenso, wie es Altenstein in seinem »Überblick des Zustandes des Preußischen Staates in der letztverflossenen Zeitperiode« festhält, sieht sich Kohlhaas einem administrativen System gegenüber, auf das Adelige »feindliche, sich wechselseitig lähmende Kräfte« ausüben und in dem die »Rechte der Privilegierten« die Administration hemmen.
(101)
Kohlhaas, mit seinen Besitzungen in Brandenburg und Sachsen, seinen weitverzweigten Geschäftskontakten, seinem bürgerlich passionierten Nahverhältnis zu seiner Frau Lisbeth, seinem nach der Empfehlung Kantscher Pädagogik auf dem Boden spielenden Kind und seinen gut eingerichteten Vertragsverhältnissen, unterscheidet sich von diesem System, indem er seine eigenen »Geschäfte« weitaus besser verwaltet als der Staat die seinen. Während sächsische Staatsdiener, wie es Kleists Luther formuliert, des Namens des Kurfürsten »spotten« (DKV III, 78), während dem Junker Wenzel von Tronka Kohlhaas' Pferde »abhanden« kommen und dann zwischenzeitlich »gänzlich verschollen« (DKV III, 91) sind, und während das Schicksal des sächsischen Kurfürsten letztlich an einem schlichten Zettel und der Willkür einer Zigeunerin hängen wird, vermag Kohlhaas stets Rechenschaft abzulegen über seine
Er kann aufzählen, wie viele Male er bisher nach Dresden geritten ist, ohne den Passschein zu benötigen, den man jetzt von ihm verlangt (nämlich 17-mal). Er kann ein »Verzeichnis der Sachen« anfertigen, die sein Knecht in einem Schweinekoben gelassen hat, als man ihn von der Tronkenburg gejagt hat, und er kann, um seine Forderungen anzubringen, den »Wert derselben« spezifizieren (DKV III, 36). Er führt Unterlagen mit sich, die anzeigen, wie viel sein Besitz in Dresden wert ist. Er kann anhand von Papieren die »Kriminalverhandlungen« (DKV III, 103) belegen, die er gegen ein vormaliges Mitglied seiner Truppen geführt hat, um nachzuweisen, mit dessen Geschäften nichts zu tun zu haben. Kohlhaas' Aufstand gegen die Obrigkeit ist von Anbeginn eine Sache geordneter Aktenführung. In seiner Welt sind Nähe- und Distanzverhältnisse sicher eingerichtet, während die Obrigkeit einerseits unadressierbar fernbleibt und andererseits Kohlhaas' Knecht und seiner Frau gewalttätig auf den Leib rückt. Und während die Entscheidung des vom sächsischen Kurfürsten privilegierten Junkers Wenzel von Tronka, Kohlhaas aufzuhalten und seine Pferde an sich zu nehmen, von meteorologischen und anderen Zufällen motiviert scheint, trifft Kohlhaas seine Entscheidungen mit aller Bestimmtheit und nach der Maßgabe einer wohlüberlegten Vorsorge. Deshalb schließt er, bevor er sein »Geschäft der Rache« (DKV III, 60) aufnimmt, über den Verkauf seines Hofs in Kohlhaasenbrück einen »eventuelle[n] [...] Kaufkontrakt« (DKV III, 49) ab, der es ihm erlaubt, nach vier Wochen den Verkauf zu annullieren.
Kohlhaas' sorgfältiger Verwaltung der eigenen Unternehmungen korrespondiert die Kontrolle der eigenen Affekte: Nachdem er in einer Geheimschreiberei seinen Verdacht bestätigt findet, dass die Forderungen nach einem Passschein beim Grenzübertritt unbegründet gewesen ist, kann Kohlhaas »ohne irgend ein bitteres Gefühl« (DKV III, 21) zur Tronkenburg zurück reiten, um seine Pferde wieder an sich zu nehmen. Als er dort erfahren muss, dass sein Knecht verprügelt und davongejagt wurde, und er seine Pferde heruntergewirtschaftet sieht, unterdrückt er seinen Zorn: »Dem Roßhändler schlug das Herz gegen den Wams. Es drängte ihn, den nichtswürdigen Dickwanst in den Kot zu werfen, und den Fuß auf sein kupfernes Antlitz zu setzen. Doch sein Rechtgefühl, das einer Goldwaage glich, wankte noch; er war, vor der Schranke seiner Brust, noch nicht gewiß, ob eine Schuld seinen Gegner drücke« (DKV III, 25). Als er seinen Knecht zu den Vorgängen auf der Tronkenburg befragt, trägt er sorgfältig ein Indiz nach dem anderen zusammen, obwohl ihm dabei »das Herz emporquoll« (DKV III, 31). Als er dann seine rechtliche »Beschwerde« gegen den Junker Wenzel von Tronka einleitet, »beruhigt« (DKV III, 39) ihn die Aussicht auf den Erfolg seiner Klage. Und auch nachdem sie »auf höhere Insinuation« niedergeschlagen worden ist und er nun statt in Sachsen beim Kurfürsten von Brandenburg suppliziert, dämpft das Vertrauen in das schriftliche Verfahren (bei dem er nun allerdings schon auf die persönliche Gunst eines Vermittlers der Supplik angewiesen ist) seinen Zorn, sodass er »beruhigter über den Ausgang seiner Geschichte, als je, nach Kohlhaasenbrück« zurückkehren kann (DKV III, 45).
Kohlhaas' Affekte entsprechen dem Verlauf des ordentlichen Verfahrens, in Erwartung einer ordentlichen Entscheidung lassen sie sich jederzeit zurückhalten oder beruhigen. Erst als ihm die Aussicht auf einen ordentlichen Prozess genommen wird und ihm nach der Verschleppung und »Verzögerung« (DKV III, 41) seiner Klage der Rechtsweg verstellt wird, »schäumt[]« er »vor Wut« (DKV III, 47) – und wird er zu einem nunmehr ›negativen‹ Repräsentanten des Zeitgeistes. Wenn er sich dann selbst zur Recht setzenden Instanz und sogar zu einem »Statthalter Michaels, des Erzengels«, erklärt (wobei der Erzähler distanziert von der Figur berichtet, auf die er zunächst intern fokalisiert hatte), treiben ihn seine nun entfesselten Affekte in einen enthegten Krieg um »Genugtuung«; seine Schriftstücke sind nunmehr nicht mehr ordentlich adressiert und gehen nicht mehr den Weg des ordentlichen Instanzenzugs; sie werden zu Kampfmitteln, zu zielgerecht proklamierten Mandaten und wirkungsvoll gehängten Plakaten, die nicht mehr auf den alten Souverän und seine Stellvertreter zielen – sondern auf den neuen Souverän der Öffentlichkeit und öffentlichen Meinung. Selbst in der Eskalation der Kohlhaas-Handlung entspricht Kleists Novelle noch der zeitgenössisch reformistischen Perspektive. Denn insbesondere auf Hardenberg geht ein neues Konzept von Öffentlichkeit zurück, das diese nicht mehr der Kant'schen Konzeption einer rationalen Deliberation aufgeklärter Eliten (der ›gesitteten Welt‹) verpflichtet oder einfach als jenes Volk (der ›Untertanen‹) versteht, das sich vom ›Glanz‹ der Herrschaft blenden lässt; Öffentlichkeit begreift er vielmehr als ein medial aufgerüstetes Kampfgeschehen, in dem die Presse mit der Verwaltung koaliert, um einerseits den Sinn von Gesetzes- und Verwaltungsmaßnahmen zu kommunizieren, andererseits die Publikation von politischer und schöner Literatur weniger zu zensieren, als sie im Sinne der Reformprogrammatik zu steuern. (102)
In ihrem Schlussteil, als Kohlhaas' Versuche, die Obrigkeit um seiner Sache willen zu adressieren, allesamt fehlgegangen sind und die Ver-Waltung von souveräner Ordnung zu allseitiger Gewaltsamkeit und Verwirrung geführt hat, nimmt Kleists Novelle ihre Wendung ins Ungeheure. Sie vollzieht einen Registerwechsel – und wird von einer historischen oder rechtskasuistischen zu einer Schauererzählung. Die
In Kleists Novelle übernimmt ganz offensichtlich der zornige Kohlhaas diese Rolle, während seine zuletzt Alliierte, die Zigeunerin, als jene – genretpyisch – mysteriöse Instanz verstanden werden kann, die mit ihrer Wahrsagekunst oder ihrem ›Wahr-Sprechen‹ die Brücke schlägt zwischen der Weisheit oder auch dem Aberglauben des Volks einerseits, einem höheren oder Mehr-Wissen andererseits, das allein das Walten des Schicksals zu kennen scheint.
(105)
Weil sich diese Figur am Ende der Erzählung jeder souveränen Adressierung entzieht, weil sie heimatlos, verfemt oder gar vogelfrei zu nennen ist, hat man sie mit »der Kunst« und ihrer ›gebrechlichen Einrichtung‹ identifiziert.
(106)
›Gebrechlich‹ ist die
Man kann vielleicht auch in der Hinsicht von einem ›liminalen‹ Genre sprechen, dass Schauererzählungen systematisch am Rande der guten Form und des guten Geschmacks operieren. Unter diesen Vorzeichen wäre der
Dass hier das Thema der verwalteten Souveränität zum Zentrum einer Schauerhandlung geworden ist, signalisiert schon die Rolle des »so wichtigen Zettels« (DKV III, 137): Was dieses »Wunderblatt« (DKV III, 136) eigentlich enthält, bleibt unklar, weil, was die Zigeunerin dem sächsischen Kurfürsten verrät, auch rein strategischer Natur sein kann, und weil ihn Kohlhaas zu guter Letzt, um sein Mehr-Wissen dem Kurfürsten vorzuenthalten, einfach verschlingt. Als wohlkalkulierte Leerstelle gewährt der Zettel also einigen Interpretationsspielraum: Wird mit ihm die überkommene, im Fall von Kohlhaas gescheiterte Logik des Supplizierens invertiert? Demonstriert er einfach die nun heraufziehende Macht des
Friedrich Kittler: Das Subjekt als Beamter, in: Manfred Frank u.a. (Hg.): Die Frage nach dem Subjekt, Frankfurt/Main 1988, S. 401–420, hier S. 414; Maximilian Karl Friedrich Wilhelm Grävell: Der Staatsbeamte als Schriftsteller oder der Schriftsteller als Staatsbeamter im Preußischen. Actenmäßig dargethan von Regierungs=Rath D. Grävell, Stuttgart 1820, S. 5. Kleists Zeitgenosse Graevell, der 1816 Regierungsjustitiar in Merseburg, bald aber suspendiert und wegen Verstoßes gegen das Gebot der Amtsverschwiegenheit sowie wegen Beamtenbeleidigung inhaftiert wurde, bezweifelte, dass diese – von Kittler einfach gesetzte – Doppelexistenz substantiell, und nicht nur der Bezeichnung nach, möglich sei: »Wem steht die Entscheidung darüber zu, ob etwas in der einen oder andern Qualität geschehen sey?« (ebd.) Die Endfassung des Artikels wurde im April 2023 eingereicht.
Kleist-Zitate jetzt und im Folgenden im fortlaufenden Text aus: Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden, hg. v. von Ilse-Marie Barth et al., Frankfurt/Main 1987–1997.
Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Ders., Werke in zehn Bänden, hg. von Wilhelm Weischedel, Band IX, Darmstadt 1983, S. 51–61, hier S. 55.
Michel Foucault: Schriften in vier Bänden. Dits et Écrits, Band I 1954–1969, hg. v. Daniel Defert/François Ewald, Frankfurt/Main 2001, S. 90.
Reinhart Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart 1975, S. 13.
Vgl. hierzu Kleists Brief an Christian von Massenbach vom 23.4.1805: »Die Absicht, die man bei meiner Sendung nach Königsberg hat, ist wirkliche keine andere, als mich zu einem tüchtigen Geschäftsmann auszubilden, und die musterhafte Einrichtung der preußischen Kammern, durch meine Beihülfe einst, wenn ich angestellt sein werde, auf die fränkische zu übertragen« (DKV IV, 337).
Als derlei Spuren des Relationierens in Kleists Prosa erwähnt Kiefner, neben der Versammlung der wesentlichen Fakten und Koordinaten des betreffenden Falls gleich zu Beginn, die »historische Schreibart«, also den Gebrauch des Imperfekts, des Perfekts oder des praesens historicum; das ›umständliche‹ Erzählen, d.h. die (rechtskasuistische) Würdigung der circumstantiae, selbst wenn diese zur Fabel zunächst nichts beizutragen haben; den Versuch, durch syntaktische Konstruktionen Kausalzusammenhänge zu bekräftigen, zu behaupten oder zumindest vorstellbar zu machen; eine Interpunktion, die den Eigenarten eines mündlichen Vortrags (vor einem Kollegium) Rechnung trägt; zudem die Fokussierung auf wahrnehmbare, ›äußere‹ Geschehensabläufe, wohingegen das ›Innere‹ und ›Psychische‹, nämlich der Kenntnisstand der Figuren, ihre Motive, Absichten oder Wünsche eher zurückgestellt werden. – Vgl. Hans Kiefner: Species Facti. Geschichtserzählung bei Kleist und in Relationen bei preußischen Kollegialbehörden um 1800, in: KJb 1988/1989, S. 13–39, hier S. 17f., 26f., 30f., 34f., 37.
Vgl. Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution, S. 143, 154.
Allgemein zu diesem Übergang vgl. Juliane Vogel: Zeremoniell und Effizienz. Stilreformen in Preußen und Österreich, in: Inka Mülder-Bach/Jens Kersten/Martin Zimmermann (Hg.): Prosa schreiben. Literatur – Geschichte – Recht, Paderborn 2019, S. 39–54, hier S. 42.
Christopher M. Clark: Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947, München 2007, S. 376.
Gilles Deleuze/Félix Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, Frankfurt/Main 2014, S. 12, Hervor. i. O.
Günter Blamberger: Heinrich von Kleist. Biographie, Frankfurt/Main 2011, S. 223.
Friedrich Wilhelm III.: Instruktion König Friedrich Wilhelms III. für Oberstleutnant von Köckritz. Übergeben den 16. November 1797, in: Georg Küntzel (Hg.): Die politischen Testamente der Hohenzollern, nebst ergänzenden Aktenstücken, 2. Bd., Leipzig 1920, S. 146.
Friedrich Wilhelm III: Instruktion König Friedrich Wilhelms III. für Oberstleutnant von Köckritz, S. 144.
Freiherr vom Stein: Darstellung der fehlerhaften Organisation des Cabinets und der Nothwendigkeit der Bildung einer Ministerial Conferenz, in: Freiherr vom Stein: Briefwechsel, Denkschriften und Aufzeichnungen, Bd. 2, hg. v. Erich Botzenhart, Berlin 1936, S. 75–81, hier S. 79.
Hierzu auch Blamberger: Heinrich von Kleist, S. 225.
Hierzu Christiane Frey: Zur Poetik der Abkürzung: Leibniz, Kleist, etc., in: Albrecht Koschorke (Hg.): Komplexität und Einfachheit: DFG-Symposion 2015, Stuttgart 2017, S. 339–356, hier S. 353.
Johann Michael Seuffert: Von dem Verhältnisse des Staats und der Diener des Staats gegeneinander im rechtlichen und politischen Verstande, Würzburg 1793, S. 49.
Stefan Haas: Die Kultur der Verwaltung: die Umsetzung der preußischen Reformen 1800–1848, Frankfurt/Main 2005, S. S. 208f.; G. W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: G. W. F. Hegel: Werke. Bd. 7, hg. v. Eva Moldenhauer und Karl M. Michel, Frankfurt/Main 1989, S. 295f.
Friedrich Wilhelm III.: Instruktion König Friedrich Wilhelms III. für Oberstleutnant von Köckritz, S. 145f.
Zur Rolle der Schriftstücke im Kohlhaas vgl. Friedrich Balke: Kohlhaas und K. Zur Prozessführung bei Kleist und Kafka, in: ZfdPh 130 (2011), S. 503–529; Rupert Gaderer: Michael Kohlhaas (1808/10). Schriftverkehr – Bürokratie – Querulanz, in: ZfdPh 130 (2011), S. 531–545; Arndt Niebisch: Kleists Medien, Berlin 2019, S. 286–294.
Streng genommen ist der Burgvogt, anders als der ›Verwalter‹ mit seinem rein wirtschaftlichen Zuständigkeitsbereich, der Beauftragte für die rechtlichen Angelegenheiten auf der Burg.
Vgl. H. G. Adler: Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland, Tübingen 1974, S. 880–882.
Adler: Der verwaltete Mensch, S. 957.
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, Erster Theil, Zweyter Titel § 119, Berlin 1794.
Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution, S. 169.
Vgl. Foucaults Charakterisierung der kritischen Haltung als »Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden« in Michel Foucault: Was ist Kritik?, Berlin 1992, S. 12.
Carl Schmitt: Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, Berlin 1963, S. 92.
Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: MEW, Bd. 1, Berlin 1981, S. 389f. Hervorh. i. O. Gegen Schmitts Einschätzung argumentiert auch Robinson, der mit Ernst Bloch in Kohlhaas' Kampf einen Kampf um »Naturrecht und menschliche Würde« erkennt, der sich nur deshalb in einer »passion for positive right« ausdrücke, weil es unter gegebenen juridisch-bürokratischen Bedingungen unmöglich sei »to find the terms with which to formulate the just [...] object of its feeling«: Benjamin Lewis Robinson: Bureaucratic Fanatics: Modern Literature and the Passions of Rationalization, Berlin 2019, S. 51.
Vgl. hierzu Michel Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung, hg. v. Michel Sennelart, Frankfurt/Main 2004, S. 163; Karl Kroeschell: Deutsche Rechtsgeschichte 3 (seit 1650), 2. Aufl., Wiesbaden 1993, S. 203f.
Vgl. Friedrich Wilhelm III.: Gedanken über die Regierungskunst zu Papier gebracht im Jahre [17]96–97, in: Georg Küntzel (Hg.): Die politischen Testamente der Hohenzollern, nebst ergänzenden Aktenstücken, 2. Bd., Leipzig 1920.
John Bender/David E. Wellbery: Rhetoricality: On the Modernist Return of Rhetoric, in: Dies. (Hg.): The Ends of Rhetoric. History, Theory, Practice, Stanford 1990, S. 3–42, hier S. 7.
Zum rhetorischen Aufbau von Suppliken, zur Übersetzung der rhetorischen »art of positionality in address« in das Layout dieser Texte und zur allmählichen Bürokratisierung der Textform siehe Strunz, Lebenslauf und Bürokratie. Kleine Formen der preußischen Personalverwaltung, 1770–1848, Berlin 2022, S. 64–79.
Rüdiger Campe: Im Reden handeln. Überreden und Figurenbilden, in: Heinrich Bosse/Ursula Renner (Hg.): Literaturwissenschaft. Einführung in ein Sprachspiel, Freiburg i. Breisgau 1999, S. 123–139, hier S. 135.
Friedrich Wilhelm III.: Gedanken über die Regierungskunst, S. 118.
Vgl. hierzu Rupert Gaderer: Querulieren. Kulturtechniken, Medien und Literatur 1700–2000, Berlin 2021, S. 63ff.
Friedrich Wilhelm III.: Gedanken über die Regierungskunst, S. 119.
Vgl. zur Situation um 1800 Birgit Rehse: Die Supplikations- und Gnadenpraxis in Brandenburg-Preußen. Eine Untersuchung am Beispiel der Kurmark unter Friedrich Wilhelm II. (1786–1797), Berlin 2010, S. 127ff.
Zum ganzen Absatz siehe Rehse: Supplikations- und Gnadenpraxis, S. 122f. Zitat ebd. S. 123.
Zum Begriff des Rechtgefühls in Kleists Erzählung siehe Johannes F. Lehmann: Im Abgrund der Wut. Zur Kultur- und Literaturgeschichte des Zorns, Freiburg im Breisgau 2012, S. 266–296.
Wolfgang Neugebauer: Das preußische Kabinett in Potsdam. Eine verfassungsgeschichtliche Studie zur fürstlichen Zentralsphäre in der Zeit des Absolutismus, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 44 (1993), S. 69–115, hier S. 98.
Friedrich II.: Anti-Machiavel, oder der Versuch einer Critik über Nic. Machiavels Regierungskunst eines Fürsten, Frankfurt u. a. 1745, S. 351.
Rehse: Die Supplikations- und Gnadenpraxis, S. 127.
Neugebauer: Das preußische Kabinett, S. 98.
Michel Foucault: Das Leben der infamen Menschen, Berlin 2001, S. 41.
Foucault: Das Leben der infamen Menschen, S. 41. Zur Entwicklung der Verwaltungssprache siehe Peter Becker: »Das größte Problem ist die Hauptwortsucht«. Zur Geschichte der Verwaltungssprache und ihrer Reformen 1750 bis 2000, in: Ders. (Hg.): Sprachvollzug im Amt: Kommunikation und Verwaltung im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts, Bielefeld 2011, S. 219–244.
Vgl. Esteban Mauerer: Suppliken und Rekurse. Bayern im frühen 19. Jahrhundert, in: Ders. (Hg.): Supplikationswesen und Petitionsrecht im Wandel der Zeit und im Spiegel der Publikationen der Historischen Kommission, Göttingen 2020. S. 59–83, hier: S. 63f., 71.
Die Darstellung folgt: Herman Granier: Ein Reformversuch des preußischen Kanzleistils im Jahre 1800, in: Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 15 (1902), S. 168–180.
Zit. n. Granier: Ein Reformversuch des preußischen Kanzleistils, S. 169.
Zit. n. Granier: Ein Reformversuch des preußischen Kanzleistils, S. 170.
Vgl. hierzu Martin Haß: Über das Aktenwesen und den Kanzleistil im alten Preußen, in: Otto Hintze (Hg.): Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Bd. 22.2, Leipzig 1909, S. 201–255, hier: S. 204.
Clark: Preußen, S. 398f. – Ungeachtet der zunächst gescheiterten Abschaffung des nomine regis.
Rehse: Die Supplikations- und Gnadenpraxis, S. 129ff.
Vgl. Rüdiger Campe: Vor Augen Stellen. Über den Rahmen rhetorischer Bildgebung, in: Helmut Lethen/Ludwig Jäger/Albrecht Koschorke (Hg.): Auf die Wirklichkeit zeigen. Zum Problem der Evidenz in den Kulturwissenschaften: ein Reader, Frankfurt 2015, S. 106–136, hier: S. 107f., 121f.
Johann Heinrich Gottlob von Justi: Anweisung zu einer guten Deutschen Schreibart und allen in den Geschäften und Rechtssachen vorfallenden schriftlichen Ausarbeitungen, zu welchen Ende allenthalben wohlausgearbeitete Proben und Beyspiele beygefüget werden, Leipzig 1769, S. 207, unsere Hervorh.
In einem Bild Quintilians: die Muskulatur eines Ringers, die vollständig natürlich ausgebildet ist, so dass sich in ihrer Ausbildung ihre Zweckmäßigkeit erfüllt. – Quintilian: Institutio Oratoria, VIII, 4, 10ff.
Johann Heinrich Gottlob von Justi: Gesammlete Politische und Finanzschriften über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Cameral= und Finanzwesens, 3 Bde., Koppenhagen und Leipzig 1761–1764, Bd. 2, S. 350f.
Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I, S. 452.
Louis Turquet de Mayerne: La monarchie aristodémocratique, ou Le gouvernement composé et meslé des trois formes de légitimes républiques: aux Estats-généraux des provinces confédérées des Pays-Bas, Paris 1611, S. 17.
Peter Karl Wilhelm Hohenthal: Liber de Politia. Adspersis observationibus de causarum politiae et iustitiae differentiis, Leipzig 1776, S. 10.
Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 295.
Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 295.
Hierzu aus anderer Perspektive Frey: Zur Poetik der Abkürzung, S. 353.
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, in: Ders: Werke in zehn Bänden, hg. von Wilhelm Weischedel, Band VIII, Darmstadt 1983, A 222.
»Komisch ist [...], was im offiziell Geltenden das Nichtige und im offiziell Nichtigen das Geltende sichtbar werden läßt«. – Odo Marquard: Exile der Heiterkeit, in: Ders.: Aesthetica und Anaesthetica. Philosophische Überlegungen, München 2003, S. 47–63, hier: S. 54.
Friedrich II.: Anti-Machiavel, S. 351f., 356.
Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 451.
Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 449. Hierzu Slavoj Žižek: The Limits of the Semiotic Approach to Psychoanalysis, in: Ders.: Interrogating the Real, hg. v. Rex Butler/Scott Stephens, London 2005, S. 97–125, hier S. 111ff.
Zur »depersonalization of power« v.a. im Kontext der Verwaltung als revolutionäre Errungenschaft vgl. Ben Kafka: The Demon of Writing. Powers and Failures of Paperwork, New York 2012, S. 47.
Vgl. Vogel: Zeremoniell und Effizienz, S. 41.
Haas: Kultur der Verwaltung, S. 185.
Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution, S. 168.
Karl vom Stein zum Altenstein: Denkschrift v. 11.9.1807, in: Georg Winter (Hg.): Die Reorganisation des Preussischen Staates unter Stein und Hardenberg, Teil 1: Allgemeine Verwaltungs- und Behördenreform, Leipzig 1931, S. 364–566, hier S. 406; Koselleck: Preußen zwischen Reform und Revolution, S. 174.
Freiherr vom Stein: Nassauer Denkschrift vom Juni 1807, in: Georg Winter (Hg.): Die Reorganisation des Preussischen Staates unter Stein und Hardenberg, Teil 1: Allgemeine Verwaltungs- und Behördenreform, Leipzig 1931, S. 189–206, hier S. 202.
Vgl. Christiane Schreiber: »Was sind dies für Zeiten!« Heinrich von Kleist und die preußischen Reformen, Frankfurt/Main u. a. 1991, S. 111, 116.
Stein: Nassauer Denkschrift, S. 202; Otto Hintze: Stein und der preußische Staat, in: Historische und politische Aufsätze, Bd. 3, Berlin 1907, S. 69–108, hier S. 105.
Karl August von Hardenberg: Denkschrift v. 12.9.1807, in: Georg Winter (Hg.): Die Reorganisation des Preussischen Staates unter Stein und Hardenberg, Teil 1: Allgemeine Verwaltungs- und Behördenreform, Leipzig 1931, S. 302–363, hier S. 355.
Vgl. Haas: Kultur der Verwaltung, S. 296, 299, 432, 445.
Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, S. 247.
Carl Schmitt: Gespräch über Macht und den Zugang zum Machthaber. Gespräch über den Neuen Raum, Berlin 1994, S. 17.
Schmitt: Gespräch über Macht, S. 18.
Stein: Darstellung der fehlerhaften Organisation des Cabinets, S. 77.
Abgedruckt in: Freiherr vom Stein: Briefwechsel, Denkschriften und Aufzeichnungen, Bd. 2, hg. v. Erich Botzenhart, Berlin 1936, S. 105.
Stein: Darstellung der fehlerhaften Organisation des Cabinets, S. 76.
Stein: Darstellung der fehlerhaften Organisation des Cabinets, S. 76f.
Stein: Darstellung der fehlerhaften Organisation des Cabinets, S. 77.
Zitiert bei Neugebauer: Das preußische Kabinett, S. 99.
Seuffert: Von dem Verhältniss des Staats und der Diener des Staats, § 29. Hierzu Hans Hattenhauer: Geschichte des Beamtentums, Köln ua. 1980, S. 173ff.
Friedrich Wilhelm III.: Gedanken über die Regierungskunst, S. 116.
Als dritte, spezifisch preußische Variante, die in den ersten Jahren der Reformzeit die Vorzüge der primär schriftgestützten Verwaltung – v. a. deren Selbstreferentialität und autonome, von außen unbeeinflussbare Steuerung – im Modus der mündlichen Verhandlung zu realisieren suchte, wurde der ›Vorgang‹ beschrieben. Vgl. hierzu Angelika Menne-Haritz: Akten und Entscheidungsfindung in der Verwaltung, Vortragstyposkript, November 2022.
So im ersten Fall der oben ausführlich beschriebenen Supplikation an den brandenburgischen Kurfürsten, die eine Ergänzung der Buch- im Vergleich mit der Phoebus-Fassung darstellt: vgl. DKV III, 40–45.
Cornelia Vismann: Medien der Rechtsprechung, hg. v. Alexandra Kemmerer und Markus Krajewski, Frankfurt/Main 2011, S. 97; auch zitiert in Balke, Kohlhaas und K., S. 505.
So Gaderer: Querulieren, S. 91ff.
Hattenhauer: Geschichte des Beamtentums, S. 149f.
Wie von Foucault beschrieben, begründet Luthers Obrigskeitskonzept die Souveränität letztlich »zirkulär: Es verweist auf die Ausübung der Souveränität selbst; das Wohl besteht im Gehorsam gegenüber dem Gesetz, folglich besteht das Wohl, das die Souveränität sich zum Ziel setzt, darin, daß die Leute der Souveränität gehorchen.« – Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, S. 149; zur zeitgenössischen, Kleist bekannten naturrechtlichen Diskussion in Preußen vgl. auch Ingo Breuer: Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2009, S. 99.
Gideon Stiening: Zwischen gerechtem Krieg und kluger Politik. Naturrecht, positives Recht und Staatsraison in Kleists Michael Kohlhaas, in: Frieder von Ammon, Cornelia Rémi u. Gideon Stiening (Hg.): Literatur und praktische Vernunft, Berlin 2016, S. 485–522, hier S. 515.
Hattenhauer: Geschichte des Beamtentums, S. 174.
Hattenhauer: Geschichte des Beamtentums, S. 164.
Seuffert: Verhältnis des Staats und der Diener des Staats, S. 14.
Altenstein: Denkschrift v. 11.9.1807, S. 391.
Altenstein: Denkschrift v. 11.9.1807, S. 392 u. 395.
Vgl. etwa Andrea Hofmeister: Der Reformstaatskanzler und die Öffentlichkeit, in: Thomas Stamm-Kuhlmann: »Freier Gebrauch der Kräfte«. Eine Bestandsaufnahme der Hardenberg-Forschung, München 2001, S. 125–140, hier S. 125; Clark: Preußen, S. 398.
Vgl. Michel Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft, Frankfurt/Main 1999, S. 247.
Vgl. Michel Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft, S. 233f.
Vgl. Klaus-Michael Bogdal: Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung, Berlin 2011, S. 74, 80.
Vgl. Roland Reuß: »Michael Kohlhaas« und »Michael Kohlhaas«. Zwei deutsche Texte, eine Konjektur und das Schicksal der Kunst, in: Berliner Kleist-Blätter 3 (1990), S. 37f.
Vgl. hierzu allgemein Manuel Aguirre: Liminal Terror: The Poetics of Gothic Space, in: Jesús Benito und Ana Ma Manzanas (Hg.): The Dynamics of the Threshold, Madrid 2006, S. 13–38.
Die Formel »Es traf sich« tritt im hinteren Teil der Erzählung mit auffälliger Häufung auf. Vgl. hierzu die Passagen im Kohlhaas auf S. 17, 43, 64, 94, 108, 113, 115, 118, 123, 131, 134, 136.