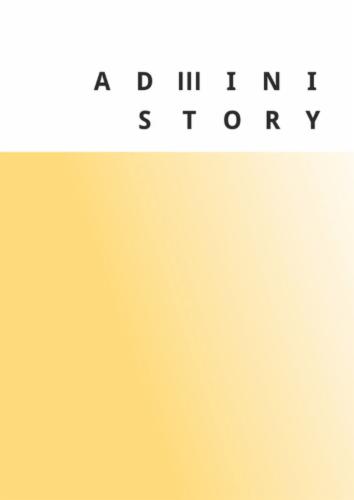Laufbahnen. Zwei Bilder verwalteter Welten in literarischer Begleitung: »Karriere« (A. Paul Weber) und »Abwärts-Aufwärts« (Uwe Pfeifer)
Publicado en línea: 09 jul 2025
Páginas: 221 - 237
DOI: https://doi.org/10.2478/adhi-2023-0013
Palabras clave
© 2023 Erk Volkmar Heyen, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Dieser Aufsatz versteht sich als Fortsetzung eines sehr viel weiter ausgreifenden Werks zur politischen Ikonografie, das ich 2013 unter dem Titel »Verwaltete Welten – Mensch, Gemeinwesen und Amt in der europäischen Malerei« im Akademie-Verlag veröffentlicht habe. Verwaltungsgeschichte und Kunstgeschichte erfahren dort eine umfangreiche wechselseitige Öffnung und Durchdringung. Sie erscheinen nicht als jeweils eng gefasste Behörden- bzw. Stilgeschichte, auch nicht als Werk- und Lebensgeschichte ihrer Protagonisten, sondern suchen und ergänzen sich durch Verbindung mit der Geschichte von Staat und Stadt, Religion und Recht, Wirtschaft, Bildung und Kultur.
Die Fortsetzung geschieht in besonderer Hinsicht und auch auf besondere Art. Sie betrifft einen Aspekt, der 2013 nur in eher beiläufiger Weise herausgearbeitet worden ist, nämlich die von mir so genannten »ästhetischen Grundformen der Visualisierung öffentlicher Verwaltung«. Dazu gehören der Horizont als Orientierungsform, die Tür als Grenz- und Schwellenform sowie die Bank als Iterationsform – eine Form, in der vor allem das Wiederholungsmoment, die durch Regeln vielfältiger Art bewirkte Standardisierung administrativen Denkens und Handelns aufscheint, auch wenn die Bank auf den ersten Blick nur dem Warten einen Ausdruck bietet, einem sitzenden, mehr oder weniger gedankenschweren Warten.(1)
Abschließend ist diese Reihe aus Horizont, Tür und Bank nicht gemeint. Wie schon die französische Wurzel des Wortes »Bürokratie« nahelegt (
Gar nicht in »Verwaltete Welten« behandelt wurde hingegen die Treppe. Wie sich im Titelwort »Laufbahnen« bereits andeutet, ist sie es, auf deren Erläuterung und Veranschaulichung in einem politischadministrativen Kontext dieser Aufsatz zielt. Dabei darf sich die Bildauswahl, will sie der künstlerischen Ausdrucksfreiheit Rechnung tragen, nicht allzu streng von der Alltagsvorstellung einer Treppe leiten lassen.(5) Nicht auf Material und Konstruktion kommt es an, sondern auf die Funktion der Treppe, die sich in der Stufung zeigt.
Zunächst bedarf es einer ästhetischen Sensibilisierung und Reflexion (II.). Es ist der Frage nachzugehen, was Treppen eigentlich kennzeichnet, nicht nur hinsichtlich ihrer architektonischen Funktion, sondern auch hinsichtlich ihrer bildlichen, besonders insoweit die Treppe der Veranschaulichung grundsätzlicher Problemlagen öffentlicher Verwaltung dient und damit als eine der ästhetischen Grundformen ihrer Visualisierung fungiert. In dieser Perspektive ist die Treppe bislang noch nicht betrachtet worden.(6)
Sodann sollen zwei Bildbeispiele vor Augen führen, was sich mithilfe einer Treppendarstellung hinsichtlich des Verwaltungspersonals (nicht seines Publikums) zum Ausdruck bringen lässt (III.–IV.). Es handelt sich um Grafiken und damit um eine Kunstform, die in »Verwaltete Welten« grundsätzlich keine Berücksichtigung gefunden hat. Sie sind in ihrer künstlerischen Absicht und Ausführung sehr unterschiedlich und spiegeln auch unterschiedliche politisch-administrative Konstellationen wider.
Das erste Bild, »Karriere«, entstand 1968 aus der Hand eines Künstlers, der sich in der Bonner Republik vor allem durch seine zeitkritischen Arbeiten einen Namen gemacht hat: A. Paul Weber (1893–1980), ein Thüringer von Geburt, aber nach dem Krieg in Schleswig-Holstein beheimatet.(7) Um einem möglichst breiten Publikum bekannt zu werden, gab er seit 1959 einen »Kritischen Kalender« heraus, in dem er seine Grafiken vorstellte. Begleitet wurden sie dort von einem Text aus fremder Feder, der zuvor bereits andernorts und in anderer Absicht veröffentlicht worden war. Wie sich Bild und Text zueinander verhalten, steht nicht von vornherein fest. Man darf den Text immerhin als einen Kommentar verstehen, der zur Erschließung des Bildsinns anregen möchte, ohne ihn dadurch festlegen zu wollen. Insofern kann er Zustimmung ausdrücken, aber auch Fragen aufwerfen und zu weiteren Überlegungen führen. Dieses Verfahren lädt dazu ein, auch hier auf den »Karriere« begleitenden Text einzugehen und ihn darüber hinaus durch andere zu ergänzen, die sich ebenfalls zur Kommentierung eignen.
Dasselbe Verfahren wird auf das zweite Bild angewandt: »Abwärts-Aufwärts«, geschaffen 1994 von Uwe Pfeifer (geb. 1947). Er hat seine Kunst in der realsozialistischen DDR erlernt und fortentwickelt. In seinem von architektonischen Strukturen geprägten malerischen und grafischen Werk spielen Treppen eine auffällige Rolle.(8) Eine literarische Begleitung für das hier vorzustellende Bild hat der Künstler nicht vorgesehen. Sie ist aber sehr wohl möglich und, wie zu zeigen sein wird, für das Verständnis auch durchaus von eigenem Reiz.
Abschließend wird eine Bilanz gezogen (V.). Während die grundsätzliche Absicht dieses Aufsatzes – gewissermaßen sein systematisches Interesse – darin besteht, die in »Verwaltete Welten« angesprochenen ästhetischen Grundformen der Visualisierung öffentlicher Verwaltung um die Treppe zu ergänzen, bieten die zur Begleitung der beiden ausgewählten Bilder herangezogenen Texte Anregungen, sie in weitergreifenden historischen Zusammenhängen zu sehen und zu verstehen.
Um die Bildfunktion von Treppen einschätzen zu können, bedarf es zunächst einer Vergegenwärtigung ihrer architektonischen Funktion. Diese zu bestimmen, erscheint auf den ersten Blick ganz einfach: Treppen dienen dazu, im begehbaren menschlichen Lebensraum einen Höhenunterschied zu überwinden. Darin liegt jedoch nur ihre Normalfunktion. Weitere Funktionen können sich ihr anschließen und sie anreichern.
Zum einen kann eine Treppe dazu dienen, in den eigenen Grenzen oder seitlich ausgreifend einen Ort anzubieten, der besseres Sehen und Hören ermöglicht. Dies ist der Fall bei den Treppen einer Sportarena oder eines Hörsaals. Zum anderen kann eine Treppe dazu dienen, über sich hinauszuweisen und als Teil eines Weges zu einem besonderen Ort zu führen, auf den sie vorbereitet und an dessen Charakter sie dadurch teilhat. Beispiele dafür sind die großzügig gestalteten, auf ein Augen- und Ohrenvergnügen einstimmenden Treppen bedeutender Theater und Opernhäuser (die Mailänder
Was die bildliche Funktion betrifft, so ist auch hier mit Gewinn zu unterscheiden. Treppendarstellungen können zunächst eine rein mimetische Absicht verfolgen, also reale oder imaginierte architektonische Verhältnisse abbilden wollen. Diese Art ist hier nicht weiter von Interesse.
Sie können aber darüber hinaus, sei es ergänzend oder gar vorrangig, auch Funktionen bei der Gestaltung der Bildfläche übernehmen. Dies geschieht hauptsächlich in drei Absichten, wie sich anhand bekannter Werke schon der frühneuzeitlichen Malerei leicht veranschaulichen lässt: zum einen, um auf der Bildfläche eine größere Zahl von Personen mit der gewünschten Genauigkeit sichtbar zu machen, als ohne Treppe möglich wäre, wenigstens wenn der Raum in einer einheitlichen Perspektive erfasst werden soll (Beispiel: Raffaels Fresko »Schule von Athen« in der
Treppendarstellungen dieser letzten Art wecken bereits unser Interesse. Dies gilt noch etwas mehr für ebenfalls gut bekannte Treppendarstellungen aus der Malerei des 19./20. Jahrhunderts, in denen sich, ungeachtet höchst unterschiedlicher Kunstauffassungen, die Aufmerksamkeit dem Treppengang zuwendet, also der Art der körperlichen Bewegung, die mit der bestimmungsgemäßen Nutzung einer Treppe verbunden ist.
Insoweit sind hier zunächst zwei Werke zu nennen, welche die Ästhetik – die sinnliche Erscheinungsweise – der Bewegung mit der Ästhetik des weiblichen Körpers verbinden: »The Golden Stairs« von Edward Burne-Jones (1880; ein anmutiger Reigen barfüßiger, schmiegsam-schlanker, hell und leicht gewandeter, schüchtern-schöner junger Musikantinnen, die mit ihren Instrumenten eine Treppe hinabwandeln, ja – deren gerundeten Schwung aufnehmend – geradezu hinabströmen), und »Ema – Akt auf einer Treppe« von Gerhard Richter (1966; ganz ausgerichtet auf den stufenbewussten, gleichwohl selbstsicheren Gang einer einzelnen Frau und die ihn begleitenden, nur gedämpft und verschwommen gezeigten Licht- und Farbverhältnisse, dabei alle Einzelheiten, die Burne-Jones wichtig gewesen wären, beiseite lassend).
Sodann ist auf zwei Werke hinzuweisen, die – in den Jahren des fundamentalen Umbruchs europäischer Malerei – die Poesie eines Burne-Jones schroff zurückweisen und von der eines Richter noch nichts ahnen, wenigstens den besonderen Aspekt des Femininen stark zurücktreten lassen: »Nu descendant un escalier« von Marcel Duchamp (1912; ein Akt, der dem Hinabsteigen nicht in seiner natürlichen Geschmeidigkeit nachspürt, sondern die ihm eigene Bewegung in metallisch aufscheinende Flächen und kantige Linien zerlegt) und »Die Bauhaustreppe« von Oskar Schlemmer (1932; deutlich weniger radikal in der Formgebung, Farben einsetzend, aber doch auf kühlen Abstand bedacht, nunmehr die Architektur betonend und in Rücksicht darauf die Treppengängerinnen – diesmal in einer Aufwärtsbewegung erfasst – in ihrer Gestalt nur vergleichsweise maßvoll und behutsam vereinfachend).
Doch fehlt diesen beiden Bilderpaaren immer noch etwas: Die Treppe zeigt sich nicht so, dass sie als eine ästhetische Grundform der Visualisierung öffentlicher Verwaltung angesehen werden könnte. Was fehlt, kommt leichter in den Blick, wenn man statt »Treppe« (ein wahrscheinlich lautmalerisch entstandenes Wort) »Stiege« sagt. Denn dieses Wort – eines, das mit »steigen« verbunden ist (wie im Französischen »escalier« und »escalader«) und dadurch eine Aufwärtsbewegung herausstellt, die sich in »steigern« und »eskalieren« dramatisiert – weist auf ein anderes, dessen Verwaltungsbezug im Deutschen wie im Französischen offenkundig ist: »Karriere«.
Wer nach Treppendarstellungen mit solchen administrativen Bezügen sucht, wird freilich bemerken, dass bei ihnen eine einseitige Charakterisierung der Treppe als Orientierungsform, Schwellen- und Grenzform oder Iterationsform nicht recht gelingen will, sich vielmehr eine bildliche Multifunktionalität beobachten lässt.
Die Treppe erscheint vor allem als Iterationsform, und zwar aufgrund der Stufung, die ihre architektonische Funktion bestimmt, also die Funktion einer fußläufigen Höhenüberwindung im umbauten Raum. In dieser Stufung materialisiert sich gewissermaßen die zu ihrer Nutzung erforderliche Schrittfolge oder, anders ausgedrückt, in ihr wird dafür gesorgt, dass die Schrittfolge, dem zeitlich Vorüber- und Vergehenden entrückt, in einer dauerhaften Form und mithin als bleibende Möglichkeit in Erinnerung gehalten wird. Die Treppe gliedert insofern nicht nur den Binnenraum der Verwaltung, sie taktet auch deren Binnenzeit und erweist sich so als starres Requisit einer beweglichen Choreografie. In der Darstellung eines Bildes nun bleibt davon zunächst nur ein Abglanz, nämlich Raum und Zeit öffentlicher Verwaltung, wie sie durch die Gliederung des Bildraums mittels der Darstellung einer Treppe vor Augen gerufen werden können. Es versteht sich, dass damit aber nicht nur Aufstieg und Abstieg, sondern zugleich Disziplin und Routine, jedenfalls aber Gleichförmigkeit, zum Thema werden.
Darüber hinaus erscheint die Treppe jedoch auch als Schwellenform. Als solche erfasst sie den Zugang zur Verwaltung, und zwar üblicherweise einladender als eine Tür, die bei geschlossener Stellung eher den Charakter einer Grenzform hat. Drittens schließlich tritt sie als Orientierungsform auf, und zwar dann, wenn es um den Gang und den Blick geht, die sie in einem administrativen Handlungskontext ihren Nutzern (Personal bzw. Publikum) zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen Interessen eröffnet.
Mit dieser Sichtweise können wir nun an eine genaue Betrachtung der beiden hier ausgewählten Bildwerke gehen und schauen, welche gedankliche Bereicherung ihnen durch eine literarische Kommentierung zuwächst.
In Webers Bild »Karriere« (Abb. 1) wirkt die Treppe zugleich als Iterationsform und als Orientierungsform oder, anders ausgedrückt, als eine von Iteration geprägte Orientierungsform.

A. Paul Weber, „Karriere“, 1968; Lithografie, 44 x 32,5 cm; A. Paul Weber: Kritischer Kalender, 11 (1969), 24. August – 6. September
Was ist zu sehen? An einem Geländer aus ineinander verschlungenen Paragraphenzeichen läuft ein sorgfältig frisierter, geschniegelter Jüngling, noch milchgesichtig und kussmundig, mit Frack und Handschuh sowie artig glänzendem, modisch hochhackigem Schuhwerk ausstaffiert, leichtfüßig und erwartungsfroh eine herrschaftliche Treppe empor, eine übergroße Brille auf der Nase, aber anscheinend ohne Augen hinter den Gläsern, eine von Trommel- und Trompetenpapier umwickelte Schultüte im Arm und zugleich mit dem Aufziehschlüssel eines mechanischen Getriebes im Rücken. Und auf dieser Treppe, deren Stufen ihn zum Eilen anzutreiben scheinen, läuft er nicht allein, ist er nur einer von vielen (links und rechts von ihm, leicht zu übersehen, lassen sich ein weiteres Knie und ein weiterer Schuh erkennen). Die Paragraphenzeichen des Treppengeländers verdeutlichen es: Hier wird das Personal des »öffentlichen Dienstes«, wie es sich selbstlobend nennt, in seinem zum Laufen gebrachten »Werdegang« ins Bild gerückt, dies aber auf eine Weise, die sich vom grundsätzlich freundlich und dankbar gestimmten Ton, wie ihn gern zum Abschluss einer großen Verwaltungskarriere überreichte Festschriften anschlagen, stark unterscheidet.
Das Bild stößt sich offensichtlich an naiver Engstirnigkeit und Selbstgefälligkeit. Ist dies bloß spöttischer, aber letztlich nachsichtiger, zum Schmunzeln einladender versponnener Humor oder doch schon bissige Satire? Das Erscheinungsbild des Jünglings und sein architektonisches Ambiente wirken aus der Zeit gefallen. Satire zeigt zwar nie die ungeschminkte Wirklichkeit – in mancher Hinsicht schminkt sie ab, in anderer schminkt sie neu, sie vereinfacht und spitzt zu, stellt in Frage und dies durch Ausrufezeichen von entschlossener Einseitigkeit –, doch pflegt Satire, vor allem wenn sie auf Veränderung drängen möchte, den Adressatenkreis ihrer Kritik und deren Angriffspunkt genauer zu bestimmen, als es hier geschieht. Die sonst bei Weber anzutreffende ernste Schärfe fehlt. Deswegen darf man gespannt sein, welche literarische Begleitung er für sein Bild vorgesehen hat.
Der Text bezieht sich nicht auf seine eigene Zeit, nicht auf die öffentliche Verwaltung, die Weber selbst kennengelernt hat. Er ist vielmehr einem der satirischen Werke des Freiherrn von Knigge entnommen, veröffentlicht drei Jahre nach der Französischen Revolution unter dem Titel »Des seeligen Herrn Etatsraths Samuel Conrad von Schaafskopf hinterlassene Papiere«. Hier ruft der reaktionäre Protagonist die »treuen Mitglieder des ehrwürdigen Pinsel-Ordens« dazu auf, dem »einreißenden Freyheits-Drange« entgegenzutreten und dafür zu sorgen, dass »die trügliche Vernunft sich nicht anmaße, über die Rechte der Herrscher, Vornehmen und Reichen zu raisonniren«, und »die sogenannte Aufklärung, diese fürchterliche Hyder, nicht in die niedern Classen eindringe«. Zu diesem Zweck sei »die erwerbende Classe, besonders der Baurenstand«, so »mit Abgaben und Arbeit« zu belasten, »daß diesen Leuten der unnütze Kitzel vergehe«.(9)
Die Textauswahl überrascht zunächst. Denn unmittelbar betrifft Webers Bild Freiheit ja nur auf eine Weise, die in Knigges Text gar nicht angesprochen wird, nämlich hinsichtlich des Verwaltungspersonals, das sich, Weber zufolge, in seiner Aufstiegsorientierung einem Streben und Drängen unterwirft, wie es die Bewegungsmechanik eines unfreien Automaten kennzeichnet. Mögen also Kleidung und Schuhwerk des Jünglings sowie das architektonische Ambiente zu der im Text aufgerufenen Epoche auch passen, so scheint doch dessen Auswahl weniger dem Bild selbst als vielmehr – in einer bloß vordergründigen Weise – den turbulenten politischen Ereignissen seines Entstehungsjahres 1968 geschuldet zu sein, also dem damals nicht nur in Deutschland erneut »einreißenden Freyheits-Drange«.
Bei dieser Deutung ginge freilich der Bezug zum Titel des Bildes verloren. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Karriereaspekt des Textes hervorzuheben: Er verdeutlicht beispielhaft, dass jene, welche die politischadministrative Führung eines Landes beanspruchen, unter bestimmten Umständen Gefahr laufen, die Sachlage zu verkennen, und folglich Führungskarrieren, die dies ermöglichen, kritikwürdige Folgen haben können. Der Text lenkt die Aufmerksamkeit dadurch auf einen Aspekt, der im Bild zwar keinen klaren Ausdruck findet, aber dort gleichwohl angelegt ist: auf die politischen Folgen eines »öffentlichen Dienstes«, der seinen eigenen, karrierebetonten Bewegungsgesetzen folgt und darüber – zumal in der Erregung über das von außen hereindringende und bedrängende Ungewohnte – die Interessen, denen er hauptsächlich zu dienen berufen ist, vernachlässigt, wenn nicht gar vergisst, statt sie neu zu bedenken.
Passender, weil deutlicher mit dem Karriere-Thema verbunden, wäre wohl eine andere Passage aus den Gesprächen des »Pinsel-Ordens« gewesen, die Weber ein Jahr später seiner Lithografie »Die Wahlstrategen« zur Seite gestellt hat:
Hier zeigt sich neben der individuellen Perspektive des Karrieristen die systemische Perspektive jener, die an der Spitze den machtvollen Gesamtüberblick für sich beanspruchen.
Zweifellos lassen sich aber schärfere Texte finden, und Weber hat sie für thematisch verwandte Bilder auch gefunden. So z.B. im Blick auf »Hackordnung« (1969), wo ganz allgemein auf Hierarchien in der Arbeitswelt Bezug genommen wird.(11) Der von Weber zur Begleitung ausgewählte Text – einer unter dem Titel »Regeln gegen Mitmenschen« ebenfalls 1969 erschienenen deutschen Übersetzung eines satirischen Werks von Arthur H. Chapman entnommen – mokiert sich über die Selbstdarstellung solcher Hierarchien, der zufolge sie nach Fähigkeit und Verdienst eingerichtet seien. »›Der Beste soll gewinnen‹ ist das ›Strategem‹ par excellence für Geschäfts-, Berufs- und Verwaltungshierarchien«, heißt es dort, um sodann erläuternd fortzufahren:
Dass Karriere zu machen noch in anderer Hinsicht seinen Preis hat, verdeutlicht Weber anhand der nur wenig später, 1972, entstandenen Lithografie »Dreck am Stecken«, diesmal wieder unter sinnfälliger Nutzung des Treppenmotivs.(13) Auch hier entzündet sich seine Kritik an den sozialen Kosten des beruflichen Aufstiegs, insbesondere den Rechtsverletzungen und Verlusten an Menschlichkeit, die mit einem solchen Aufstieg allzu oft einhergehen. Während aber der Begleittext für »Hackordnung«, soweit er sich auf die öffentliche Verwaltung bezieht, nur die Binnenperspektive des Verwaltungspersonals berücksichtigt, nimmt er für »Dreck am Stecken« das Verhältnis zum Verwaltungspublikum mit ins Visier und zeigt dabei, wie dessen berechtigte Interessen durch das Karrieresystem auf Distanz gehalten werden.
Entnommen hat Weber seinen Text einer kleinen satirischen Erzählung von Kurt Tucholsky, die 1928 veröffentlicht worden ist und, wie schon ihr Titel »Was soll er denn einmal werden?« nahelegt, von einer Berufsberatung handelt. Als sich im Gespräch mit einer Mutter herausstellt, dass ihr Sohn »eine gewaltige Scheu vor der Verantwortung« hat und um Ausreden nie verlegen ist, hält der Berater die Ausgangsfrage schlagartig für geklärt: »Ja, dann gibt es nur eines. Lassen Sie ihn Beamten werden. Da trägt er die Verantwortung, aber da hat er keine.« Sodann macht er der Mutter deutlich, wie sehr sich die Lage in anderen Berufen davon unterscheidet, und erläutert, worauf der Sohn zu achten habe, sollte er den Weg in die Beamtenschaft einschlagen wollen, und womit er dann rechnen könne:
Hätte Weber für seine Lithografie »Karriere« in einem »Kritischen Kalender« für unsere heutigen Tage werben können, so wären ihm zur Begleitung sicherlich noch ganz andere Texte in den Sinn gekommen. Als Quelle dafür käme z. B. ein Roman in Betracht, der den Betrieb der Brüsseler EU-Verwaltung aufs Korn nimmt: »Die Hauptstadt« von Robert Menasse, einem Österreicher, aus einem Lande also mit einer großen Tradition in Sachen Verwaltungssatire. Das Aufstiegsmoment der Treppe ist hier allgegenwärtig, doch nicht verbunden, wie bei Weber, mit Aufstiegslust, sondern mit Arbeitsfrust. Die hohen beruflichen Erwartungen des Einstiegs in die Beamtenlaufbahn haben sich verflüchtigt und sind einer alltäglichen, schon allzu oft empfundenen Erschöpfung gewichen.
Mit kritischem, von Ironie und Sarkasmus durchdrungenem Blick werden die Neuankömmlinge einer
Sicherlich, damit ist noch kein Urteil über das Personal der eigentlichen EU-Verwaltung gesprochen. Deren Beamte können ganz anders sein, aber sie fallen dann doch auf. So der »Spross einer alten italienischen Adelsfamilie«, der als Kabinettschef des Kommissionspräsidenten fungiert, eine »barocke, farbenfrohe Erscheinung«:
Doch besteht kein Grund, sich in besonderer Weise über Karrieristen in der Brüsseler EU-Verwaltung und ihrem Umfeld zu mokieren. Karrieristen findet man auch andernorts, nicht zuletzt in außereuropäischen Ländern mit zwar anderer politischer Kultur, aber ebenfalls starker Verwaltungstradition. So z. B. in Ägypten, dem Land einer legendär großartigen und mächtigen Verwaltung zur Zeit der Pharaonen. Der Literatur-Nobelpreisträger von 1988, Nagib Machfus, jahrelang selbst als Beamter im Bildungsministerium Ägyptens tätig, gibt davon auf eindrucksvolle Weise Zeugnis in seinem 1975 erschienenen Roman »Ehrenwerter Herr«: Obwohl ohne jede Protektion, allein auf die eigene Begabung und Ausdauer setzend, strebt der Sohn eines Kutschers zum Erstaunen seiner Mitwelt an die Spitze der Verwaltung eines Ministeriums, seinen Sehnsuchtsort. Er verschafft sich das zum Einstieg in diese Laufbahn nötige Wissen, beginnt sie im Archivkeller des Ministeriums, im Rahmen der achten Besoldungsklasse, steigt Stufe für Stufe auf, erreicht aber sein berufliches Ziel erst nach vielen Rückschlägen am Ende seines Lebens – ein Aufstieg zum Tode gewissermaßen, zunächst bewundert, beneidet, aber letztlich doch bemitleidet, denn mit diesem Aufstieg geht die Verschwendung seines Lebens einher, die ihn daran hindert, sich seinen anderen Herzenswunsch, eine glückliche Heirat, zu erfüllen.
Bleibt man im europäischen Raum, geht aber zeitlich etwas weiter zurück, ins 19. Jahrhundert, so fällt der Blick auf der Suche nach einer literarischen Thematisierung der Stufung öffentlicher Ämter unvermeidlicherweise auf das russische Zarenreich und die von Peter dem Großen in die Verwaltung des Landes eingeführte und sie fortan prägende Rangtabelle. Diese sollte der Schaffung und Sicherung eines leistungsorientierten Dienstadels dienen, degenerierte jedoch im Laufe der Zeit zu einem Titulatursystem, das massiv für Zwecke individueller Karriereplanung instrumentalisiert wurde. Es war der Rang selbst, auf Grund dessen ein Amt und die damit zusammenhängenden Rechte vergeben wurden, nicht Vorbildung und Eignung, und er war es auch, der die Umgangsformen bestimmte, bei amtlichen Sitzungen, Zeremonien und ebenso bei Gottesdiensten, Festtafeln, Eheschließungen und Beerdigungen.
Der Ton, in dem die zeitgenössische russische Literatur darauf Bezug nimmt, ist weithin spöttisch. Hinzuweisen ist insbesondere auf zwei große, bedeutende Romane: »Die Abenteuer Čičikovs oder Tote Seelen« von Nikolaj V. Gogol‘, erschienen 1842, und »Auferstehung« von Lev N. Tolstoj, erschienen 1899. Sie spiegeln das zaristische Karrieresystem auf höchst anschauliche Weise wider. Da ich auf beide Werke schon einmal sehr ausführlich – mit Zitaten zu Dienstrang und gesellschaftlicher Stellung, Lebensstil, kognitiven und normativen Orientierungen – eingegangen bin,(17) sei hier nur darauf verwiesen und als Ergänzung auf eine kleine, 1883 erschienene Erzählung von Anton Čechov aufmerksam gemacht.
Der Titel dieser Erzählung greift eine Unterscheidung auf, die sich in ihrer Karriererelevanz schon bei Gogol‘ findet: »Der Dicke und der Dünne«. Hier werden die fatalen gesellschaftlichen Auswirkungen der Rangtabelle zu des Lesers Belustigung und Erschrecken auf den Punkt gebracht: Zwei alte Schulkameraden, die sich nach langer Zeit einmal wiedersehen, begegnen einander zunächst ganz unbefangen und schwelgen vergnügt in Erinnerungen an ihre gemeinsame Schulzeit. Jedoch verliert sich die Unbefangenheit schlagartig und weicht zunehmender Verkrampfung, als ihnen ihr unterschiedlicher Rang bewusst wird. Der Dünne gehört nämlich als Kollegienassessor nur zur achten Rangklasse, der Dicke als Geheimrat hingegen schon zur dritten.
Kehren wir zur deutschen Literaturgeschichte zurück, um uns noch kurz dem mechanischen Aspekt von Webers »Karriere« zuzuwenden: dem Aufziehschlüssel im Rücken des strebsamen Jünglings. In dieser Hinsicht könnte man daran denken, die Lithografie textlich statt von Knigge von dessen Zeitgenossen Jean Paul begleiten zu lassen, hat dieser doch – unter dem Eindruck der öffentlichen, auch Friedrich den Großen und deutsche Kameralisten (Wolff, Justi, Schlözer) erfassenden Resonanz des mechanistischen Weltbilds von Descartes und vor allem Lamettrie – in seinen Erzählungen wiederholt die maschinenhaften Züge menschlichen Verhaltens kritisch in den Blick genommen. Er entdeckt sie nicht zuletzt im hierarchisch geordneten Herrschaftsapparat des Fürstenstaats. Als er in seiner »Selberlebensbeschreibung« von 1818/19 auf seine Schulzeit in Schwarzenbach an der Saale zu sprechen kommt und sich dabei für einen freiheitlich gesinnten Unterricht einsetzt, wird ihm schmerzlich bewusst, wie wenig selbstverständlich eine solche Gesinnung ist.
Denn »durch alle Ämter hinauf« – klagt er in der ihm eigenen verspielten, kauzig-humorigen Art – verspüren die Menschen leider »keine Lust, knechtische Maschinen zu freien Geistern zu machen und dadurch ihre Schöpf-, Herrsch- und Schaffkraft zu zeigen, sondern sie glauben diese umgekehrt zu erweisen, wenn sie an ihre nächste oder Obermaschine aus Geist wieder eine Zwischenmaschine und an die Zwischenmaschinen endlich die letzte anzuschienen und einzuhäkeln vermögen, so daß zuletzt eine Mutter Marionette erscheint, welche eine Marionettentochter führt, die wieder ihrerseits imstande ist, ein Hündchen in die Höhe zu heben«.(18)
Wenn sich hier die Vorstellungen von Maschine und Marionette verbinden, so ist auch dies Webers Verwaltungssatire vertraut,(19) und es wundert nicht, dass Menasse in seinem bereits zitierten Roman ebenfalls auf die Marionettenmetapher zurückgreift, als er einen Brüsseler Beamten im Kollegenkreis die Meinung äußern und erläutern lässt, nach Jacques Delors habe es keinen wirklichen Kommissionspräsidenten mehr gegeben:
Hier könnten die Textbeispiele enden. Doch sei zum Schluss noch eines angefügt, das heiterer stimmt.(21) Es führt zur Treppe zurück, präsentiert sie auch – insofern gut zu Webers Bild «Karriere« passend – als von Iteration geprägte Orientierungsform, unterwirft die dabei wirksame Orientierung jedoch einem geradezu subversiven Wandel. Die Rede ist von Andreas Izquierdo und seinem Roman »Das Glücksbüro«, erschienen 2013.
Albert Glück, Sachbearbeiter in einem »Amt für Verwaltungsangelegenheiten«, sieht die Welt am liebsten streng geordnet und aus der ruhigen Warte seines Dienstzimmers. Doch kehrt er zur rechten Zeit ins volle Leben zurück, wach geküsst von einer jungen Frau namens Anna, einer Malerin, die in ihrer Kunst zu seiner Verwunderung vor allem spontan und chaotisch sein will. Die Verlebendigung braucht Zeit, aber sie kommt mit Macht und erfasst schließlich auch, wiederum von Anna bewirkt, Alberts berufliche Arbeitsweise: Die ihm selbstverständlich gewordene administrative Binnenorientierung öffnet sich den Erwartungen und Wünschen des Verwaltungspublikums. Er belässt es nicht länger dabei, über Verfahrensformalien zu belehren, sondern erwärmt sich für die Sache, um die es geht. Er versucht zu helfen, zunächst noch im Rahmen seiner eigenen amtlichen Zuständigkeit, dann durch Aufklärung über das Gewirr anderer Zuständigkeiten, schließlich aber auch weit darüber hinaus. So wandelt sich sein nur über viele Treppen erreichbares Dienstzimmer im siebten Stock von einem Rückzugsort für ihn selbst zu einem Sehnsuchtsort für andere, zu einem begeistert aufgenommenen »Glücksbüro«. Wie zu erwarten, erzeugt dergleichen in der übrigen Verwaltung heftige Wirbel.(22)
Auch in Pfeifers Bild »Abwärts-Aufwärts« (Abb. 2), in zurückhaltender Farbigkeit gestaltet, tritt die Treppe als eine von Iteration geprägte Orientierungsform in Erscheinung. Doch im Gegensatz zu Webers »Karriere« hat sie keinen klaren architektonischen Zuschnitt mehr. Sie wirkt ins Metaphorische transponiert, unterstützt von einem Titel, der das Wechselhafte im Treppengang betont.

Uwe Pfeifer, „Abwärts-Aufwärts“, 1994; Farblithografie, 53,8 x 76,6 cm; Wolfgang Büche (Hg.): Uwe Pfeifer. Zeitbalance. Malerei, Graphik, Zeichnungen, Halle 1997, S. 163
Es liegt nahe, hier einen politischen Bezug anzunehmen: Was zu DDR-Zeiten noch allein dem Staat oblag, wurde nach der »Wende«, dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, in erheblichem Umfang dem Markt geöffnet oder gänzlich überlassen. So verwandelten sich große Teile öffentlicher Verwaltung in Räume der Privatwirtschaft, und alle anderen Teile wurden in Anpassung an das Grundgesetz einer fundamentalen Restrukturierung unterworfen. Auf diesen gewaltigen Umbruch im politischen, sozialen und persönlichen Leben spielt das Bild an. Da der Bildtitel die Abwärtsbewegung vor der Aufwärtsbewegung nennt, hätte er, um die politisch-gesellschaftlichen Folgen eines System- und Elitenwechsels etwas prägnanter zu fassen, auch »Niedergang und Aufstieg« lauten können. Doch hat Pfeifer darauf verzichtet, und die Zurückhaltung gegenüber solcher Zuspitzung entspricht auch durchaus der weiteren Gestaltung des Bildes. Betrachten wir es genauer.
Auf der Treppe sind sich soeben zwei Männer begegnet, nach Hut und Aktentasche zu urteilen zwei Männer aus der Arbeitswelt eines Büros. Der abwärts laufende bewegt sich etwas verdrückt, den Hut fest auf den Kopf gezogen und in einem abgenutzten, entkräfteten Blauviolett gestaltet. Im selben, aber nunmehr kraftvollen Farbton gehalten, fasst der aufwärts laufende seinen Hut sorgfältig mit der Hand, so als habe er ihn kurz zuvor zum Gruß gezogen und gerade wieder zurückgesetzt; vielleicht treibt ihn aber auch nur die Sorge, den Hut hier oben angesichts zu erwartender Windstöße nicht zu verlieren. So weit, so normal.
Anders als der Bildtitel vermuten lässt, ist die übliche Treppenoptik jedoch aufgegeben, haben Oben und Unten ihre klare Gegensätzlichkeit verloren. Der Aufsteigende findet sich rechts unten abgebildet, der Absteigende links oben. Die Stufen erscheinen flach gezogen, ihrer Tiefen und Höhen verlustig und insoweit auch in ihrer Orientierungskraft beeinträchtigt. Die eigentlich zu unterstellende Einheitlichkeit des Raums wirkt gestört, ein gemeinsamer Horizont ist nicht zu erkennen.
Dies lässt sich vielleicht so deuten, dass die beiden Männer in einer – ihnen übergeordneten und selbst nicht durchsichtigen – Kippbewegung zweier einander widersprechender, aber doch nicht völlig voneinander isolierter politischer Systeme befangen sind, so dass der Gewinn des einen mit dem Verlust des anderen zu begleichen ist – ein Prozess, den die Weltgeschichte schon oft gesehen hat und wohl noch oft sehen wird.
Hier kommt ein großer Unterschied zu Webers »Karriere« zum Ausdruck. Ist die Perspektive des Aufstiegs für Webers Karrieristen noch ganz eindeutig und unbeschwert, nämlich in naiver Weise auf das fortlaufende Erklimmen der Ämterstufen gerichtet, erscheint sie für Pfeifers Büromenschen wie mit einer Hypothek belastet, der Hypothek, sich seines Beurteilungsstandpunkts auf Dauer nicht sicher sein zu können. Vielleicht liegt ja hier auch der Grund dafür, warum sich der Künstler mit seiner Perspektive nicht in den begehbaren Raum des abgebildeten Geschehens hineingestellt hat, sondern darüber schwebt, also einen rein imaginären, nicht natürlich teilnehmenden, sondern gewissermaßen übernatürlich beurteilenden Standpunkt einzunehmen sucht. Zu einem abschließend bewertenden Urteil scheint er aber dabei noch nicht gekommen zu sein.
Eine vergleichbare, wenn auch weniger stark ausgeprägte Eigenwilligkeit in der Raumgestaltung macht sich in Pfeifers Werken bereits vor der Zeit der »Wende« bemerkbar. Ein Beispiel dafür bietet sein beachtlich großes, in Öl, Tempera und Mischtechnik gemaltes Bild »Feierabend« von 1977, das zum Bestand der Nationalgalerie in Berlin gehört.(23) Es zeigt einen belebten Fußgängertunnel und bezieht sich dabei konkret auf Halle-Neustadt, eine das Staats- und Stadtverständnis der DDR kennzeichnende Neubau-Siedlung, in der zu jener Zeit auch der Maler selbst wohnte.
Auf den ersten Blick scheint die Treppe hier keine besondere Bedeutung zu haben, so sehr wird er angezogen von dem dicht gedrängten Zug der »Werktätigen« am Ende eines Arbeitstages. Doch auf den zweiten erkennt man, dass sie den Fluchtpunkt einer Straßen- oder Gleisunterführung und damit einer Laufbahn eigener Art bildet, einen Ort des Aufatmens nach dem Tunnelgang: vom Tageslicht deutlich aufgehellt und aufgewärmt und damit abgesetzt vom kühlen Glanz, den das Band der Neon-Leuchten auf die lastende Decke und die glatten, gleichmäßig rechtwinklig gegliederten Wand- und Bodenflächen gleiten lässt. Im Gegensatz zu dem feinen, ebenmäßigen, doch auch starren Liniengeflecht der rechten Bildseite, das die eng geführte Architektur des Tunnels wie am Reißbrett nachzeichnet, strömt auf der linken in nunmehr stark ausgebildeter Plastizität das dieser Architektur sich fügende menschliche Leben: gedrängt in dichter Schrittfolge, einer kalten Witterung entsprechend mit Mänteln und Hüten ausgestattet, einer wohlanständigen, konfektionierten Kleidung, die eher auf Büroarbeit denn Fabrikarbeit deutet.(24)
Auch dieses Bild hat zweifellos eine politischadministrative Dimension. Schon bei seiner ersten öffentlichen Ausstellung erregte es Aufsehen, gefolgt von Diskussionen über die Art und Reichweite des ihm eigenen kritischen Potenzials und die Rolle seiner ästhetischen Fassung.(25) Aber auch hier wird diese Dimension nicht ausformuliert.
Kehren wir zu »Abwärts-Aufwärts« zurück und wenden wir uns der literarischen Begleitung dieses Bildes zu. Es mag naheliegen, dafür Werke heranzuziehen, die ebenfalls die »Wende«-Zeit reflektieren. Doch sei hier etwas kühner vorgegangen und bei der Suche eine sehr viel ältere Zeit in den Blick genommen, die aber von ähnlich tiefgreifenden Umbrüchen gekennzeichnet war wie die des Zerfalls der Sowjetunion, der Auflösung des Warschauer Pakts und der daraus hervorgehenden deutschen Wiedervereinigung: die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Es ist freilich eine Zeit, in welcher der Staat noch im Werden sich befand und die Ämterordnung noch nicht so hierarchisch, laufbahnmäßig durchrationalisiert war, wie es Webers »Karriere« und Pfeifers »Abwärts-Aufwärts« widerspiegeln. Tradierte lehensrechtliche Bindungen verzögerten die Entwicklung, auch wenn die Katholische Kirche, die viele politische Gemeinwesen durchdrang, und das sich zunehmend zentral ausrichtende französische Königreich insoweit beispielgebend wirkten.
Es darf daher nicht überraschen, dass bei der Visualisierung dieser frühen Ämterordnung die Treppe im Sinne eines Gebäudebestandteils noch keine vergleichbare Rolle gespielt hat. Dies heißt aber nicht, dass der im vorliegenden Zusammenhang maßgebliche Aspekt der Stufung sowie die sich mit ihr verbindende Aufstiegshoffnung und Abstiegsfurcht ebenfalls fehlen würden.(26)
Haben wir uns hinsichtlich Webers »Karriere«, entsprechend der Praxis seines »Kritischen Kalenders«, auf eine vielfältige, eher kleinteilige literarische Begleitung eingerichtet, können wir uns hinsichtlich Pfeifers »Abwärts-Aufwärts« auf einen einzigen, dafür jedoch vergleichsweise ausführlich präsentierten Text konzentrieren.
Er verdankt sich Johann Jakob Christoph (volkstümlich auch: Hans Jakob Christoffel) von Grimmelshausen. In seinem großen Roman »Der abenteuerliche Simplicissimus« – erschienen 1668/69, ein Werk voller Lebenssaft, mal grob, mal fein, immer anregend, zuweilen mitreißend – trifft man auf eine unterscheidungsreiche Ämterwelt, mag die zeittypische schlichte Rede von »Obrigkeit« auch etwas anderes nahelegen.(27) In den großen Zügen bietet sich diese Welt wie folgt dar.(28)
Simplicius, der Protagonist des Romans, wächst bei einfachen Leuten auf, ist aber – wie sich für ihn erst sehr viel später herausstellt – der leibliche Sohn eines Adeligen, der ihm als Einsiedler den ersten Unterricht erteilt, nicht nur im Lesen und Schreiben, sondern auch hinsichtlich einer anfangs noch sehr einfältig bleibenden christlichen Weltsicht, zu der er an seinem Lebensende wieder zurückkehren wird, als höchst weltkritischer, aber auch und nicht zuletzt selbstkritischer Einsiedler.
Bis es soweit ist, gestaltet sich sein Lebenslauf zunehmend turbulent. Gleichwohl führt Grimmelshausen für dessen Beschreibung schon früh ein Stufenmotiv ein, und zwar, indem er von einer »Staffel der Hoheit« spricht, um die Stufung der Ämter zum Ausdruck zu bringen, die Simplicius mit der Zeit übernimmt.(29) Den Anfang macht – hier zeigt sich die ironische Seite des Verfassers – das »Hirtenamt«. Das Bild der Staffelung ist aufstiegsorientiert, sodass es auch Verwendung findet, als Simplicius nach vielen leidvollen Erfahrungen in einem Prozess der Läuterung seine weltliche Orientierung auf eine geistliche umstellt und sich vornimmt, statt der »Staffeln der Hoheit« nunmehr die »höchsten Staffeln der Tugend« zu ersteigen.(30)
Besonders anschaulich dargestellt wird die Aufstiegsorientierung bereits am Anfang des Romans, und zwar nicht technisch anhand einer Treppe, die man ordentlich ersteigen kann, sondern organisch anhand eines Baums, den man – weil noch wildwüchsig und weniger überschaubar – erklettern muss.(31)
Das entworfene Bild gewinnt geradezu den Charakter eines Gemäldes. Simplicius entwickelt hier nämlich – »gleichwie in einem Traum« und, wie sich ihm noch zeigen wird, in der Vorschau auf zukünftige eigene Erfahrungen – die Vorstellung, die um seine Wohnung herum wachsenden Bäume würden plötzlich ihre Gestalt verändern:
Über diesen Wurzeln und den darauf folgenden untersten Ästen, auf denen es den Menschen kaum besser ergeht, ihr mühseliges Leben aber schwer auf den Wurzeln lastet, »saßen so alte Hühnerfänger, die sich etlich Jahr mit höchster Gefahr auf den untersten Ästen beholfen, durchgebissen, und das Glück gehabt hatten, dem Tod bis dahin zu entlaufen, diese sahen ernstlich und etwas reputierlicher aus als die untersten, weil sie um einen gradum aufgestiegen waren; aber über ihnen befanden sich noch höhere, welche auch höhere Einbildungen hatten.«(32)
Darüber wurde der Stamm ganz glatt »ohne Äst, mit wunderbarlichen Materialien und seltsamer Seifen der Mißgunst geschmieret, also daß kein Kerl, er sei denn vom Adel, weder durch Mannheit, Geschicklichkeit noch Wissenschaft hinaufsteigen konnte.«(33)
Im Rahmen des Zweiten und Dritten Buchs, die Simplicius’ Eingliederung in die militärische Ordnung schildern, zeigt sich, wie eine solche wesentlich hierarchisch bestimmte Ordnung nicht mehr nur im Traum in ein kritisches Licht gerät, sondern im Gespräch mit Vorgesetzten ganz grundsätzlich und mithin auch für die reale politisch-administrative Welt infrage gestellt wird. Dabei hilft ihm sein inzwischen erlangter Narren-Status (»Kalb«). Zunächst erfolgt die Infragestellung noch aus einer sich lustig gebenden Naivität heraus. So, als Simplicius in seinem Dienst beim Sekretär des »Gubernators« ein »Titular-Buch« in die Hände fällt, ein Verzeichnis der im dienstlichen Verkehr zu verwendenden Titel und Anreden. Sie erscheinen ihm allesamt als spottwürdige »Torheiten«, schließlich gehe es doch immer nur um Menschen.(35) Sodann erfolgt die Infragestellung jedoch in erstaunlich gelehrter und freimütiger Weise gegenüber dem Gubernator selbst, und zwar unter Hinweis auf die drückenden Lasten und quälenden Sorgen, die sich aus Habgier und Ehrgeiz ergeben, dem nie nachlassenden Wunsch, immer »höher in Kriegsämtern zu steigen« und immer »größern Reichtum zu sammeln«.(36)
Damit ist eine Reflexionsebene erreicht, wie sie auch – unter anderen Umständen und mit anderen Mitteln – in Pfeifers Bild »Abwärts-Aufwärts« Ausdruck findet. Die Fragen, die Text und Bild aufwerfen, erscheinen ähnlich in ihrer kritischen Haltung gegenüber Karrieresystemen: Was treibt zum Aufstieg, was ist sein Lohn und was sein Preis – persönlich, gesellschaftlich, politisch? Welche Maßstäbe der Richtigkeit sollen für die Beurteilung der Beantwortung gelten? Gibt es überhaupt solche Maßstäbe? Insofern passen Bild und Text gut zueinander.
Dem gegenüber tritt zurück, dass die Antworten unterschiedlich ausfallen. Im Text von Grimmelshausen werden sie innerhalb eines normativen Horizonts gestellt, der wesentlich christlich gestaltet ist, wenngleich er angesichts der Simplicius begegnenden konfessionellen Spaltung und Gräuel zunächst wetterwendisch erscheint und sich erst in dessen reifen Jahren, nach dem Vorbild des Eremiten, aufund abklärt. In Pfeifers Bild hingegen ist von einem solchen normativen Horizont nichts zu spüren, schon gar nicht von einem christlich getönten. Fragen werden zwar emotional angedeutet (im Abstieg enttäuschte Ermattung und Sorge, begleitet von einer Empfindung der Ungerechtigkeit, im Aufstieg freudige Zuversicht und Tatkraft), aber nicht einmal andeutungsweise beantwortet.
Dem Bildbetrachter und Textleser bleibt die Frage, wie es denn mit der eigenen Lebenseinstellung bestellt ist.
Versuchen wir, Bilanz zu ziehen. Zunächst sei festgehalten, dass sich die Treppe mit guten Gründen als eine der ästhetischen Grundformen der Visualisierung öffentlicher Verwaltung ansehen lässt. Maßgeblich dafür ist ihre Funktion, mittels Stufen die Laufbahnen von Personal und Publikum, ihren Aufstieg und Abstieg, zu veranschaulichen. Die Treppe kann sich insoweit zum einen auf den sichtbaren, von Personal und Publikum begehbaren Raum und zum anderen auf den unsichtbaren Raum der von ihnen übermittelten Nachrichten und Entscheidungen beziehen. Wie konkret oder abstrakt auch immer gefasst, stets erscheint die Treppe dabei als eine von Iteration geprägte Orientierungsform.
Im Einzelfall hängt die Qualifizierung als Grundform davon ab, dass der Treppe eine bildprägende Kraft zugesprochen werden kann, sei es aufgrund ihres Anteils an der Bildfläche oder aufgrund ihres Gewichts in der Bildinterpretation. Vorausgesetzt ist dabei, dass auf diese Weise ein wichtiger Aspekt öffentlicher Verwaltung zum Ausdruck kommt.
In Hinblick auf das von den beiden hier ausgewählten Bildern thematisierte Verwaltungspersonal – das Verwaltungspublikum blieb ausgespart – veranschaulicht die Treppe insbesondere eine organisatorisch wie prozedural fortlaufend wirksam gehaltene Hierarchie zwischen Amtswaltern.(37) Nicht allein das, was gesagt wird, und die dafür angeführten Gründe fallen ins Gewicht und zeitigen Folgen, sondern auch und nicht zuletzt, wer es gesagt hat. Insofern vermag eine Treppe die Differenz zwischen Vorgesetzten und Nachgeordneten anzudeuten.
Der hier gewählte intermediale Zugang zu den Phänomenen administrativer Hierarchie erweitert deren verwaltungswissenschaftliche Analyse, und zwar insofern er besondere Ausdrucksformen ihrer Wahrnehmung in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit in den Blick rückt. Dabei schadet es nicht, im Gegenteil, dass dies in einer historischen Perspektive geschieht, da sie den Gegenwartsanalysen mehr Tiefgründigkeit und Tragfähigkeit verleiht.
Während Webers »Karriere« einer sich fraglos gebenden Aufstiegsperspektive folgt, führt Pfeifers »Abwärts-Aufwärts« eine durchgreifende Störung solcher Perspektive vor Augen. Webers gelassen, ja heiter stimmende Ironie steht Pfeifers eher bittere, unsicher nach Orientierung suchende Verwunderung gegenüber. Hinsichtlich der jeweils provozierten Emotionen ist die Bilanz mithin gemischt. Grundsätzlich stimmt die Aufstiegsperspektive optimistisch, wenigstens für den, der in dieser Perspektive sein Leben führen kann. Aber sie kann auch von der Sorge begleitet sein, doch nicht so hoch steigen zu können wie gewünscht oder gar in einen von Neid gequälten Abstieg zu geraten.
Von solchen Entwicklungen und Stimmungen zeugen auch die Webers »Karriere« und Pfeifers »Abwärts-Aufwärts« begleitenden literarischen Texte. Ihr Ton fällt mal schärfer, mal sanfter aus, durchgängig jedoch ist die Kritik an ungerechtfertigten Karrieren und anderen Formen der Machtanmaßung, in denen sich die Sorge ums Eigenwohl als Sorge ums Gemeinwohl ausgibt.
Siehe Erk Volkmar Heyen: Verwaltete Welten – Mensch, Gemeinwesen und Amt in der europäischen Malerei, Berlin 2013, und zwar zum Horizont S. 6 ff., 16, 19, 27, 30 f., 142, 273 ff., 278, zur Tür S. 140 f., 166 ff., 176 ff., 182 ff., zur Bank S. 170 ff., 177 ff., 181 f.
Sei es, dass er an den Bildrand gesetzt ist (siehe Heyen: Verwaltete Welten, S. 87, 89, 245, 248, 250, 253), oder, da von vielen anderen Gegenständen bedeckt, seine formale Prägnanz verloren hat (siehe Heyen: Verwaltete Welten, S. 230, 249, 252, 261).
Siehe Heyen, Verwaltete Welten, S. 114, 161, 164, 232, 270.
Siehe Heyen, Verwaltete Welten, S. 227 (Jan van Ravesteyn: »Der Haager Magistrat«, 1636), 251 (Francisco de Goya: »Jovellanos«, 1798), 263 (George Grosz: »Sonnenfinsternis«, 1926). In diese Reihe lassen sich auch zwei Bilder aufnehmen, die zwar nicht in »Verwaltete Welten«, wohl aber in einem vorbereitenden Aufsatz berücksichtigt worden sind: Erk Volkmar Heyen: Buch und Schreibtisch im Amtswalterporträt der Frühen Neuzeit. Zur Ikonographie der Orientierung politisch-administrativen Handelns, in: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 19 (2007), S. 205–246, hier S. 221 (Jan van Ravesteyn: »Pieter van Veen«, späte 1620er-Jahre) und 236 (Sebastiano del Piombo: »Ferry de Carondelet«, 1510–1512). Vgl. damit die wiederum nur beiläufige Präsentation von Lese- und Schreibtisch in den in Heyen: Buch und Schreibtisch, S. 206–217, ausführlich besprochenen Kardinalporträts von Jan van Eyck, Lucas Cranach d. Ä. und Vittore Carpaccio.
Dies gilt auch für andere Grundformen. Andernfalls müsste man ja hinsichtlich des in Endnote 4 erwähnten Bildes von Grosz behaupten wollen, dass dort gar kein Tisch zu sehen sei, weil ihm die Beine fehlten. Offensichtlich reicht hier aber eine Fläche, um die sich Personen versammelt haben, zur klaren Kennzeichnung als Tisch aus. In dieser Perspektive könnte man erwägen, den platzund zeitsparenden Service-Schalter, an dem das Personal zwar sitzt, das Publikum aber steht, als eine Sonderform des Tisches anzusehen; siehe Heyen: Verwaltete Welten, S. 235, zu einem Bild von George Tooker: »Verwaltungsbüro«, 1956.
Das zweibändige Gemeinschaftswerk von Uwe Fleckner et al. (Hg.): Handbuch der politischen Ikonographie, München 2011, widmet der Treppe – wie übrigens auch dem Horizont und dem Tisch, der Tür und der Bank – keinen eigenen Artikel. Friedrich Mielke, der die »Treppenkunde« zu seiner Lebensaufgabe gemacht hatte, war vor allem architekturhistorisch interessiert; siehe Friedrich Mielke: Handbuch der Treppenkunde, Hannover 1993. Im Rahmen der von ihm herausgegebenen Schriftenreihe »Scalalogia« werden die Malerei und Grafik nur am Rande und die kunsthistorische Literatur dazu kaum zur Kenntnis genommen. Am meisten Material bietet insofern noch Friedrich Mielke: Treppen in der Kunst, Eichstätt 2008 [2001], doch bleiben die Kommentare zu Malerei und Grafik auch hier eher oberflächlich. Durchaus ergiebig dagegen und dabei offen für andere Ansätze und Sichtweisen Arthur Engelbert: Die Treppe. Eine kulturgeschichtliche und medienkritische Studie anhand ausgewählter Beispiele aus verschiedenen Medien, mit einem Glossar, Würzburg 2014.
Eine Gesamtwürdigung geben Helmut Schumacher / Klaus J. Dorsch: A. Paul Weber. Leben und Werk in Texten und Bildern, Hamburg 2003. Seine Grafiken stehen schon am Anfang meiner Auseinandersetzung mit Bildern öffentlicher Verwaltung. Siehe Erk Volkmar Heyen: Die Bürokratie in der satirischen Graphik A. Paul Webers, in: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 6 (1994), S. 179–196, versehen mit umfangreichen Literaturhinweisen und einer Stellungnahme zur damaligen Reformdiskussion des Öffentlichen Dienstes. Siehe auch, ebenfalls schon 1994 verfasst, aber nunmehr die Belletristik einbeziehend, Erk Volkmar Heyen: Das Bild der Verwaltung in Kunst und Öffentlichkeit. Über Wahrnehmung und Pflege einer politischen Institution, in: Gerrit Manssen (Hg.): Rechtswissenschaft im Aufbruch. Greifswalder Antrittsvorlesungen, Köln 1996, S. 23–42, hier S. 29–32.
Zu seiner Entwicklung siehe Ralf-Michael Seele (Hg.): Uwe Pfeifer. Bilder-Zeit 1984–1994. Gemälde und Grafiken, Meiningen 1995, und Eleonore Sent: Zum druckgraphischen Werk Uwe Pfeifers, in: Wolfgang Büche (Hg.): Uwe Pfeifer. Zeitbalance. Malerei, Graphik, Zeichnungen, Halle 1997, S. 127–138. Sein Ölbild »Beton und Steine« (1972) habe ich bereits in Heyen: Verwaltete Welten, S. 208 f., vorgestellt.
Siehe A. Paul Weber: Kritischer Kalender, 11 (1969), 24. August – 6. September. Als Quelle wird genannt Adolph Freiherr von Knigge: Des seligen Etatsraths Samuel Conrad von Schaafskopf hinterlassene Papiere, Frankfurt a. M. 1965, ohne Seitenangabe.
A. Paul Weber: Kritischer Kalender, 12 (1970), 6.–19. September. Als Quelle wird genannt Adolph Freiherr von Knigge: Des seligen Etatsraths Samuel Conrad von Schaafskopf hinterlassene Papiere, Frankfurt a. M. 1965, ohne Seitenangabe.
Veröffentlicht in A. Paul Weber: Kritischer Kalender, 12 (1970), 4.–17. Oktober. Das Bild zeigt eine kleine Pyramide von bebrillten, grimmig blickenden, mit Schnäbeln und Krallen versehenen Vogel-Männern, von denen einer ein Schriftstück nach oben, der Zigarre rauchenden und Zeitung lesenden Amtsspitze weiterreicht und ein anderes Schriftstück nach unten, dem nachgeordneten Amtspersonal zu fressen gibt.
Als Quelle wird genannt A. H. Chapman, Regeln gegen Mitmenschen, Bern 1969, ohne Seitenangabe; zitiert bereits in Heyen: Die Bürokratie, S. 187.
Veröffentlicht in A. Paul Weber: Kritischer Kalender, 17 (1975), 2.–15. Februar. Ein befrackter, aber bereits in die Jahre gekommener und darüber glatzköpfig und schwerfällig gewordener Herr steigt die mit einem Teppich bespannten Stufen der großartigen Treppe eines herrschaftlichen Gebäudes hinauf, während ihm ein Narr von oben herab aufmerksam – vorwurfsvoll? belustigt? – dabei zuschaut, wie er den anscheinend erst jetzt bemerkten Dreck an seinem Krückstock am Boden abzustreifen versucht.
Weber zitiert den Text ohne Seitenangabe aus Kurt Tucholsky: Ausgewählte Werke, Reinbek 1965. Noch etwas breiter wiedergegeben findet sich sein Zitat auch in Heyen: Die Bürokratie, S. 188.
Robert Menasse: Die Hauptstadt, Berlin 2017, S. 150.
Menasse: Die Hauptstadt, S. 278.
Siehe Erk Volkmar Heyen: Rußlands höhere Beamtenschaft im Spiegel von Gogols »Tote Seelen« und Tolstojs »Auferstehung«, in: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 17 (2005), S. 243–259 (in Fn. 1 mit zahlreichen Hinweisen auf die internationale Sekundärliteratur zur literarisch-narrativen Spiegelung administrativer Strukturen und Prozesse).
Zitiert nach der von Norbert Miller herausgegebenen Werkausgabe des Hanser-Verlags, München 1963, Abteilung 1, Bd. 6, S. 1037– 1103, hier 1094.
Als Beispiele für die Nähe lassen sich zwei Marionettenbilder aus dem Jahr 1963 anführen: »Die Botschaft« und »Der neue Kopf«, abgebildet in A. Paul Weber: Kritischer Kalender, 6 (1964), 1.–11. Januar bzw. 26. Januar – 8. Februar.
Menasse: Die Hauptstadt, S. 277.
Eine solche entspannte literarische Thematisierung öffentlicher Verwaltung ist vergleichsweise selten. Deren Bild gestaltet sich meist stereotyp negativ; siehe den aufschlussreichen Überblick von Michael Kilian: Verwaltungskultur im Spiegel verschiedener Literaturgattungen, in: Winfried Kluth (Hg.): Verwaltungskultur, Baden-Baden 2001, S. 113–140, der von einem »Narrenspiegel« spricht (S. 134), und den Rezensionsaufsatz von Gideon Stiening: Neuere literatur- und kulturwissenschaftliche Studien zur poetischen Reflexion auf Bürokratie und Verwaltung, in: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 19 (2007), S. 345–358.
Eine ebenfalls der Liebe sich verdankende Form eigensinniger Treppennutzung, die sich Izquierdo zum Vorbild genommen haben könnte, hat bereits Ludwig Tieck in Szene gesetzt, und zwar in seiner Novelle »Des Lebens Überfluß« von 1837, der wundersamen Geschichte zweier jung Vermählter, die auch inmitten äußerlicher Not stets ihrer Liebe leben und daraus Zuversicht gewinnen. Ein froststrenger Winter treibt sie dazu, die Treppe des Hauses, in dessen zweitem Stock sie zur Miete wohnen, zu verfeuern, zunächst das Geländer, dann einzelne Stufen, bis die Treppe ganz und gar verschwunden ist und sie sich nur noch dank freundschaftlicher Hilfe versorgen können. So hat sich ihr träumerischer Sehnsuchtsort in einen Ort wirklichen bedrängten Rückzugs verwandelt, in den schließlich aber doch noch wieder ungetrübtes Glück einzieht.
Farbabbildung in Büche: Uwe Pfeiffer, S. 45.
Alles scheint hier seine Ordnung zu haben und seinen Gang zu gehen, und doch findet sich auch Unangepasstes, Widerstrebendes: die achtlos geknüllte und flüchtig entsorgte, gleichwohl mit roten Anstreichungen versehene und sich seltsam steif zur Schau stellende Doppelseite einer Zeitung, sodann das missmutige, abweisende Gesicht eines Mannes, der sich zum Maler und Betrachter umwendet und darüber wohl etwas aus dem Tritt gerät. Und noch etwas hat seinerzeit überrascht, ja provoziert: die gegenüber den gezeigten Material- und Lichtverhältnissen ungewöhnlich eigenständige, künstliche Farbgebung.
Gleichwohl wurde das Bild umgehend vom Kulturfonds der DDR angekauft. Um die Irritation zu verstehen, muss man sich ein ebenfalls in die Berliner Nationalgalerie aufgenommenes Gemälde vergegenwärtigen, das zwar ästhetisch durchaus eigenständig ist, politisch jedoch den staatstragenden SED-Ton anstimmt: »Leuna 1969« von Willi Sitte, 1967–1969; siehe dazu Heyen: Verwaltete Welten, S. 132 f.
Auch noch in anderer Hinsicht waren sie in der frühen Neuzeit bildlich gegenwärtig: zum einen bei der Tugendleiter, dem Sinnbild für die Aufgabe des christlichen Menschen, sich im Geiste des Evangeliums moralisch möglichst zu vervollkommnen und so der einem sündigen Leben im Jüngsten Gericht drohenden Strafe mithilfe des Heilands und der Kirche zu entgehen; zum anderen bei der Lebenstreppe, dem Sinnbild für Aufblühen und Verkümmern der körperlichen und geistigen Fähigkeiten, unabhängig von Stand, Beruf und Amt.
Es versteht sich, dass es auch Weber reizte. Für eine 1971 erschienene Neuausgabe des »Simplicissimus« gestaltete er – ein von ihm schon lange gehegtes Vorhaben – die Bebilderung. Doch hat er dabei den nachstehend hervorgehobenen Stufungs- und Aufstiegsaspekt leider nicht aufgegriffen. Anders der Komponist Karl Amadeus Hartmann in seiner bereits Mitte der 1930er-Jahre entworfenen, aber erst 1957 vollendeten und uraufgeführten Kammeroper »Des Simplicius Simplicissimus Jugend«.
Zitiert wird nach der von Alfred Kelletat verantworteten Textfassung des Winkler-Verlags: Johann Jakob Christoph von Grimmelshausen: Der abenteuerliche Simplicissimus, hg. von Alfred Kelletat, München 1956, gründend auf den ersten Drucken des »Simplicissimus Teutsch« (1669, tatsächlich bereits 1668) und der »Continuatio« (1669). Zu dem verwaltungshistorisch relevanten Metaphernreichtum dieser Zeit siehe auch Erk Volkmar Heyen: Metaphern für »Ampts-Person« und »Ampts-Tugend« in lutherischen Regentenpredigten des späten 17. Jahrhunderts, in: Peter Becker/Rüdiger von Krosigk (Hg.): Figures of Authority, Contributions towards a Cultural History of Governance from the Seventeenth to the Twentieth Century, Brüssel 2008, S. 29–50.
Grimmelshausen: Simplicissimus, S. 10 (2. Kapitel des Ersten Buchs); ähnlich die Ausdrucksweise S. 365 (20. Kapitel des Vierten Buchs) und S. 399 (4. Kapitel des Fünften Buchs). Auf das Wort »Staffel« wird Mitte des 19. Jahrhunderts auch Theodor Mommsen in seiner »Römischen Geschichte« zurückgreifen, und zwar um den Ämteraufstieg von Publius Cornelius Scipio, dem Bezwinger Hannibals, und Gnaeus P. Pompeius, dem Mit- und Gegenspieler Caesars, zu kennzeichnen.
Grimmelshausen: Simplicissimus, S. 426 (11. Kapitel des Fünften Buchs); siehe dazu die knappe Rückblende aufs eigene Leben am Schluss dieses Buches (23. Kapitel), S. 475–476. Bemerkenswerterweise greift auch noch Heinrich Mann in seinem Roman »Der Kopf« – dem letzten in seiner Kaiserreich-Trilogie nach »Der Untertan« und »Die Armen« – auf dieses Bild einer gewendeten Aufstiegsgesinnung zurück, indem er ganz am Schluss in Hinblick auf einen der beiden Hauptprotagonisten des Romans von einem »Staffelweg der Buße« spricht. Ebenfalls möglich ist ein Rückblick auf noch ältere Zeiten, namentlich auf das Heilsepos der »Divina Commedia« von Dante Aliguieri aus dem frühen 14. Jahrhundert. Hier spielt die Stufung eine wesentliche Rolle in der Schilderung des Bußgangs durch Hölle und Fegefeuer hinauf zum Paradies.
Neben der mechanischen Metaphorik bildet die organische den zweiten großen Strang in der Metapherngeschichte staatlicher Verwaltung; siehe Andreas Anter: Verwaltung und Verwaltungsmetaphorik. Der lange Weg der Maschine, in: Peter Collin / Klaus-Gert Lutterbeck (Hg.): Eine intelligente Maschine? Handlungsorientierungen moderner Verwaltung (19./20. Jh.), Baden-Baden 2009, S. 25–46, mit weiteren Nachweisen.
Grimmelshausen: Simplicissimus, S. 45 (15. Kapitel des Ersten Buchs).
Grimmelshausen: Simplicissimus, S. 47 f. (16. Kapitel des Ersten Buchs).
Grimmelshausen: Simplicissimus, S. 47 f. (16. Kapitel des Ersten Buchs).
Grimmelshausen: Simplicissimus, S. 79–82, hier 81 (27. Kapitel des Zweiten Buchs).
Grimmelshausen: Simplicissimus, S. 128–132, hier 130 und anschließend 131 (11. Kapitel des Dritten Buchs, überschrieben »Von dem mühseligen und gefährlichen Stand eines Regenten«).
Dies heißt aber nicht, dass Hierarchie zu ihrer bildlichen Darstellung einer Treppe bedürfte. Vgl. das 1937 entstandene Gemälde »Hierarchie« von Josef Scharl; Farbabbildung und Kommentar in Heyen: Verwaltete Welten, S. 264 f.