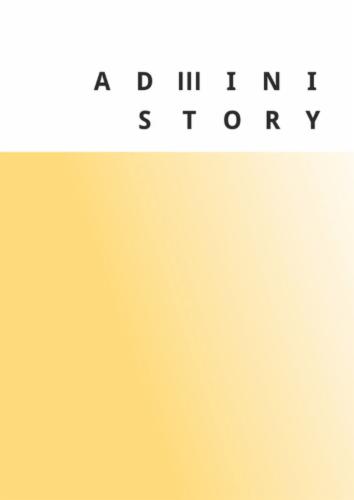Publicado en línea: 09 jul 2025
Páginas: 207 - 220
DOI: https://doi.org/10.2478/adhi-2023-0011
Palabras clave
© 2022 Jonathan Voges, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ab 1935 tourte der zweite Völkerbundfilm durch die Aktualitätenkinos der Welt; neben Erwartbarem – so einer knappen historischen Herleitung der Bedeutung des Völkerbundes aus den Verheerungen des Ersten Weltkrieges, Aufnahmen aus den Pariser Friedensverhandlungen und dem Schaulaufen der ›großen Männer‹ der Epoche(1) – zeigte der Film auch zunächst Überraschenderes: Beamte und Beamtinnen bei der Arbeit. Nachdem der Film nachvollzogen hatte, wie die Delegierten mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln nach Genf kamen (per Eisenbahn, per Flugzeug oder per Schiff),(2) nahm er die Zuschauerin und den Zuschauer mit in die Innenräume des soeben erst eingeweihten
»The Secretariat, the international civil service«, so die Zwischenüberschrift, die diesen Teil des Films einleitete. Was man zu sehen bekommt, wirkt wie eine gut getaktete und geölte
Joseph Avenol, Nachfolger Eric Drummonds im Amt des Generalsekretärs,(8) prüfte kameratauglich, was er vorgelegt bekommt, und segnete ab, was ihm aus dem
Sowohl in der Szene der Mitarbeiterinnen des Sekretariats wie auch bei der Fokussierung auf Avenol ist die Bildkomposition von Bedeutung.(10) Im ersten Fall fokussiert die Kamera auf den langen Tisch, auf dem die Papiere ausgerichtet werden und von einer Person zur nächsten weiterwandern; nicht die Mitarbeiterinnen stehen also im Zentrum, sondern das Produkt, an dem sie arbeiten, die Information. Anders bei Avenol: Zwar liegt auch hier das Papier in der Bildmitte, zum Teil verborgen hinter allerhand Büroutensilien (Kalender, Rollkartei, Füllfederhalter im Ständer etc.), zentral ist aber der Akt des Gegenzeichnens. Anders als die Mitarbeiterinnen im
Der Film war Teil der offiziellen Imagekampagne des Völkerbundes, ja er diente dazu, der fortlaufend schlechten Presse, die er in zahlreichen nationalen Öffentlichkeiten überall auf dem Globus genoss, ein positives Gegenbild entgegenzusetzen. Dass eine internationale Organisation sich
Für diesen Aufsatz allerdings ist die Frage viel wichtiger, welche Rolle die inszenierte administrative Geschäftigkeit für die Außenwirkung des Völkerbundes spielte, besonders dann, wenn man bedenkt, dass überbordender Bürokratismus und damit die Impotenz in wichtigen Fragen, tatsächlich entscheidend eingreifen zu können, einer der Hauptkritikpunkte insbesondere völkerbundfreundlicher ebenso wie völkerbundfeindlicher Personen war. Deren Hauptvorwurf war, dass der real existierende Völkerbund in dem, was er tun konnte, nicht weit genug gegangen bzw. eh nur ein Papiertiger gewesen sei: die Fremdbezeichnung »Weltbürokratie« war deshalb nicht immer positiv gemeint.(13)

Still aus League of Nations at Work; 1935

Still aus League of Nations at Work; 1935
Das Bild, das der Völkerbund gern von sich selber vermittelt sehen wollte, war aber eben jenes des gut funktionierenden Räderwerks, in dem die Schreibkraft an der Schreibmaschine letztendlich mit dem Generalsekretär über das Medium der Informationssammlung und -bereitstellung verbunden war und allesamt am gemeinsamen Ziel arbeiteten, der – so die Satzung des Völkerbundes – Erhaltung des Weltfriedens und der Förderung der internationalen Kooperation in den unterschiedlichsten Bereichen.(14)
»Der oft banale Ort Büro wird indessen symbolisch aufgeladen«, so Gianenrico Bernasconi und Stefan Nellen in der Einleitung zu einem schlicht mit »Das Büro« betitelten Sammelband.(15) Wie eine solche symbolische Aufladung aussehen konnte, wird im Folgenden am Beispiel des Sekretariats des Völkerbundes und des umbauten Raumes, den es für sich beanspruchen konnte, diskutiert.
Das Sekretariat des Völkerbundes ist eines der Themen, das zunächst schon zeit seines Bestehens und dann in der unmittelbaren Nachkriegszeit vielfach Anlass für politik-, sozial- und verwaltungswissenschaftliche Analysen bot.(16) Häufig war dabei die ganz praktische Frage leitbildgebend, ob das, was im Völkerbund realisiert worden war, Vorbild für die Nachfolgeorganisationen sein könne (allen voran die Vereinten Nationen, die sich ebenfalls einen großen und international zusammengesetzten MitarbeiterInnenstab leisteten und leisten).(17) In jüngerer Zeit versuchen Historikerinnen und Historiker dem Völkerbundsekretariat einen Sinn abzugewinnen,(18) fragen danach, was es tatsächlich leistete, wie international es am Ende tatsächlich zusammengesetzt war und ob es gelang (und falls ja, in welchem Ausmaß), die Belegschaft auf den internationalen Korpsgeist zu verpflichten.(19)
Mit meinem Aufsatz möchte ich einen anderen Schwerpunkt setzen, weniger nach Wirkungsweise des Sekretariats oder seinem Personal fragen, sondern mich vielmehr dem Raum widmen, in dem die Arbeit des Sekretariats erfolgte. Raum als Kategorie verstehe ich dabei als sozial konstruierten und sozial definierten Raum nicht einfach als Container, in dem sich Geschichte abspielt, sondern als Akteur, der Geschichte mitgestaltet, in dem er soziale Interaktionen präfiguriert, Wahrnehmungen prägt und zur Kommentierung herausfordert.(20) Das gilt insbesondere auch für einen politisch stark durchdrungenen Raum wie das Gebäude einer internationalen Organisation und auch für dessen vermeintlich a-politischen Bereich, nämlich dessen Verwaltung. Als Quellen beziehe ich mich vor allem auf Architekturentwürfe, Fotografien und – wie in der Einleitung – eben auf Film.
Der Aufsatz versteht sich so als Teil der neueren Völkerbundforschung, die in Abgrenzung zu älteren Arbeiten nicht mehr allein dessen Scheitern in den Fokus nimmt, sondern genauer fragt, was er eigentlich tat, so lange er Bestand hatte.(21) Das heißt – mit Susan Pedersen gesprochen – ein Zurück zum Völkerbund und Folge dieser Neuperspektivierung ist auch, dass jene Bereiche, die vormals eher ein Schattendasein in der Völkerbundforschung führten, genauer in den Blick genommen werden. Hier geht es dann vor allem auch um die technischen und sozialen, in der Darstellung der Zeit a-politischen, Abteilungen des Völkerbunds.(22) Der Völkerbund – wie auch die UN nach ihm, dem er dafür geradezu das Vorbild lieferte – war beides; zum einen ein institutionalisierter Ort, an dem sich alljährlich die Regierenden der Welt trafen, um über die brennenden Fragen der Zeit zu diskutieren. Zum anderen stellte er aber auch eine internationale Verwaltungseinheit bereit, die genau diese politischen Treffen informationell vorbereiten sollte und dafür Wissen aus aller Welt sammelte und so gleichsam zum Gehirn der Welt werden sollte, also jenem Ort an dem die internationalen Nervenstränge gebündelt zusammenlaufen sollten.
Um aufzuzeigen, wie ich vorgehe, begebe ich mich aber zunächst in einen anderen Raum, ja zunächst einmal sogar in ein anderes Gebäude, nämlich den ersten Sitz des Völkerbundes, der dann Ende der 1920er als zu klein befunden und Mitte der 1930er-Jahre dann durch den Neubau ersetzt wurde.(23) 1929 erschien eine von der britischen
Auf der Fotografie sieht man deutlich die Besuchertribüne als Garant dafür, dass alle Verhandlungen unter den Augen der Öffentlichkeit, transparent und gerecht stattfinden sollten.(27) Eine schärfere Abkehr von der Hinterzimmerdiplomatie vergangener Jahrhunderte war schlichtweg nicht denkbar,(28) der von Carl Schmitt noch als unabdingbar für Diplomatie angenommene Raum des „Arkanen“ war dahin: »Alles wird sich vor den Kulissen abspielen (vor einem Parkett von Papagenos).«(29)
Noch größere Sprengkraft hatte nur die schematische Darstellung, die auf den ersten Blick eher harmlos daherkam. Die Anordnung der Delegationen im Sitzungssaal folgte nämlich nicht machtpolitischen Kategorien wie dem Status in der internationalen Politik (Großmächte hatten keine besseren Plätze als kleine Staaten, Bulgarien teilte sich so einen Tisch mit dem Deutschen Reich, Griechenland mit Frankreich(30)) oder der ökonomischen Leistungsfähigkeit (das chronisch am Bankrott entlangexistierende Österreich(31) saß zum Beispiel neben den VertreterInnen des Kontinent-Staats Australien); Ordnung gebend war allein das Alphabet, die Staaten wurden entsprechend ihrer Anfangsbuchstaben (in französischer Schreibweise ihrer Namen) im Raum verteilt. Diente die Empore so dazu, Offenheit und Transparenz der »new diplomacy« augenscheinlich zu machen,(32) stand die alphabetische Ordnung der Delegationen und die auf dieser Grundlage erfolgte Verteilung im Raum für die durch den Völkerbund vermeintlich eingelöste Gleichbehandlung aller Staaten (sofern sie Mitglied waren); ein Staat, drei Delegierte, eine Stimme.(33)

Vollversammlung des Völkerbundes im Salle de la Réformation, Genf. Entnommen aus: Jones/Sherman: League of Nations, o. S

Schematische Darstellung der Vollversammlung des Völkerbundes im Salle de la Réformation, Genf. Entnommen aus: Jones/Sherman: League of Nations, o. S
Wie gesagt, es soll in der Folge nicht um den klar als politisch ausgewiesenen Raum des Sitzungssaales gehen; mir diente dieses Beispiel nur dazu, dass der Raum des Völkerbundes alles andere war als eine zu vernachlässigende Kategorie,(34) sondern ihr wurde hohe Bedeutung für das Gelingen des »Experiments« (neben der Metapher der
Deshalb verwundert es auch nicht, dass der Neubau des
»Erfrischend und neu, bei liebenswürdiger Einfachheit, wirkte wenigstens auf uns [ ] die Arbeit des aus der französischen Schweiz stammenden Architekten Corbusier«, leitete der Architekt Josef Hoffmann aus Wien die Evaluation der 377 eingereichten Entwürfe zur »Erbauung eines Völkerbundpalastes« in der
Besonders radikal war wiederum der schon angesprochene Entwurf Le Corbusiers, der geradezu eine
Deutlicher noch wurde der Architekt und später vor allem auch als Techniktheoretiker und -historiker von sich Reden machende Siegfried Giedion.(45) Auch er schrieb 1927 über den Architekturwettbewerb, auch er hatte zum Auswahlprozedere und zur Ausschreibung selbst nicht viel Gutes zu berichten und auch er befürchtete am Ende, dass »die Gespenster an die Reihe kämen und eine richtige Baukatastrophe im Anzug wäre.«(46) Was er unter den genannten Gespenstern verstand, machte er in seinem Artikel in der Bauwelt schon im Untertitelt deutlich – »Teuere [sic!] Stilarchitektur«. Das Außergewöhnliche an Giedions Artikel ist aber nun, dass er sich nicht lange bei einer ästhetisch motivierten Kritik an den »Theaterkulissen wie die Hagia Sophia, Petit Versailles oder ein richtiges Mausoleum« aufhielt.(47)
Ihm ging es vielmehr darum, präzise die Funktionen des Völkerbunds mit den benötigten architektonischen Lösungen kurzzuschließen und somit auch herauszuarbeiten, welcher administrativen Kultur der Völkerbund sich verpflichtet fühlen sollte (und wie diese kongenial zu umbauen sei).
Giedions Perspektive ist damit auch die, die die heutige (architektur-)historische Auseinandersetzung mit dem Palais des Nations prägt. Marco Ninno z. B. setzt sich in einem knappen Aufsatz – der sich vor allem dem Projekt Le Corbusiers widmet – intensiv mit der Ausschreibung und dem Wettbewerb auseinander. Dass das alte Völkerbundgebäude – der Palais Wilson – den Ansprüchen einer wachsenden Weltbürokratie nicht mehr gerecht wurde, wusste man schon seit Mitte der 1920er-Jahre. In der Ausschreibung wurde hervorgehoben, dass es bei dem Bau darum gehen müsse, »die große ideologische und symbolische Bedeutung des Baus des ersten Weltparlaments zu klären und hervorzuheben.« Ein Budget von 13 Millionen Franken war für das Projekt vorgesehen, die meisten Vorschläge überstiegen diese finanzielle Grenze (zuweilen um ein Vielfaches). Anders Le Corbusiers Entwurf, der nicht nur im Finanzrahmen blieb, sondern eben eine radikal moderne Variante eines Verwaltungsbaus anbot:
Interessanterweise beschrieb Giedion aus der Perspektive des Architekturkritikers den Völkerbund ähnlich wie ein prominenter schreibender Genf-Reisender, der mit der Zeit zur Grundausstattung des »esprit de Génève« wurde,(53) ohne dass er eine offizielle Funktion beim Völkerbund innegehabt hätte: George Bernard Shaw. Shaw hatte nicht viel übrig für die Sitzungen von Rat und Vollversammlung, die er als »comedy of Geneva« abqualifizierte; ihm hatte es aber das Sekretariat angetan: »The really great thing that is happening in Geneva is the growth of a genuinely international public service, the chiefs of which are ministers in a coalition which is, in effect, an incipient international government.« Mit Fleiß und Geschicklichkeit trüge das Sekretariat allein dafür Sorge, dass der Völkerbund nicht in nationalen Nicklichkeiten untergehe, sondern schlichtweg funktioniere.(54)
Grundlage für dieses Funktionieren war eine straffe Arbeitsorganisation, die »auf die Büroarbeit dieselben Prinzipien der Segmentierung und Effizienzsteigerung anwendet wie in der maschinellen Warenproduktion.«(55) Informationen müssten schnell fließen können, die Vorbereitung der Entscheidungen auf wissenschaftlicher Grundlage könne nur so gewährleistet werden, benötigte Informationen aus Bibliothek und Archiv nur so schnell beschafft werden. Die Architektur sollte so auch dem Selbstbild des Sekretariats selbst entsprechen – als einer hochprofessionellen, international zusammengesetzten und trotz der unterschiedlichen Herkünfte reibungslos zusammenarbeitenden globalen Verwaltungselite.(56)
Am deutlichsten sah Giedion diese Vorgaben im Entwurf Le Corbusiers verwirklicht:(57)
Angenommen wurde der Entwurf dennoch nicht, auch wenn er sich unter den neun Prämierten Arbeiten befand; Le Corbusier startete in der Folge eine intensive Lobbyarbeit für den eigenen Plan, sprach davon, dass dieser als einziger den »esprit moderne« des Völkerbundes repräsentieren könne, doch es half nichts.(59)
Zwar bekannte man sich seitens des Völkerbundes dazu, dass seine Ideen (und die seines Partners) durchaus anregend gewesen seien, ein neuer Entwurf wurde jedoch in Auftrag gegeben und dann auch schließlich umgesetzt. Zumindest von außen blieb nicht viel von Le Corbusiers hypermodernen Plänen; schaut man jedoch ins Innere, begibt sich also in den

Entwurf Le Corbusier für das Sekretariat des Völkerbundes. Entnommen aus: Giedion: Wer baut für den Völkerbund?, S. 1097

Postkarte, Palais des Nations, Éditions Jaeger, Genf o. J
Aus der Perspektive der Nachgeborenen erscheint es nun so, als hätte der Völkerbund allein mit Le Corbusiers Entwurf ein adäquates Heim für die eigenen Vorstellungen zur Funktion der ersten internationalen Organisation finden können: die vollkommene Abkehr von – gerade auch an diplomatischen Gebäuden – sonst gepflegter Repräsentationsarchitektur hätte deutlich machen können, dass man sich von der Diplomatie alten Typs endgültig verabschieden und eine ›new diplomacy‹ inaugurieren wolle,(60) das auch architektonische Bekenntnis zur
Kurz nach Fertigstellung und noch bevor die eigentlichen Arbeiten im neuen
Was es für die Verwaltungskultur einer sich als durchaus als
Die Büros der niederen Beamtinnen und Beamten blieben in der Reportage leider ausgespart, besucht wurde aber zumindest der Generalsekretär Joseph Avenol. Neben einem Schreibtisch mit moderner Lampe, fand sich ein großer Besprechungstisch und darüber hinaus, in die Wand eingelassen, eine Sofaecke; dass die Verwaltung einer internationalen Organisation zwar durchaus ein hierarchisches, zugleich aber auch ein kollaboratives Geschäft war, machte die Abbildung deutlich, die explizit den Besprechungstisch in den Vordergrund, Avenols individuellen Arbeitsplatz aber in den Hintergrund rückte.(67)
Der Eingang zum Sekretariat war – so wie es die avantgardistische Architekturkritik schon angesichts des Wettbewerbs von 1927 gefordert hatte – lichtdurchflutet und dank hoher Fenster an den Park angebunden. Zentral waren aufgeräumt wirkende Empfangstische platziert; hier sah man in der ganzen Fotoserie übrigens den einzigen Menschen: offenbar den Empfangschef am Telefon, der am Schreibtisch saß, auf dem eine Vielzahl von Knöpfen offenbar dazu diente, Verbindungen in den weitverzweigten

Büro des Generalsekretärs des Völkerbundes. Entnommen aus: Roger: Le Palais de la Société des Nations

Flur des Sekretariats des Völkerbundes. Entnommen aus: Roger: Le Palais de la Société des Nations
Wie sich diese
Die Frage, die sich zum Ende hin stellt, ist, was man geschichtswissenschaftlich aus diesen Befunden machen kann. Es dürfte deutlich geworden sein, dass weder die architektonische Ausgestaltung noch die Inszenierung von Architektur und Verwaltungsarbeit zufällig geschah, sondern beides einem Skript folgte, das sich zum Ziel setzte, eine bestimmte Botschaft an das jeweilige Publikum auszusenden. Und dieses Skript beruhte vor allem darauf, den Völkerbund und insbesondere dessen Verwaltung als hochprofessionell arbeitende Verwaltungsmaschine zu präsentieren, bei der zahnradartig die einzelnen Funktionen ineinandergriffen. Dazu gehörte aber eben auch, dass man sich davor verwahrte, Politik zu betreiben, sondern sich zur Selbstbeschreibung zahlreicher vermeintlich a-politischer Charakterisierungen bediente, wie eben jene der
Auf einer praxeologischen Ebene ging es sicher auch immer darum, Verwaltungsroutinen möglichst rational ausführen zu können.(71) Man kann dies vor allem auch auf der Ebene der unterschiedlichen technischen und sozialen Abteilungen ablesen: Die Agenda dieser Kommissionen und Unterkommissionen legten Rat und Versammlung (in enger Abstimmung mit den Mitgliedern der Kommissionen) fest. Aus dem festgelegten Arbeitsprogramm folgten dann die Arbeitsschritte, die an die entsprechende Abteilung im Sekretariat übertragen wurden. In den vielen Fällen betraf dies eben die Informationssammlung und -aufbereitung. Fragebögen wurden erstellt, an entsprechende Stellen in den Nationalstaaten verschickt, nach Rückkehr in Karteien eingefügt und für die Publikation vorbereitet. Gerade weil dieser Prozess mehrere unsichere Variablen enthielt, kam es zu Problemen: Unterlagen verschwanden, wurden nicht weitergeleitet, gingen auf dem Postweg verschütt oder konnten nicht zur Kenntnis genommen werden, weil es an ÜbersetzerInnen insbesondere seltener Sprachen in Genf mangelte und die Nationalstaaten es bei der Übersendung nicht für nötig befunden hatten, die Dokumente ins Englische oder Französische zu übersetzen, den beiden offiziellen Sprachen des Völkerbundes.(72) Das
Das solche Probleme in den doch immer zur Imagepflege veröffentlichten Publikationen keine Rolle spielten, dürfte nicht überraschen. Viel wichtiger ist hingegen erstens, dass es der Völkerbund überhaupt für notwendig befand, eine Imagepolitik zu betreiben. Grundlage dafür war, dass seine Vertreterinnen und Vertreter sich sehr klar darüber waren, dass der Völkerbund als internationale Organisation keinerlei reale Machtmittel hatte, am Ende allein auf die »weapon of publicity« und die »mobilisaton of shame«,(73) also die globale öffentliche Meinung, angewiesen war.(74) Diese versuchte er zeit seines Bestehens für sich einzunehmen.(75)
Zweitens ist es von Bedeutung, welche Rolle das Sekretariat in dieser Imagekampagne spielte. Es ging – meines Erachtens darum – visuell die auch in Textform immer wieder auftauchende Maschinenmetapher bildlich und im Raum repräsentiert umzusetzen.(76) Die politische Metapher der
Worum es dem Völkerbund bzw. seinen VertreterInnen mit der Berufung auf die Maschinenmetapher ging, war der Versuch, den ureigensten Gegenstandsbereich aus den Querelen des politischen Alltagsgeschäfts herauszulösen und stattdessen zu einem Gegenstand der guten, rationalen und vernunftgeleiteten Verwaltung zu machen. Eine a-politische internationale Verwaltung also, die, sobald sie angerufen worden ist, einfach nur ihr Programm abspule und so Konflikte ab- und Kooperationen aufbaue, war das auch architektonisch und bildlich umgesetzte Leitbild.
Dies war die eine Seite des Selbstbilds; die andere war jene, die H. G. Wells versuchte mit der Metapher des World Brain zu fassen zu bekommen (mit der er als notorischer Kritiker des Völkerbunds wohl kaum die internationale Organisation gemeint haben dürfte, auch wenn diese sich durchaus in ähnlichen Bestrebungen versuchte).(79) Es ging dabei darum, den Völkerbund zum informationellen Zentrum der Welt auszubauen – egal um welchen Bereich es ging, Informationen zu Wirtschaft,(80) Geistesleben,(81) Kultur,(82) Finanzen,(83) Universitäten,(84) Waffenhandel,(85) Drogenschmuggel,(86) internationaler Prostitution,(87) Gesundheit(88) und vielen anderen Bereichen flossen nach Genf und zu Berichten verdichtet wieder aus Genf heraus in alle Welt. Und dieses Zentrum des Wissens der Welt musste auf einem Stand arbeiten, der den Anforderungen an eine moderne Verwaltung entsprach. Wie wichtig und wertvoll diese Informationen waren, wurde mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs deutlich, als man so schnell wie möglich daran ging, die entsprechenden Sekretariatsabteilungen aus Genf weg- und am besten auf den amerikanischen Kontinent hinzuverlegen, in der Erwartung, dass die deutsche Wehrmacht am Ende auf die Schweizer Neutralität keine Rücksicht nehmen und das kleine Alpenland überfallen würde.(89)
The League of Nations at Work, 1935, online:
Dies ist ein gerne eingesetzter stilistischer Kniff auch in literarischen Genf-Reportagen. Vgl. Max Beer: Die Reise nach Genf, Berlin 1932.
Das Gesamtensemble reichte was den umbauten Raum anbetraf immerhin fast an die Ausmaße des Schlosses von Versailles heran.
Ich verwende hier die Metapher in Anlehnung an die häufig bei Völkerbundpublikationen anzutreffende Selbstcharakterisierung als
Vgl. Alfred E. Zimmern: Democracy and the Expert, in: Political Quarterly 1 (1930), H. 1, S. 7–25; hier S. 14.
Vorher macht der Film allerdings noch einen Abstecher zur internationalen Presse, deren Vertreter allesamt in Genf versammelt waren, sich auf modernen Stahlrohrmöbeln sitzend austauschten und die Neuigkeiten aus Genf in alle Welt aussandten – getreu dem Motto: „Public opinion is the mainstay of the League and that opinion is informed of what the League does by the press of the whole world.“ Zwischentitel, Minute 6:44.
Zur Spezifität von Büroarbeit, deren „Immaterialität“, vgl. auch Adriana Kapsreiter: Bürosaal – Großraumbüro – Bürolandschaft. Über den großflächigen Raum der Verwaltung, in: Gianenrico Bernasconi/Stefan Nellen (Hg.): Das Büro. Zur Rationalisierung des Interieurs, 1880–1960, Bielefeld 2019, S. 123–138; hier S. 124. Papierberge kann man als den Versuch sehen, die Produktion von Information dennoch bildlich umzusetzen.
Zu dessen am Ende unrühmlicher Rolle im Völkerbund vgl. James Barros: Betrayal From Within. Joseph Avenol, Secretary-General of the League of Nations, 1933–1940, Yale 1969.
Avenol wurde hier aus der Halbtotalen aufgenommen, genau jene Kameraeinstellung, die es ermöglicht, „Aussagen darüber zu treffen, in welcher Beziehung die abgebildeten Personen und Objekte zueinander stehen.“ Hier eben Avenol in der Beziehung zu den beschriebenen Papieren. Anja Peltzer/Angela Keppler: Die soziologische Film- und Fernsehanalyse. Eine Einführung, Berlin 2015, S. 65.
Vgl dazu ebd., S. 79.
Auch die Beteiligten selber wählten das Maschinenvokabular. Ranshofen-Wertheimer als hoher Völkerbundbeamter sprach z. B. davon dass er mit ein Eintritt in den Dienst beim Völkerbund „in einer Maschine gefangen sei, die mich nicht wieder entließ, bis ich zehn Jahre später das Sekretariat wieder verließ.“ Zitiert nach Karen Gram-Skjoldager: „A Great Experiment“. Professional Self-Perceptions and Working Conditions in the Secretariat, in: Haakon A. Ikonomou/Karen Gram-Skjoldager (Hg.), The League of Nations. Perspectives from the Present, Aarhus 2019, S. 235–245; hier S. 237.
Vgl. dazu Jonathan Voges: Werbung für Frieden und internationale Kooperation. Der Völkerbund und die „Waffe der Öffentlichkeit“, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft [Im Erscheinen]
Willy Ruppel: Genfer Götterdämmerung. Werden, Wirken und Versagen des Völkerbundes. 2. Auflage. Stuttgart 1940, S. 13.
Vgl Quincy Cloet: »A fuller knowledge of the facts«. The League of Nations‘ Endeavours to Produce International Expertise, in: Haakon A. Ikonomou/Karen Gram-Skjoldager (Hg.): The League of Nations. Perspectives from the Present, Aarhus 2019, S. 150–160.
Gianenrico Bernasconi/Stefan Nellen: Einleitung, in: dies (Hg.): Das Büro. Zur Rationalisierung des Interieurs, 1880 – 1960, Bielefeld 2019, S. 9–26; hier S. 10.
Vgl. J.V. Wilson: Problems of an International Secretariat, in: International Affairs 20 (1944), S. 542–554; Chester Purves: The Internal Administration of an International Secretariat. Some Notes Based on the Experience of the League of Nations, London 1945; Jean Siotis: Essai sur le Sécretariat International, Genf 1963.
Vgl. Egon F. Ranshofen-Wertheimer: The International Secretariat. A Great Experience in International Administration, Washington 1945.
Vgl. Karen Gram-Skoldager/Haakon A. Ikonomou: Making Sense of the League of Nations Secretariat. Historiographical and Conceptual Reflections on Early International Public Administration, in: European History Quarterly 49 (2019), H. 3, S. 420–444.
Klaas Dykmann: How International Was the Secretariat of the League of Nations, in: The International History Review 37 (2015), S. 721–744.
Vgl. Henri Lefebvre: Die Produktion des Raumes, in: Jörg Dünne (Hg.): Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt/Main 2006, S. 330–342.
Vgl. auch William Glenn Gray: What Did the League do, exactly?, in: International History Spotlight (2007), H. 1, S. 1–12
Susan Pedersen: Back to the League of Nations, in: The American Historical Review 112 (2007), 4, S. 1091–1117.
Vgl. dazu auch Gram-Skjolager: Professional Self-Perceptions.
Eine andere wäre z. B. E.E. Reynolds: The League Experiment, London 1939. Zur League of Nations Union allgemein vgl. Helen McCarthy: The British People and the League of Nations. Democracy, citizenship and internationalism, c. 1918–45, Manchester/New York 2011.
Robert Jones/S. S. Sherman: The League of Nations. From Idea to Reality. Its Place in History and in the World of To-Day, London 1929.
Jones/Sherman: The League of Nations.
Zur Bedeutung der Transparenz insbesondere auch als politisches Versprechen vgl. Jens Ivo Engels/Frédéric Monier: Researching the History of Transparency: Introduction, in: dies. (Hg.): History of Transparency in Politics and Society, Göttingen 2020, S. 7–20.
Schon der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hat ein Ende der Geheimdiplomatie in seinen berühmten 14 Punkten gefordert – ja, diese Forderung war der erste Punkt der Liste: „Offene, öffentlich abgeschlossene Friedensverträge. Danach sollen keinerlei geheime internationale Abmachungen mehr bestehen, sondern die Diplomatie soll immer aufrichtig und vor aller Welt getrieben werden.“ 14-Punkte-Programm von US-Präsident Woodrow Wilson, 8. Januar 1918, online:
Carl Schmitt: Römischer Katholizismus und politische Form, München 1925, S. 47.
Dass die Großmächte dennoch im Völkerbund eine Sonderrolle für sich beanspruchten, steht freilich auf einem anderen Blatt. Vgl. dazu Shiva-Kumar Sharma: Der Völkerbund und die Großmächte. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerbundpolitik Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands, 1929–1933, Frankfurt/Main 1978.
Vgl. dazu z. B. Phil Cottrell: Der Wiederaufbau Österreichs 1920 bis 1921. Ein Fall für die Privatwirtschaft oder Aufgabe des Völkerbundes?, in: Hartmut Berghoff/Jürgen Kocka/Dieter Ziegler (Hg.): Wirtschaft im Zeitalter der Extreme. Beiträge zur Unternehmensgeschichte Deutschlands und Österreichs, München 2010, S. 160–182; Peter Berger: Im Schatten der Diktatur. Die Finanzdiplomatie des Vertreters des Völkerbundes in Österreich, Meinoud Marinus Rost van Tonningen, 1931–1936, Wien 2000.
Zur »new diplomacy« durch den und im Völkerbund vgl. auch Madeleine Herren: Die Liaison. Gender und Globalisierung in der internationalen Politik, in: Eva Schöck-Quinteros et al. (Hg.): Politische Netzwerkerinnen. Internationale Zusammenarbeit von Frauen, 1830–1960, Berlin 2007, S. 183–204; hier S. 192.
„Jedes Bundesmitglied hat höchstens drei Vertreter in der Bundesversammlung und verfügt nur über eine Stimme.“ Satzung des Völkerbundes; Artikel 3, online:
Zur Bedeutung des Raumes in der Geschichtswissenschaft vgl. als essayistischen Einstieg z. B. Karl Schlögel: Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, Frankfurt/Main2 2007.
Vgl. als Quelle die Autobiographie von Robert Cecil: A Great Experiment. An Autobiography, London 1941; als wissenschaftliche Analyse auch Jean d’Aspremont: The League of Nations and the Power of „Experiment Narratives“ in International Institutional Law, in: International Community Law Review 22 (2020), S. 275–290.
Mikropolitik hier mit Neuberger verstanden als Möglichkeit von Organisationen, durch kleine Maßnahmen machtpolitisch wichtige Praxen vorzuprägen – wie in diesem Fall eben durch die Raumpolitik den Gleichheitsanspruch des Völkerbundes durchzusetzen. Vgl. Oswald Neuberger: Mikropolitik und Moral in Organisationen, Stuttgart 22015.
Josef Hoffmann: Wettbewerb Völkerbundspalast in Genf, in: Deutsche Bauzeitung 61 (1927), S. 93–104; hier S. 93.
Hoffmann: Wettbewerb Völkerbundspalast, S. 94.
Hoffmann: Wettbewerb Völkerbundspalast, S. 94.
Hoffmann: Wettbewerb Völkerbundspalast, S. 95ff.
Hoffmann: Wettbewerb Völkerbundspalast, S. 96.
Hoffmann: Wettbewerb Völkerbundspalast, S.96.
Wells allerdings sah durchaus nicht den Völkerbund, dem er im Grunde kritisch gegenüber blieb, als dieses
Hoffmann: Wettbewerb Völkerbundspalast, S. 100.
Zu dessen einflussreichsten Studien zählt vor allem Siegfried Giedion: Mechanization Takes Command. A Contribution to Anonymous History, Oxford 1948.
Siegrfried Giedion: Wer baut das Völkerbundgebäude? Teuere Stilarchitektur – neuzeitliche, zweckmäßige Lösungen, in: Bauwelt 18 (1927), S. 1093–1110, hier: S. 1093.
Giedion: Völkerbundsgebäude, S. 1093.
Giedion: Völkerbundsgebäude, S. 1094.
Transparenz hier verstanden mit Engels und Monier: „With respect to the political sphere, transparency would be the claim to make information on the contents and procedures of politics accessible.” Engels/Monier: Researching the History of Transparency, S. 18.
Giedion: Völkerbundgebäude, S. 1095.
Marco Ninno: A Modernist in Geneva. Le Corbusier and the Competition for the Palais des Nations, in: Haakon A. Ikonomou/Karen Gram-Skjoldager (Hg.): The League of Nations. Perspectives from the Present, Aarhus 2019, S. 246–255, hier S. 248f.
Ninno: A Modernist in Geneva, S. 249.
Robert de Traz listete Ende der 1920er Jahre das Personal des »Geists von Genf« auf; neben Shaw fanden sich darunter Adelige beiderlei Geschlechts (und mannigfaltiger Herkunft), die Witwe Woodrow Wilsons und weitere »femmes du monde, hommes de lettres ou d’affaires.« Robert de Traz: L’esprit de Genève, Lausanne 1992 [1927], S. 49.
George Bernard Shaw: The League of Nations, London 1929.
Kapsreiter: Bürosaal – Großraumbüro – Bürolandschaft, S. 124.
Vgl. dazu z. B. die frühe Selbstbeschreibung von L. Krabbe: Le Secrétariat Général de la Sociéte des Nations et son Activité, in: Paul Munch (Hg.): Les Origines et L’œuvre de la Sociéte des Nations. Tome II, Kopenhagen 1924, S. 264–282.
Tatsächlich waren Giedion und Le Corbusier befreundet, Giedion führte, nach dem der Entwurf seines Freundes nicht vom Völkerbund angenommen worden war, ausgehend von seinem Entwurf eine internationale Kampagne für moderne Architektur. Le Corbusier selbst wurde mit seinem Entwurf für den Palais des Nations immerhin weltweit als einer der modernsten Architekten der Zeit bekannt. Vgl. Jean-Louis Cohen: Le Corbusier – Le Grand. 1887–1965, Berlin 2014, S. 223.
Giedion: Völkerbundgebäude, S. 1097.
Zitiert nach Cohen: Le Corbusier – Le Grand, S. 227.
Vgl. am Beispiel des amerikanischen Präsidenten auch Lloyd E. Ambrosius: Woodrow Wilson and American Internationalism, New York 2017.
Zugleich, soviel Ambivalenz sei gestattet, eventuell auch den gegenüber Le Corbusier erhobenen Vorwurf, einer Spielart des Faschismus anzuhängen, noch mehr Munition gegeben. Vgl. Xavier de Jarcy: Le Corbusier. Un fascisme français, Paris 2015.
Die sich allerdings bei Touristinnen und Touristen durchaus großer Beliebtheit erfreute. Vgl. Timo Holste: Tourists at the League of Nations. Conceptions of Internationalism Around the Palais des Nations, 1925–1946, in: New Global Studies 10 (2016), S. 307–344.
Noëlle Roger: Le Palais de la Société des Nations, in: L’Illustration 96 (1938), S. 1–23.
Auf dem Titelcover direkt mit einem der bis heute durch den Park patrouillierenden Pfauen.
Vgl. dazu auch Michel Marbeau: La Société des Nations. Vers un monde multilatéral, 1919–1946, Tours 2017, S. 114.
Roger: Le Palais de la Société des Nations, S. 22.
Roger: Le Palais de la Société des Nations, S. 11.
Roger: Le Palais de la Société des Nations, S. 15.
Vgl. zu diesen Stiftungen auch Marbeau: La Sociéte des Nations, S. 114; zu den allegorischen Darstellungen in den Sitzungssälen auch explizit Michel Marbeau: La patrimoine culturel du palais des Nations. Les peintures murales de José Maria Sert, New York 1985.
An diesem Punkt wäre natürlich eine Gender-Perspektive unerlässlich, die deutlich herausarbeiten müsste, dass es gerade das weibliche Verwaltungspersonal war, das die
Vgl. Sven Reichardt: Praxeologische Geschichtswissenschaft. Eine Diskussionsanregung, in: Sozial.Geschichte 22 (2007), S. 43–65.
Vgl. z. B. am Beispiel der Gesundheitsabteilung des Sekretariats Iris Borowy: World Health in a Book. The Internationalist Health Yearbooks, in: dies./Wolf D. Gruner (Hg.): Facing Illness in Troubled Times. Health in Europe in the Interwar Years, 1918–1939, Frankfurt/Main 2005, S. 85–127.
Alfred Zimmern: The League’s Handling of the Italo-Abyssinien Dispute, in: International Affairs 14 (1935), S. 751–768; hier S. 764.
Vgl. Jürgen Osterhammel: Die Weltöffentlichkeit im 20. Jahrhundert, in: ders.: Die Flughöhe der Adler. Historische Essays zur globalen Gegenwart, München 2017, S. 54–74.
Z. B. auch über die Einflussnahme auf Schülerinnen und Schüler. Vgl. dazu Jonathan Voges: »Moralische Abrüstung« als Grundlage von Völkerversöhnung? Die Völkerbundorganisation für intellektuelle Kooperation und die Bemühungen um einen dauerhaften Frieden in den 1920er und 1930er Jahren, in: Anne Couderc/Corinne Defrance/Ulrich Pfeil (Hg.): La réconcialiation. Histoire d’un concept entre oubli et mémoire, Brüssel 2022, S. 195–214.
Vgl. für die Verwendung des Maschinenbegriffs z. B. Charles W. Pipkin: The Machinery of Experiment at Geneva, in: Political Science Quarterly 47 (1932), S. 274–281.
Barbara Stollberg-Rilinger: Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats, Berlin 1986, S. 13.
Stollberg-Rilinger: Der Staat als Maschine, S. 12.
Zu Wells‘ Kritik am Völkerbund vgl. z. B. Herbert George Wells: The Work, Wealth and Happiness of Mankind. Bd. 2, New York 1931, S. 702–703.
Vgl. Patricia Clavin: Securing the World Economy. The Reinvention of the League of Nations, 1920–1946, Oxford 2013.
Vgl. Jonathan Voges: Eine Internationale der »Geistesarbeiter«? Institutionalisierte intellektuelle Zusammenarbeit im Rahmen des Völkerbunds, in: Christian Henrich-Franke et al. (Hg.): Grenzüberschreitende institutionalisierte Zusammenarbeit von der Antike bis zur Gegenwart, Baden-Baden 2019, S. 355–384.
Vgl. Jean-Jacques Renoliet: L‘UNESCO oublié. La Société des Nations et la coopération intellectuelle (1919–1946), Paris 1999.
Vgl. Patricia Clavin/Jens-Wilhelm Wessels: Transnationalism and the League of Nations: Understanding the Work of Its Economic and Financial Organisation, in: Contemporary European History 14 (2005), H. 4, S. 465 – 492.
Vgl. Victor Karady: Student Mobility and Western Universities. Patterns of Unequal Exchange in the European Academic Market, 1880–1939, in: Christophe Charle/Jürgen Schriewer/Peter Wagner (Hg.), Transnational Intellectual Networks. Forms of Academic Knowledge and the Search for Cultural Identities, Frankfurt/Main 2004, S. 361–399.
Vgl. David R. Stone: Imperialism and Sovereignity. The League of Nations’ Drive to Control the Global Arms Trade, in: Journal of Contemporary History 35 (2000), H. 2, S. 213–230.
Vgl. Bertil A. Rendborg: International Drug Control. A Study of International Administration by and through the League of Nations, Washington 1947.
Vgl. Thomas Fischer: Frauenhandel und Prostitution. Zur Institutionalisierung eines transnationalen Diskurses im Völkerbund, in: ZfG 54 (2006), H. 10, S. 876–887.
Vgl. Iris Borowy: Coming to Terms with World Health. The League of Nations Health Organisation 1921–1946, Frankfurt/Main 2009.
Vgl. David Ekbladh: American Asylum. The United States and the Campaign to Transplant the Technical League, 1939–1940, in: Diplomatic History 39 (2015), H. 4, S. 629–660.